
Die von der Ampel-Koalition 2023 beschlossene Wahlrechtsreform hatte das Ziel, den Bundestag zu verkleinern. Eine aktuelle Analyse des Wahlergebnisses vom 23. Februar 2025 zeigt jedoch, dass der Bundestag nach dem alten Wahlrecht nur geringfügig größer gewesen wäre.
Laut Berechnungen der Plattform „election.de“ im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hätte das frühere Wahlrecht zu 633 Abgeordneten geführt – lediglich drei mehr als die nun festgelegten 630 Sitze. Wären FDP und BSW in den Bundestag eingezogen, wäre die Gesamtzahl der Abgeordneten auf 705 gestiegen. Zum Vergleich: Im alten Bundestag vor der Reform gab es noch 735 Sitze.
Das neue Wahlrecht schafft Überhang- und Ausgleichsmandate ab und führt eine feste Obergrenze von 630 Abgeordneten ein. Entscheidend ist dabei die Zweitstimmenabdeckung: Wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, verfallen diese Mandate. In einem solchen Fall wird das prozentuale Erststimmenergebnis aller Direktmandatsgewinner der Partei verglichen, und der Kandidat mit dem schwächsten Ergebnis erhält keinen Sitz im Bundestag.
Bei der Bundestagswahl 2025 konnten 15 CDU-Kandidaten und drei CSU-Kandidaten trotz des besten Erststimmenergebnisses in ihrem Wahlkreis kein Direktmandat gewinnen, da ihnen die erforderliche Zweitstimmendeckung fehlte. Bei der CDU konnten diese Verluste durch Listenkandidaten ausgeglichen werden.
Besonders betroffen von der Reform war die CSU. So verloren drei ihrer Kandidaten trotz Mehrheiten bei den Erststimmen ihre Direktmandate aufgrund fehlender Zweitstimmendeckung. Da die CSU ausschließlich in Bayern antritt, konnte sie diese Verluste nicht durch Listenmandate aus anderen Bundesländern kompensieren.
Die Union hat in ihrem Wahlprogramm bereits angekündigt, das Wahlrecht wieder zu ändern. Um dennoch eine Verkleinerung des Bundestags zu bewirken, will die Union die Anzahl der Wahlkreise reduzieren.





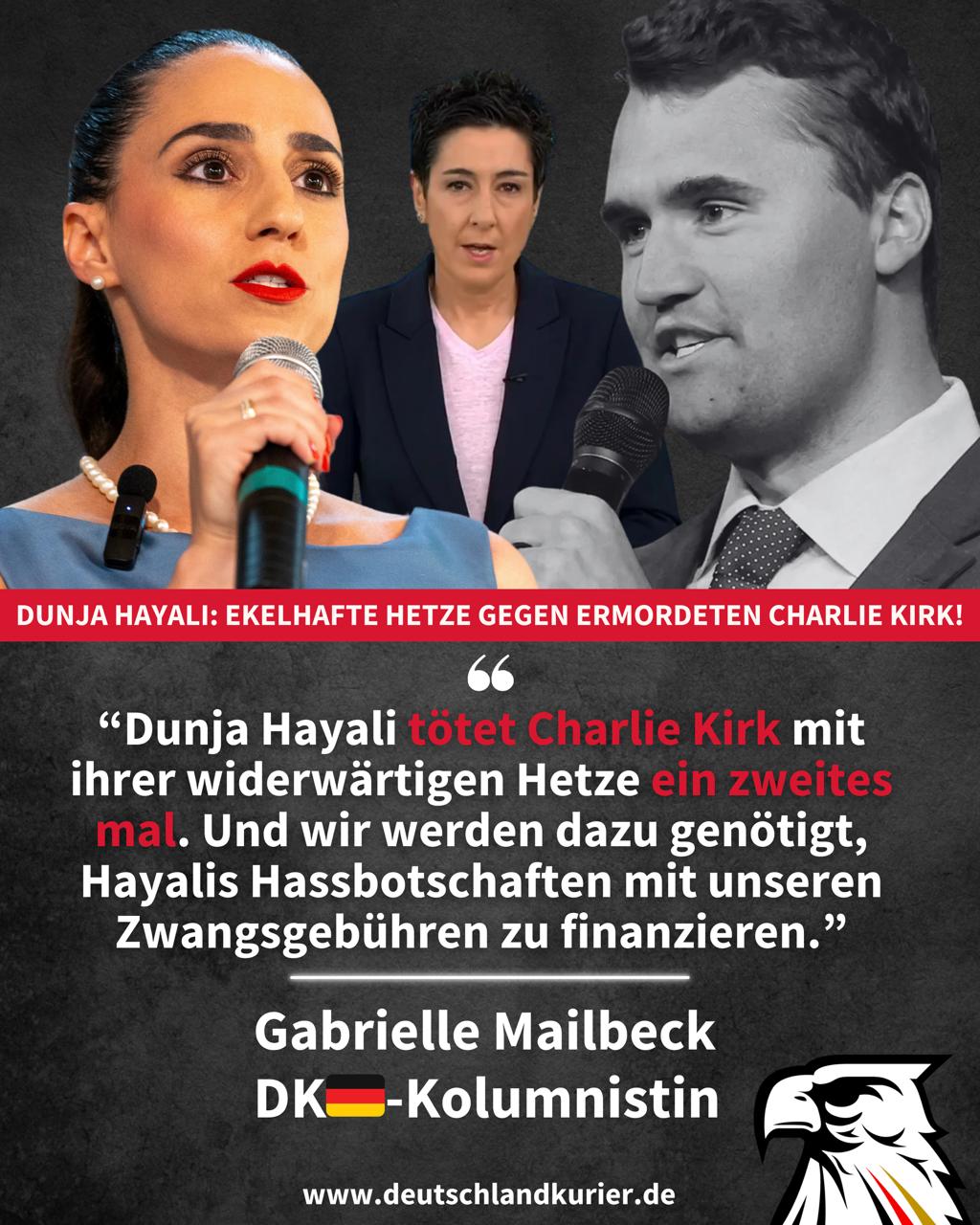




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























