
Der Verfassungsschutz steigt in den Kulturkampf ein.
Darauf deutet die Präsentation eines Vermerks, mit dem der brandenburgische Inlandsgeheimdienst die in Umfragen stärkste Partei zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung erklärt. Die brandenburgische AfD geht demnach gezielt gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung vor. Wäre es so: Wir müssten uns alle große Sorgen machen.
Die aktuelle Folge „Kissler Kompakt“ sehen Sie hier:
Ob es aber so ist, ging aus der Präsentation nicht hervor. Stattdessen belehrte uns der Innenminister: Die AfD sei eher ein Fanklub als eine Partei. Sie bestehe aus loyalen Anhängern, weniger aus mündigen Wählern. Damit erreichte der Innenminister das Gegenteil des Beabsichtigten. Ohne es zu wollen, stellte er der AfD eine Art Unbedenklichkeitserklärung aus.
Diese Pressekonferenz wird in die Geschichte des Landes Brandenburgs eingehen: als Exempel für eine Politik, die den parteipolitischen Gegner verharmlost, indem sie ihn verteufelt. Innenminister René Wilke gehörte lange der umbenannten SED an. Für „Die Linke“ war er Oberbürgermeister in Frankfurt an der Oder. Nun zeigte Wilke sich in einer Rolle, die ihm nicht gut steht: als Kulturkämpfer gegen Rechts.
Die Hochstufung der AfD vom Verdachtsfall zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung ist keine Kleinigkeit. Der Verfassungsschutz – in Brandenburg eine Abteilung im Innenministerium – darf an seiner Überparteilichkeit keinen Zweifel lassen. Parteiischer aber als Dienstherr Wilke kann man nicht auftreten. Wilke hätte besser geschwiegen, um seinen Verfassungsschutz nicht ins Zwielicht zu rücken.
Ein Kritikpunkt des Innenministers an der rechten Opposition lautet: Sie rede die Gewaltenteilung weg. Wie soll das gehen? Kann man eine Gewaltenteilung weg reden? Das behauptet René Wilke.
Der Vorwurf lautet also: rechtes Ausdrucksvergehen. Wenn es eine Gewaltenteilung gibt – und davon bin ich überzeugt – kann man diese nicht durch Reden zum Verschwinden bringen. Skandalisiert wird vielmehr eine Meinung, die Kritik übt am Zustand der Gewaltenteilung. Und eine solche Kritik, meine ich, muss erlaubt sein – wie auch eine Kritik an dieser Kritik. Beides sollte kein Fall für den Verfassungsschutz sein.
Kern der Wilkeschen Ausführungen ist Kulturkritik. Der Innenminister vergleicht die AfD mit einem Fußballklub.
Andere Parteien, so Wilke, hätten Wähler, die sich mal dieser, mal jener Partei zuwenden. Bei der AfD sei das anders. Sie habe einen „kulturellen Gemeinschaftsraum“ etabliert, innerhalb dessen man mit der AfD durch dick und dünn gehe – wie die Fans eines Fußballvereins.
Wilke schiebt die AfD aus dem politischen in den kulturellen Bereich. Die Milieubildung macht er ihr zum Vorwurf. Man könnte auch sagen: Die AfD hat laut dieser Beobachtung ein hohes Maß an Stammwählern, die nach dem Motto agieren – right or wrong, my party. Diese Diagnose alarmiert die Vertreter anderer Parteien, die sich mit launischen Wechselwählern herumschlagen müssen. Der AfD ist es laut Wilke gelungen, ein emotionales Zuhause zu kreieren.
Warum soll es den Verfassungsschutz bekümmern, warum soll es auf extremistische Bestrebungen deuten, wenn eine Partei von einem loyalen Milieu getragen wird? Indem Wilke den Blick auf die kulturelle Dimension lenkt, erweckt er einen fatalen Eindruck: Das Innenministerium scheint sich als Gralshüter einer überkommenen politischen Ordnung zu verstehen, die bei neuen Formen der Wählerbindung überfordert ist – und den Verfassungsschutz in Gang setzt.
Und außerdem: Gibt es diese „politische Fankultur“ nur bei der AfD?
Die AfD ist eine rechte Partei. Der brandenburgische Landesverband segelt hart am rechten Rand. Es gibt Gründe, vor der AfD zu warnen. Es gibt für viele Wähler Motive, die AfD zu wählen. Beides macht den Spannungsbogen einer Demokratie aus.
Ein Inlandsgeheimdienst aber, der wie ein parteiischer Schiedsrichter im demokratischen Wettbewerb auftritt, hat seinen Zweck verfehlt.









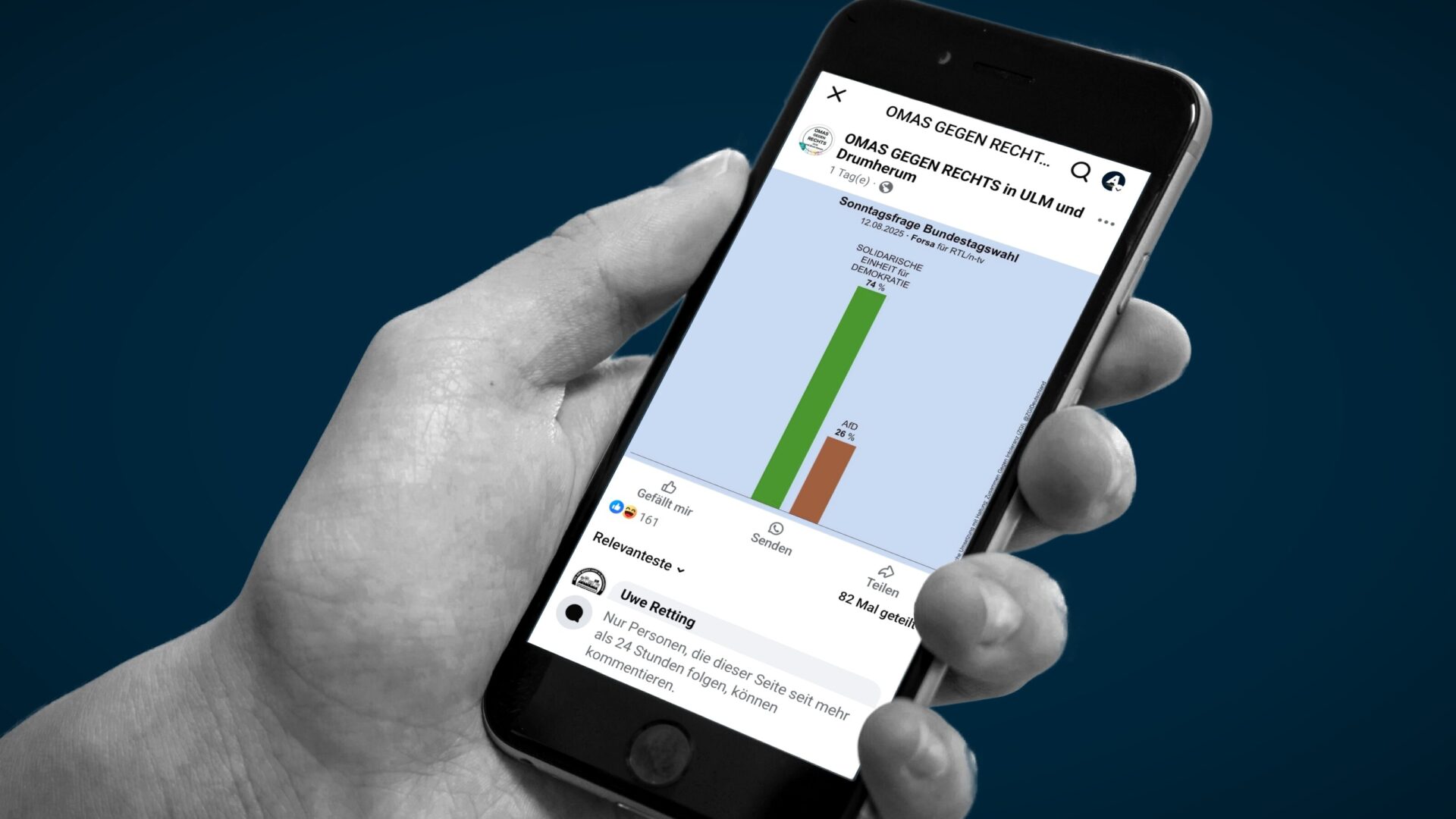
 ALASKA-COUNTDOWN: Trump trifft auf Putin – Kann das Treffen Frieden in der Ukraine bringen?
ALASKA-COUNTDOWN: Trump trifft auf Putin – Kann das Treffen Frieden in der Ukraine bringen?






























