
Immer mehr deutsche Brauereien machen dicht. Besonders stark betroffen sind Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. Dort trifft es vor allem kleine, familiengeführte Häuser, die den gestiegenen Kosten nicht mehr standhalten können. Jetzt schlagen auch die Großen Alarm. „Die Brauereien werden wie Fliegen von der Wand fallen“, so Oettinger-Chef Stefan Blaschak in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen, „bei den Kleinen sehen wir fast täglich Insolvenzen – es wird auch die Großen treffen.“
Die deutsche Brauwirtschaft gerät ins Straucheln. Jahrhundertealte Familienbetriebe, einst fester Bestandteil regionaler Identität, müssen ihre Tore schließen. Der Deutsche Brauer-Bund spricht von einer „nie dagewesenen Krise“ und warnt vor einem schleichenden Ausbluten einer traditionsreichen Branche. Blaschak spricht von einem Erdrutsch und schließt eine Produktionsstätte in Braunschweig.
Der Bierabsatz in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,3 Prozent oder 262 Millionen Liter auf rund 3,9 Milliarden Liter gesunken. Das sind rund 3 Millionen Dosen Bier weniger pro Tag. „In Deutschland ist wie in vielen Ländern Europas der Bierkonsum deutlich rückläufig. Dies hat zum einen demografische Gründe. Zum anderen bekommen die Brauereien weiterhin die massive Konsumzurückhaltung der Verbraucher zu spüren“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele, vor kurzem.
Laut Statistischem Bundesamt sank die Zahl der Brauereien im Jahr 2024 auf nur noch 1.459 Betriebe – das sind 52 weniger als im Jahr zuvor. In den vergangenen fünf Jahren mussten insgesamt 93 Brauereien aufgeben, ein Rückgang um sechs Prozent.
So schloss nach 471 Jahren die Gesellschaftsbrauerei Viechtach in Niederbayern, in Koblenz stellte die traditionsreiche Königsbacher-Brauerei ihren Betrieb ein, die Memminger Brauerei folgte im Frühjahr 2024. Auch die Schlössle-Brauerei in Neu-Ulm musste nach 334 Jahren aufgeben.
Aber die deutsche Brauwirtschaft steht nicht nur wegen sinkenden Bierkonsums unter Druck. Die Produktionskosten sind dramatisch gestiegen. Rohstoffe, Energie, Personal und Logistik verteuerten sich seit 2020 um bis zu sechs Prozent jährlich, während die Verkaufspreise kaum angehoben werden konnten. Es entstand eine Kostenlücke, die viele kleinere Betriebe nicht mehr stemmen können. Die großen Konzerne haben zwar mehr Spielraum, doch auch sie spüren die Belastung.
„Wir erleben eine dramatische Marktbereinigung“, so der Deutsche Brauer-Bund. Immer mehr Familienbetriebe müssten nach Jahrhunderten aufgeben. Damit gehe nicht nur wirtschaftliche Substanz verloren, sondern auch kulturelles Erbe: Brauereien sind vielerorts eng mit der regionalen Identität verbunden, sie prägen Feste, Gastronomie und Vereinsleben.
Der Brauer-Bund fordert das Übliche: weniger Steuern, weniger Bürokratie und so etwas wie „faire Energiepreise“. Vor allem müsste die Mehrwertsteuer in der Gastronomie gesenkt werden und natürlich: Abbau von Bürokratie und gezielte Unterstützung kleinerer Betriebe.
So weit – so normal. Kein Wort natürlich zur „Energiewende“, die die Energiekosten in astronomische Höhen treibt. Dabei haben die Brauereien nach der Chemiebranche den zweithöchsten Gasbedarf in Deutschland; deren Wohl und Wehe hängt direkt von den Energiepreisen ab. Die energieintensiven Betriebe leiden besonders unter den Folgen der Energiewende. Robert Habeck hat Atomkraftwerke abgeschaltet. Ergebnis: einer der teuersten Strompreise Europas.
Für Brauereien, die Kühlung, Erhitzung und Transport sichern müssen, bedeutet das einen Kostenhammer. Die teure Glasherstellung schlägt sich ebenso auf die Kosten nieder. Nicht bezahlbar sind sogenannte „alternative Wärmekonzepte“ für Brauereien, aber auch kein Wort dazu.
Eine mittelgroße Brauerei mit einer Jahresproduktion von 1 Millionen Hektoliter (100 Millionen Liter) benötigt 10 Millionen kWh Energie. Bei aktuellen Preisen summiert sich das auf fünf bis acht Millionen Euro Energiekosten pro Jahr. Bei einer Jahresproduktion von acht Millionen hl (= 800 Millionen Liter) mit einem Energiebedarf von ~80 GWh/Jahr kosteten früher Strom und Gas zusammen etwa fünf Millionen Euro. Heute nach der Preisexplosion sind das bis zu 20 Millionen Euro jährlich.
Die Produktionskosten einer Flasche Bier belaufen sich ohne Steuern, Logistik, Handel auf etwa 25 bis 35 Cent. Nach der Energiekrise stieg der Energiekostenanteil auf bis zu 20 Prozent an; vorher lag er bei sechs bis acht Prozent. In einer Kiste mit 20 Flaschen stecken also 40 Cent reine Energie – vor der Krise. Jetzt, dank Habeck und den Grünen, sind die Energiekosten auf bis zu 1,20 Euro angewachsen. Dies bei Preisen von teilweise 10 Euro pro Kasten im Supermarkt.
Die Energiekosten für eine Flasche Bier wirken klein – nur rund 2 Cent. Aber weil Brauereien in Cent-Margen rechnen, entscheidet schon diese Belastung über Gewinn oder Verlust. Bei Millionen Flaschen summiert sich das auf Millionenbeträge – für kleine Brauereien oft das Aus. Schon ein paar Cent Energiekosten pro Liter entscheiden über Gewinn oder Verlust.
Gleichzeitig verschärfen EEG-Regelungen das Problem: Landwirtschaftliche Flächen werden lieber für Energiepflanzen genutzt als für Braugerste. Das treibt die Rohstoffpreise nach oben. Aber kein Wort der Kritik der Brauer an Habeck & Co. Die Politik fordert von Brauereien den klimaneutralen Umbau – doch der ist für kleine und mittlere Betriebe kaum zu stemmen. Milliarden-Investitionen in neue Energie- und Wärmekonzepte wären nötig.
Immerhin können sich die Brauereien noch die Lobbyorganisation Deutscher Brauer-Bund leisten. Der hat ausgerechnet SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger zur neuen „Botschafterin des Bieres“ gemacht – während in ihrem Saarland Brauereien reihenweise dichtmachen. Vor ihr war Carsten Linnemann (CDU) Bier-Botschafter. Doch weder Union noch SPD haben etwas gegen steigende Energiepreise, überzogene und teure Umweltauflagen und Bürokratie getan – die Hauptursachen des Brauerei-Sterbens.
Während Traditionshäuser schließen und Oettinger vor dem Kollaps warnt, posieren Politiker gern mit Maßkrug. Ihre politischen Botschaften klingen dabei hohl wie ein leeres Bierfass. Und der Brauer-Bund applaudiert artig.


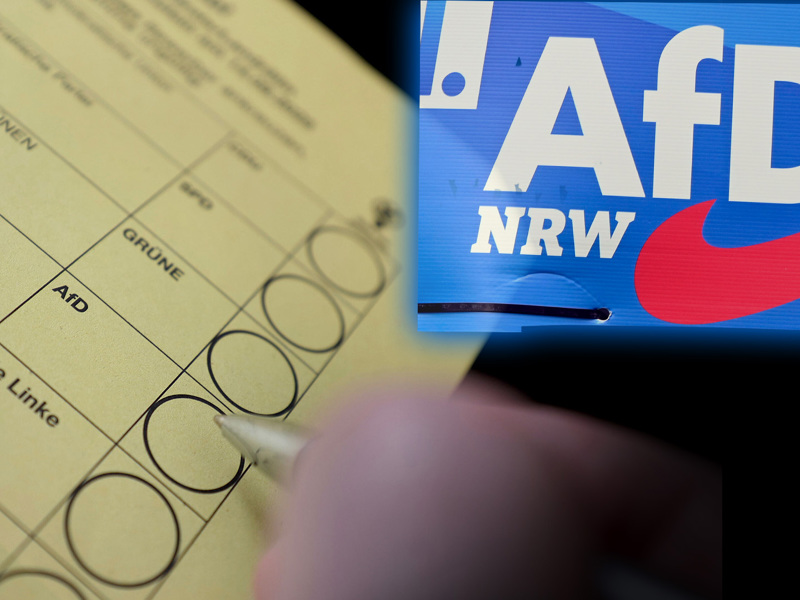


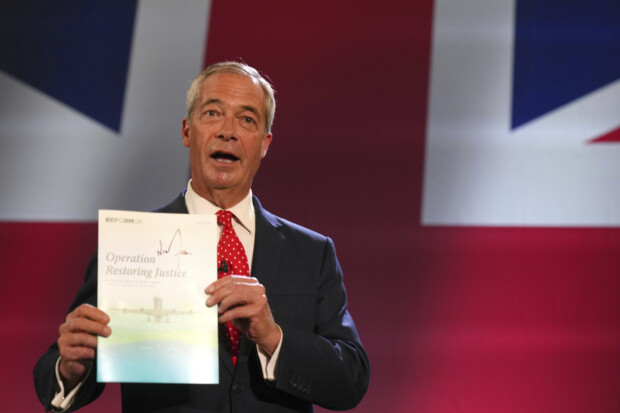



 PUTINS KRIEG: Russland will Angriffe auf Ukraine verstärken! Selenskyj will Sanktionen | WELT STREAM
PUTINS KRIEG: Russland will Angriffe auf Ukraine verstärken! Selenskyj will Sanktionen | WELT STREAM






























