
Hart aber fair 360 ist ein neues Format, das vom Hart aber fair -Moderator Louis Klamroth moderiert wird. Ein Politiker sitzt an einem Tisch in der Mitte, und um ihn herum sitzen 25 Kritiker. Diese können mit dem Politiker zu drei kritischen Thesen diskutieren, und wenn dem Publikum, also den 24 Kritikern in Warteposition, die Diskussion zu langweilig wird oder sie bessere Argumente haben, dann können sie mit einem Buzzer das Gespräch unterbrechen und der Nächste ist dran – damit kopieren die öffentlich-rechtlichen ein Format aus den USA, das sich vor den Wahlen großer Aufmerksamkeit und Beliebtheit erfreute.
Die Politiker werden separat befragt: Als erster Gast kam Wirtschaftsminister und grüner Kanzlerkandidat Robert Habeck. Er musste sich drei Themenblöcken stellen: „Grüne Politik macht Deutschland unsicherer!“, „Die Grünen sind eine Verbotspartei!“ und „Grüne Politik ruiniert die deutsche Wirtschaft“.
Bei der Sicherheit ging es vor allem um die Migrationsfrage. Eine junge Frau, Feodora Lüdemann, konfrontierte Habeck mit ihrem Leben. Sie ist in Berlin-Neukölln aufgewachsen, aber mittlerweile weggezogen, worüber sie nach eigenen Aussagen froh ist. Sie erzählte Habeck, dass man in Neukölln nicht mehr sicher sei als Minderheit und als Frau und berichtet, wie ihr Nachbar vor anderthalb Jahren fast erstochen wurde. Lüdemann warf den Grünen vor, der Polizei in den Rücken zu fallen, anstatt diese zu unterstützen.
Habeck wollte die Aussagen kontern und verwies darauf, dass die Grünen seit kurzem Straftäter abschieben wollen. Dass es großen Protest und Widerstand innerhalb der Grünen gegen dieses Forderung gibt, erwähnt er nicht. Als weitere Sicherheitsmaßnahmen sieht Robert Habeck nur weitere Messerverbotszonen als realistisch. Seine Gesprächspartnerin kann nur noch lachen: Sie sieht in Messerverbotszonen keine Lösung und verweist darauf, dass es sowieso verboten sei, Menschen mit einem Messer abzustechen. Habeck reagiert pikiert: „Das ist nicht ganz so witzig“, entgegnet er dem Lachen pampig.
Habeck muss aber zugeben, dass eine Messerverbotszone nichts bringt, wenn der Täter vorhat, jemanden zu ermorden. Stattdessen verweist er darauf, dass Handgreiflichkeiten dann nicht durch das Ziehen eines Messers eskalieren und dass ein Land, in dem weniger Messer getragen werden, ein sichereres Land wäre.
Bei der Frage, ob die Grünen eine Verbotspartei seien, geht es vor allem um das Tempolimit. Christoph Grau, Inhaber eines Autohauses und einer Tuning-Werkstatt, der auch die Gruppe Fridays for Hubraum gegründet hat, mischt sich in die Tempolimit-Debatte ein. Als Argument führt er an, dass mehrere europäische Länder die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen wieder anheben und dass wir in Deutschland weniger Verkehrstote auf Autobahnen haben als Länder, die ein Tempolimit haben.
Doch Habeck möchte auf die Unfallstatistik gar nicht eingehen. „Können wir darüber übereinstimmen, dass, wenn Unfälle bei hoher Geschwindigkeit passieren, sie schlimmer sind, als wenn sie bei nicht so hoher Geschwindigkeit passieren?“, so Habeck, der die Regelung auf deutschen Autobahnen als „deutscher Sonderweg“ beschreibt. Habeck argumentiert, dass man mit Tempolimit entspannter reist. Dass man in Deutschland aufmerksamer ist als in Ländern mit Tempolimit, nennt Habeck „Verkehrssicherheit durch Angst“.
Christina Böhm, die aus dem Handwerk kommt, redet mit Habeck über Bürokratie und die damit einhergehende Unattraktivität für junge Menschen, einen Betrieb selbst zu führen. Böhm will von Habeck wissen, warum der Bürokratieabbau, der von allen Parteien gefordert wird, nicht klappt. „Es liegt immer daran, dass man über die Verwaltung versucht, Sicherheit des Verfahrens herzustellen.“, so Habeck. Habeck sieht als Ausweg, dass man mehr Verantwortung an die Betriebe übergibt. Böhm sagt Habeck klar, dass die Unternehmen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
Doch warum wird dann Bürokratie nicht abgebaut? Habeck kommt ins Schlingern und argumentiert damit, dass die Regeln entstanden sind, weil mal etwas passiert ist oder man davon ausgeht, dass etwas passieren kann. Bürokratie kommt nach Habecks Ansicht nicht daher, „dass ihnen jemand etwas Böses will“. Stattdessen argumentiert er damit, dass die Verwaltung „alles besonders richtig machen will“, um beispielsweise Unfälle zu vermeiden.
Bäcker Tobias Exner konfrontiert Habeck mit der Forderung der Grünen nach einem Mindestlohn von 15 Euro die Stunde. Er pocht auf die Tarifautonomie und erläutert Habeck, dass die Mitarbeiter von einer solchen Erhöhung nichts hätten, weil dann Preise und Abgaben wieder steigen würden. Habeck versucht dem Bäckermeister zu erklären, dass der Mindestlohn zum Leben reichen soll und es deswegen die Erhöhung braucht. Doch Exner sieht noch weitere Probleme. So kann er einem Flüchtling, der kein Deutsch spricht, keine 15 Euro die Stunde zahlen, weil dieser dies nicht erwirtschaftet und er, sollte er einem Flüchtling 15 Euro die Stunde zahlen, einem gut ausgebildeten Arbeiter noch mehr zahlen müsste.
„Sie verschieben Ihre Idee, dass sich Arbeit lohnen muss, auf die Arbeitgeber. Sie müssen dafür sorgen, dass die Lohnnebenkosten sinken und dass die Steuerlast für die Mitarbeiter sinkt“, so Exner. Habeck sieht das Problem mit den Nebenkosten und wäre froh, wenn die Kosten erstmal nicht steigen würden. Doch er beharrt darauf, dass die 15 Euro Mindestlohn, die die Grünen fordern, nur ein Inflationsausgleich für die letzten Jahre wäre.
Mit Hart aber fair 360 wurde ein Talkshowformat übernommen, das im Gegensatz zu herkömmlichen Talkshowformaten vom Widerspruch lebt. Habeck konnte nicht brillieren, weil ihm Widersprüche in seiner Denkweise und in der Ideologie der Grünen aufgezeigt wurden. Trotz des Widerspruchs ist Habeck bereit, ein zweites Mal in ein solches Format zu gehen. Seine einzige Bitte wäre es, dass es dann noch länger geht, um mehr diskutieren zu können.



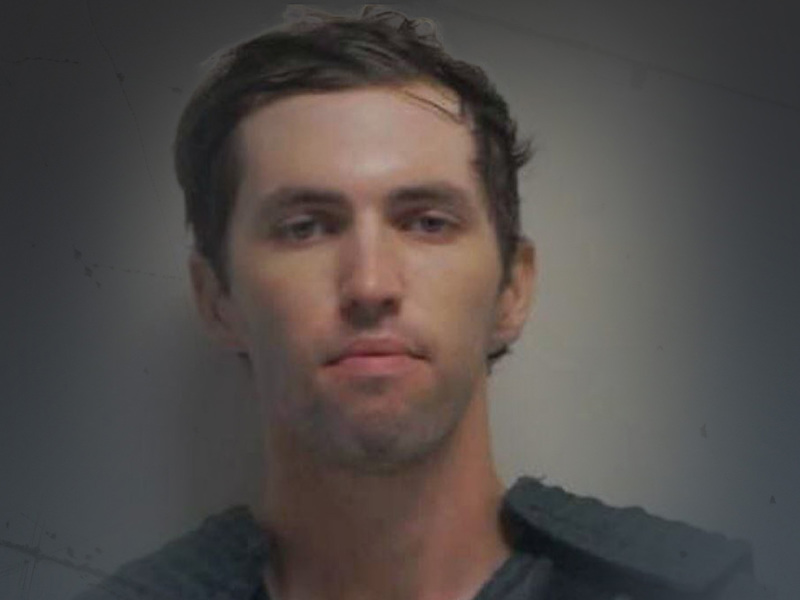






 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























