
Vor dreizehn Jahren öffnete Mario Draghi als damaliger EZB-Präsident die Liquiditätsschleusen, um die Eurozone vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. An den strukturellen Problemen hat sich seither nichts geändert. Wir stehen vor dem nächsten Kapitel der nur grob überpflasterten Schuldenkrise. Zeit für die EZB, den Notfallkoffer bereitzuhalten.
Seit einiger Zeit zeigt sich an den globalen Finanzmärkten ein beunruhigendes Muster: Langlaufende Staatsanleihen geraten unter Abgabedruck – selbst jene der Leitökonomien wie der USA, Japans, Großbritanniens sowie, in besonderem Maße, Frankreichs. In der Folge klettern die Renditen, und mit ihnen steigen die Refinanzierungskosten der ohnehin hoch verschuldeten Nationalstaaten.
Es ist das sogenannte lange Ende der Zinskurve, das Haushaltspolitiker wie Zentralbanken gleichermaßen in Sorge versetzt. Auf den langlaufenden Staatsanleihen der USA, Japans und der Eurozone ruht die Statik der globalen Finanzarchitektur. Banken, staatliche Pensionsfonds und Versicherungssysteme haben unter dem Abverkauf dieses Marktsegments bereits einen immensen Blutzoll entrichtet. Das Gebäude ist sturmreif geschossen – und in Europa kündigt sich die nächste Schuldenkrise an.
Es ist nicht länger zu ignorieren: Die langlaufenden Staatsanleihen, die einst sichere Renditen und – inflationsbereinigt – positive Erträge versprachen, haben erheblich an Vertrauen eingebüßt. Ein Blick auf die politische Krise Frankreichs und den Niedergang Großbritanniens macht zudem deutlich, dass ein Ausweg aus der Schuldenspirale mit stetig wachsenden jährlichen Defiziten und kollabierenden Sozialsystemen in einer alternden, von Migration überforderten europäischen Gesellschaft kaum realistisch erscheint.
Wer nicht per Gesetz zum Erwerb dieser Papiere gezwungen ist, stößt sie ab und flüchtet in vermeintlich sichere Häfen wie Edelmetalle oder Cash, hier bevorzugt in den US-Dollar oder den Schweizer Franken – ein bewährtes Muster, wenn es hart auf hart kommt.
Während die Rendite zehnjähriger Anleihen in Großbritannien mit über 5,7 Prozent am Dienstagnachmittag den höchsten Stand seit 2009 erreichte, spitzt sich die Krise auch in Frankreich in diesen Tagen dramatisch zu. Am 8. September entscheidet eine Vertrauensabstimmung über den Sparhaushalt von Premierminister François Bayrou. Ein Scheitern gilt als vorprogrammiert. Dem Land drohen politisches Chaos und ein bereits angekündigter Generalstreik, der wohl, wie es zur traurigen Tradition dieser fragmentierten, von Migration schwer getroffenen Gesellschaft geworden ist, in schweren Straßenschlachten in den Banlieues münden wird.
Frankreich ist längst zu einem unregierbaren Staatsgebilde geworden, das nun droht, zum Ausgang der nächsten Schuldenkrise in der Eurozone zu werden.
Dunkle Wolken ziehen über Europas Himmel herauf und auch Deutschland wird von diesem Unwetter nicht verschont bleiben. Einst für seine konservative Haushaltspolitik gerühmt, hat das Land mit einem billionenschweren Schuldenprogramm Tür und Tor für schwere Verwerfungen an den Kapitalmärkten geöffnet. Gibt Deutschland seine Kreditwürdigkeit auf, bloß um Zeit und eine flüchtige Lösung für die Krise seiner Sozialkassen zu gewinnen, wird es zum Senkblei der Unionspartner. Die Märkte haben von Beginn der Währungsunion an die Kreditwürdigkeit der Gemeinschaft mit der Deutschlands verwoben.
Keine der Krisen Europas – weder die Überregulierung, noch die Energiekrise oder das Migrationschaos – wurde je wirksam unter Kontrolle gebracht. So steht der Kontinent nun mit offener Flanke vor der nächsten Schuldenkrise.
Die nächste Schuldenkrise dürfte dem Muster ihrer Vorgängerin vor anderthalb Jahrzehnten folgen: Ansteckung folgt auf Ansteckung, Staat um Staat werden die Dominosteine fallen, wenn die Abverkaufswellen am Anleihemarkt jedes Mitglied auf seine Stabilität und Standfestigkeit hin testet und durch ein Stahlbad schickt. Dann entlädt sich, was man im Zusammenspiel mit der EZB über Jahre aufgestaut hat und nicht wahrhaben wollte. Die EU-Europäer haben über ihre Verhältnisse gelebt und sich im Ökorausch und mit offenen Grenzen um ihren Wohlstand gebracht.
Was womöglich in Frankreich seinen Ausgang nimmt, wird über die hochverschuldeten südeuropäischen Staaten schließlich auch Deutschland erreichen. Die Frage lautet: Kann die EZB, wie einst mit ihrem Köfferchen voller Notfallmaßnahmen, die Lage stabilisieren?
Jede Staatsschuldenkrise ist zugleich auch eine Bankenkrise. Denn ein erheblicher Teil der Staatsanleihen liegt in den Bilanzen der Geschäftsbanken und wenn deren Marktwert drastisch verfällt, droht eine gefährliche Überschuldung des gesamten Finanzsektors. Um ein solches Szenario einzudämmen, hat die EZB ein Arsenal an Liquiditäts- und Stabilisierungsmaßnahmen entwickelt, die den Kern ihres Notfallkoffers bilden. Dazu gehören die LTROs (Long-Term Refinancing Operations) und TLTROs (Targeted Longer-Term Refinancing Operations), mit denen Banken über langfristige, zinsgünstige Kredite versorgt werden, um Liquidität zu sichern und die Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte aufrechtzuerhalten.
Hinzu kommt die Emergency Liquidity Assistance (ELA), eine Art Notfallventil für Institute, die akut unter Druck geraten und kurzfristig Liquidität benötigen. Besichert wird diese Hilfe in der Regel durch Staatsanleihen oder andere, wie die EZB es nennt, „hochwertige Aktiva“. Ergänzt wird dieses Instrumentarium durch Forward Guidance und Zinspolitik, mit denen die EZB versucht, Erwartungen zu steuern und Zinsmärkte zu stabilisieren. Oft mit mehr psychologischer als realer Wirkung. Hier zeigt sich eine der zentralen Schwachstellen und logischen Widersprüche der Notenbankpolitik. Ausgerechnet die als „hochwertig“ geltenden Aktiva haben die Krise mitverursacht. Hochgehebelter, praktisch ungedeckter Fiat-Kredit – ohne Gold- oder Energieunterlegung – hat das Finanzsystem in ein Ponzi-artiges Konstrukt verwandelt, das nun unweigerlich eine massive Ausweitung des Kreditvolumens postuliert.
In diesen Kontext gehören auch das gigantische Schuldenprogramm der Bundesregierung wie auch der, geht es nach den Europäern, fortgesetzte Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Stockt die Kreditpumpe, fällt das Kartenhaus zusammen.
Der Hauptfokus der EZB liegt allerdings auf der Stabilisierung der Staatsanleihenmärkte. Dem Bereich, der im Falle einer Krise den schwersten Angriff auf die Finanzarchitektur sehen wird. Längst tief verwoben mit dem Machtzentrum der EU in Brüssel, agiert die Zentralbank quasi als Liquiditätsdepartement und wird, sobald Panik am Anleihenmarkt ausbricht, damit beginnen, Zinsen zu manipulieren und den Markt zu räumen, wie wir es vor anderthalb Jahrzehnten erlebt haben.
Zu den Notfallprogrammen zählen das Public Sector Purchase Programme (PSPP), mit dem Staatsanleihen aufgekauft und die Marktliquidität erhöht wird, sowie die Outright Monetary Transactions (OMT), die bei extremen Finanzierungskosten greifen, jedoch nur, wenn die betroffenen Länder Reformverpflichtungen eingehen.
Neu hinzugekommen ist das Transmission Protection Instrument (TPI). Es erlaubt der EZB, Staatsanleihen gezielt zu kaufen, um übermäßige Zinsunterschiede zwischen Mitgliedstaaten zu verringern und die geldpolitische Transmission sicherzustellen. Dieses Instrument operiert weitestgehend im Klandestinen. Die Interventionen werden am Markt nicht immer sofort wahrgenommen, die Käufe können schrittweise erfolgen, vielleicht auch über verdeckte Akteure, die auf Rechnung der EZB operieren, um Panik am Markt zu vermeiden.
Die Politik der Europäischen Zentralbank lässt sich relativ simpel auf den Punkt bringen. In dieser Phase vor dem Kollaps der Staatsschuldenberge besteht ihre Aufgabe darin, die gesamte Zinskurve der Staatsanleihen nach unten zu manipulieren, um die Illusion zu wahren, die Staatsschulden seien unter Kontrolle – und zugleich private Investoren nicht zu verunsichern. Dass die EZB längst dauerhaft am Markt operiert, zeigt sich an den Zinskorridoren, die die Renditen der Staatsanleihen seit geraumer Zeit konsequent einhalten.
Wir kennen das aus der europäischen Politik. Transparenz gibt es nicht. Hinterzimmergeschäfte zwischen der EZB und den großen Kapitalsammelstellen sind hier an der Tagesordnung. Märkte werden aktiv gemanaged, manipuliert. Von einem freiem Markt und der disziplinierenden Kraft steigender Zinsen (Bond Vigilantes) ist schon lange keine Rede mehr.
Letztlich spielt es keine Rolle, wie die einzelnen Instrumente der EZB benannt werden. Im Kern geht es immer darum, kurzfristige Marktschwankungen auszugleichen, und der Politik durch Zinsdeckelung immer neue Handlungsspielräume für einen stetig wachsenden Staat zu verschaffen. Die EZB selbst ist zu einem Krebsgeschwür im Gefüge des Euro degeneriert. Marktwirtschaftliche Reformen sind ausgeschlossen, solange die Politik Gewissheit hat, dass sie am Ende auf den Backstop der Zentralbank zählen kann – sei es zur Finanzierung der grünen Klimaagenda, des Aufbaus eines Kriegssektors oder anderer fragwürdiger Projekte.
Ziel der EU-Kommission und der EZB ist es, langfristig einen einheitlichen Schuldenmechanismus zu etablieren, die nationalen Schulden unter dem Schirm der Kommission zu konsolidieren und die EZB als Liquiditätspool zur Marktstabilisierung zu integrieren. Europa steuert so auf einen zentralisierten Sozialismus zu und die EZB zählt zu den Protagonisten dieser Misere.
Kommt es zu einer systemischen Krise, trifft es in diesem Falle auch die tragenden Säulen der Eurozone und der EU. Frankreich, Italien und Deutschland werden in den Sog geraten. Es wäre töricht zu glauben, dass man die Lage allein mit der Kreditpumpe der EZB und mit kurzfristigen Liquiditätsinjektionen stabilisieren könnte.




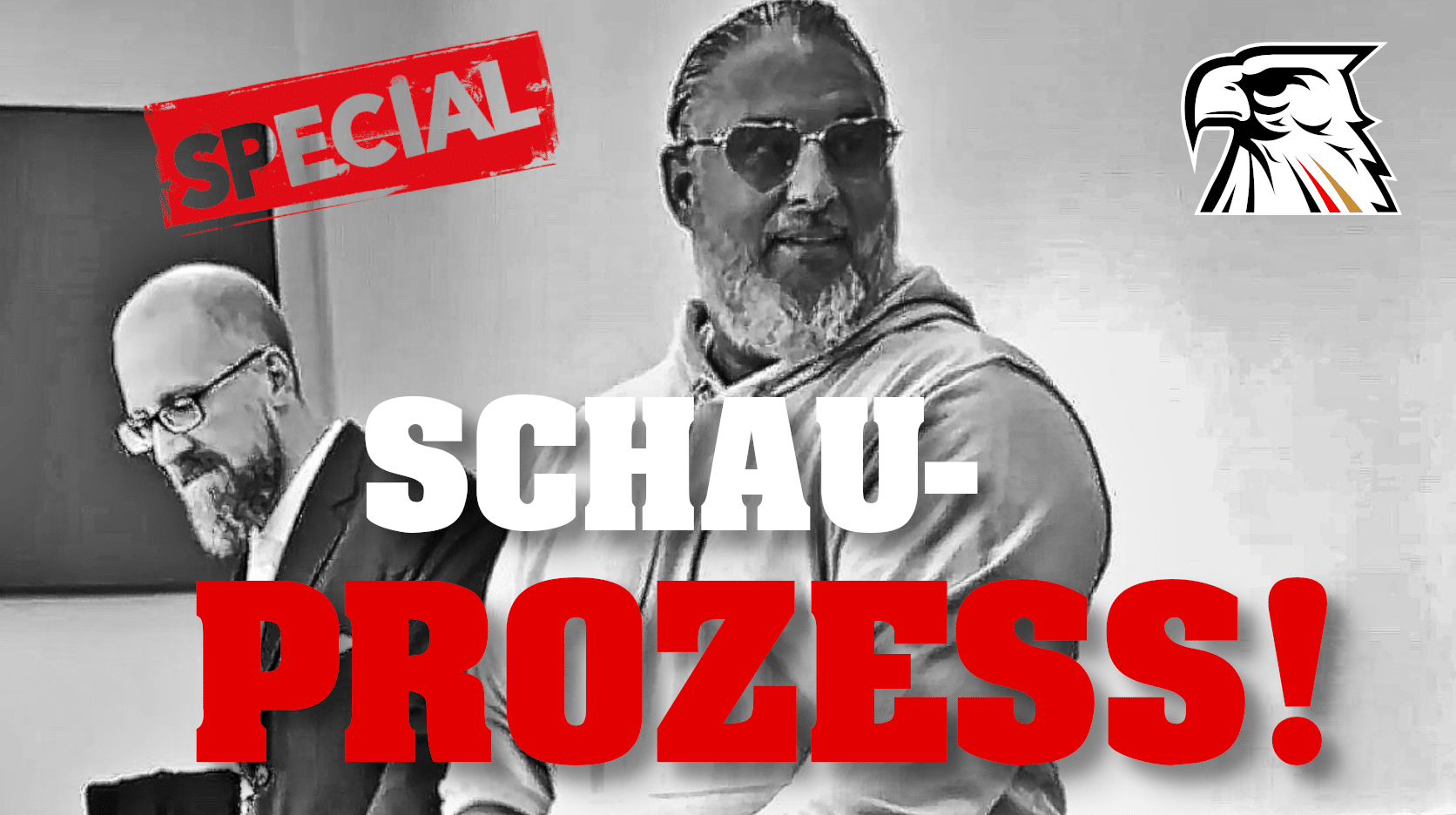




 PUTINS KRIEG: Donnerschlag an Front! Russland meldet Durchbruch! Truppen in Kupjansk | WELT STREAM
PUTINS KRIEG: Donnerschlag an Front! Russland meldet Durchbruch! Truppen in Kupjansk | WELT STREAM






























