
Nach monatelangem Hin und Her steht der Deal zwischen den USA und Europa, das hierbei deutlich schlechter wegkommt. NIUS erklärt, was dieser Zoll-Deal für Deutschland bedeutet – und was zu erwarten ist.
1. Wer hat wo verhandelt ?Auf europäischer Seite führte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Gespräche. Sie wurde von einer kleinen Delegation aus Handels- und Energieexperten begleitet. Auf amerikanischer Seite trat Donald Trump persönlich als Chefverhandler auf, flankiert von seinem Handelsminister, seinem Energieminister und engen Beratern. Die Symbolik war klar: Trump wollte den Deal als seinen persönlichen Erfolg verkaufen. Das Treffen fand am 27. Juli 2025 auf Donald Trumps Golfresort in Turnberry, Schottland statt. Er besitzt zwei luxuriöse Golfanlagen in dem Land, in dem er Wurzeln hat. Trumps Mutter Mary Anne MacLeod wuchs auf der schottischen Insel Lewis auf. Dass sich die EU-Spitze auf dieses Terrain begab, wurde bereits im Vorfeld kritisiert: Es wirke, als lasse man sich vom Ort des Deals her auf ein Spiel nach Trumps Regeln ein.
2. Wie wurde verhandelt?Die Gespräche galten als zäh, wurden aber bewusst informell inszeniert. Trump setzte auf maximalen Druck: Noch wenige Tage vor dem Treffen hatte er mit Strafzöllen von bis zu 30 Prozent gedroht. Die EU trat aus einer defensiven Position heraus auf und versuchte, diese Eskalation zu verhindern. Am Ende wurde in einem kleinen Kreis direkt verhandelt und dann ein gemeinsames Statement verlesen.
Die EU zieht gegen Trump offensichtlich den Kürzeren.
3. Was ist das Ergebnis des Deals?Die USA setzen dauerhaft 15 Prozent Zoll auf europäische Waren an (zuvor 5 Prozent), verzichten aber auf die zuvor angedrohten 30 Prozent. Im Gegenzug verpflichtet sich die EU zu Importen von US-Energie, Rüstung und Halbleitern im Umfang von 750 Milliarden Dollar sowie Investitionen in US-Standorte im Volumen von 600 Milliarden. Gegenzölle wird es von Seiten der EU nicht geben.
4. Was bedeutet das für den deutschen Steuerzahler? Die hohen Import- und Investitionsverpflichtungen der EU im Rahmen des Deals – insbesondere in den Bereichen Energie, Rüstung und Halbleiter – werden zu einem großen Teil aus nationalen Haushalten finanziert. Für Deutschland heißt das: Der Steuerzahler trägt indirekt die Last dieser politischen Einigung. Ob durch höhere Energiepreise, durch Subventionen für Unternehmen oder durch direkte Beiträge zum EU-Haushalt – die finanziellen Auswirkungen des Abkommens werden mittel- bis langfristig spürbar sein. Besonders kritisch sehen Ökonomen die Tatsache, dass es sich nicht um wirtschaftlich motivierte Investitionen handelt, sondern um politisch erzwungene Verpflichtungen, die kaum demokratisch legitimiert wurden. Sollte der Deal zusätzlich zu wirtschaftlichen Verwerfungen führen, etwa durch Arbeitsplatzverluste in der exportorientierten Industrie, drohen dem Staat weitere Ausgaben durch Arbeitsmarktprogramme oder Unternehmenshilfen.
5. Warum heißt es, dass der Deal „Appeasement“ sei?Viele Beobachter werfen der EU vor, sie habe sich Trump de facto gebeugt. Die milliardenschweren Kaufversprechen und der Verzicht auf Gegenzölle bei gleichzeitiger Zollanhebung durch die USA lassen den Deal wie einseitige Kapitulation erscheinen.
Julian Hinz, Leiter des Forschungszentrums Handelspolitik am Kiel Institut für Weltwirtschaft, sagt gegenüber der Zeit: „Das ist kein guter Deal, das ist Appeasement! Wir machen hier etwas, das unsere Kosten kurzfristig minimiert, weil wir dadurch einen Handelskrieg abwenden. Aber langfristig wird das sehr, sehr teuer werden, weil wir damit die Regeln des multilateralen Systems verlassen. Und das ist maßgeblich für unseren Wohlstand in Deutschland und Europa gewesen.“
6. Um welche Summen geht es?Insgesamt verpflichtet sich die EU zu Transaktionen im Volumen von rund 1,35 Billionen US-Dollar: 750 Milliarden für strategische Einkäufe (Energie, Halbleiter, Verteidigung), 600 Milliarden für Investitionen in US-Standorte. Zudem entgehen den USA zusätzliche Gegenzölle im zweistelligen Milliardenbereich.
7. Was ist die Vorgeschichte?Schon in Trumps erster Amtszeit drohte mehrfach ein Handelskrieg mit der EU. Unter Biden herrschte ein Waffenstillstand, doch Trump kehrte 2025 mit einem deutlich protektionistischen Kurs zurück. Ab Frühjahr 2025 überzog er europäische Waren mit Strafzöllen, um die EU zu einem umfassenden Handelsabkommen zu zwingen.
Seit Mitte Februar droht Trump der EU mit Zöllen.
8. Warum ist der Deal wichtig?Der Deal verhindert kurzfristig eine Eskalation im transatlantischen Handel und schafft neue Rahmenbedingungen für den europäisch-amerikanischen Wirtschaftsaustausch. Vor allem aber zementiert er die politische Vormachtstellung der USA in strategischen Bereichen wie Energie und Rüstung.
9. Was bedeutet das für die EU-Mitgliedstaaten?Die Verpflichtungen aus dem Deal müssen nun von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Das betrifft sowohl Importe (Flüssiggas, Waffen) als auch Investitionen. Staaten wie Deutschland oder Frankreich dürften den Hauptanteil schultern. Kleinere Länder fürchten eine Überforderung.
10. Wer profitiert wirtschaftlich vom Deal – und wer verliert?Die amerikanische Rüstungs- und Energiebranche profitiert massiv: Sie erhalten garantierte Aufträge und Marktanteile. Auch Halbleiterhersteller aus den USA dürfen sich freuen. Verlierer sind vor allem europäische Produzenten in der Stahl-, Chemie- und Automobilbranche, die unter den neuen Zöllen leiden. Besonders hart trifft es exportorientierte Mittelständler.
Bremens Bürgermeister kommentierte auf X: „Kein gutes Ergebnis aus Bremer Sicht und ein fatales Signal europäischer Schwäche: Der ‚Deal‘ lässt die Stahlindustrie im Regen stehen und nützt vor allem deutschen Autoherstellern, die in den USA produzieren und nach Europa exportieren. 1:0 für Trump.“ Dann polterte er regelrecht: „Bitter zu sehen, wie die EU dabei ist, vor Trump den Schwanz einzuziehen. Keine Ehre im Leib. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Jede Politik des Appeasement ist zum Scheitern verurteilt, weil sie die andere Seite ermutigt immer weiter zu machen.“
11. Wie sicher ist der Deal rechtlich – und wie lange gilt er?Der Deal ist bislang ein politisches Abkommen, kein völkerrechtlich bindender Vertrag. Er muss noch vom EU-Rat und dem Europaparlament bestätigt werden. Auch die Mitgliedstaaten haben Mitspracherecht. In den USA hängt vieles vom Kongress ab. Wie lange der Deal gilt, ist offen – es gibt keine klare Laufzeit.
12. Welche Kritik gibt es an dem Deal – auch aus der EU selbst?Aus Frankreich und Italien kommt scharfe Kritik: Man habe sich Trump unterworfen. Das Europaparlament bemängelt mangelnde Transparenz und fehlende demokratische Kontrolle. Auch in Deutschland mehren sich kritische Stimmen aus der Wirtschaft, etwa vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) oder mittelständischen Verbänden.
Auf die Frage, ob die EU sich überhaupt auf den Deal hätte einlassen sollen, sagt Julian Hinz vom Kiel Institut für Weltwirtschaft: „Es hätte deutlich klügere Strategien gegeben. Zum Beispiel, indem man sich mit ähnlich getroffenen Ländern zusammengetan und gemeinsam reagiert hätte. Dann hätte man eine breite Front gehabt, eine Koalition, und Druck auf die Amerikaner ausüben können.“
NIUS-Reporter Julius Böhm fragt ironisch: „Der Zoll-Deal ist doch gar nicht so schlecht: Die EU steckt 1,3 Billionen Dollar in die USA und im Gegenzug gibt’s 15 Prozent Zölle. Was habt ihr eigentlich?!?“
Der Wirtschaftsminister Bayerns, Hubert Aiwanger, fordert Konsequenzen, insbesondere den Green Deal betreffend:
„Jetzt müssen unverzüglich Unternehmenssteuern und Energiepreise in Deutschland runter und Berlin muss in Brüssel alles blockieren, was von dort an wirtschaftsfeindlichen Aktionen kommt. Verbrennerverbot und drohende Strafzahlungen für nicht erfüllte Elektroautoquoten müssen weg, genauso wie die Nachhaltigkeitsberichte, das Lieferkettengesetz und das Naturwiederherstellungsgesetz. Das Bürgergeld muss reformiert und das geplante Bundestariftreuegesetz gestoppt werden. Wir können uns diese hausgemachten Probleme des Green Deal nicht mehr leisten, wenn wir schon im Deal mit Trump nur zweiter Sieger sind.“
Stimmen, die sich positiv äußern, gibt es eigentlich kaum – abgesehen von der Politik. Auf Anfrage von NIUS zeigte sich die Union zufrieden mit dem Ergebnis: Europas Selbstbewusstsein habe sich ausgezahlt. Weiter heißt es: „Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Friedrich Merz haben bewiesen, dass man mit gutem Draht ins Weiße Haus mehr erreicht als mit lautstarken Beschimpfungen des US-Präsidenten.“ Die nun vereinbarten Zölle von 15 Prozent lägen deutlich unter Trumps ursprünglichen Drohungen. „Das gibt ein Aufatmen gerade für die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie – auch wenn es für die Stahl- und Aluminiumbranche weiter ernst bleibt.“
13. Welche Rolle spielt China im Hintergrund dieses Deals?Trump will mit dem Deal nicht nur Europa wirtschaftlich disziplinieren, sondern auch seine geopolitische Strategie stärken: Die EU soll sich klar vom chinesischen Markt ab- und dem US-Wirtschaftsraum zuwenden. Der Deal ist also Teil einer größeren Blockbildung gegen China. Am Donnerstag war von der Leyen in Peking, wo sie jedoch auf taube Ohren stieß. Zugeständnisse konnte sie China nicht abringen. Zwischen beiden Weltmärkten gerät Europa zunehmend ins Hintertreffen, wie sich anhand der schlechten Verhandlungsposition zeigt.
Die amerikanische Wirtschaft ist durch Trump deutlich unabhängiger von China geworden.
14. Was bedeutet der Deal für die deutsche Wirtschaft?Deutschland ist besonders betroffen: Als exportstarke Industrienation mit einer dominanten Automobilbranche zählt es zu den größten Verlierern der neuen US-Zölle. Deutsche Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen sind stark vom US-Markt abhängig und werden durch die 15-Prozent-Zölle empfindlich getroffen. Hinzu kommt, dass Deutschland voraussichtlich den größten Anteil an den Import- und Investitionsverpflichtungen der EU tragen muss – insbesondere bei Flüssiggas, Rüstungsgütern und Halbleitern. Für energieintensive Industrien wie die Chemiebranche, etwa BASF oder Covestro, verschärft sich die Lage: Höhere Energiepreise durch US-LNG-Importe könnten ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter schwächen.
Auch der deutsche Mittelstand, der oft global vernetzt agiert, sieht sich zunehmenden Handelshemmnissen gegenüber. Der Deal könnte zudem die strategische Unabhängigkeit Deutschlands im Bereich Energie- und Rüstungspolitik weiter einschränken. Als exportstarkes Land mit großer Autoindustrie leidet es unter den neuen US-Zöllen. Gleichzeitig muss es einen erheblichen Teil der Importverpflichtungen tragen. Energieintensive Konzerne wie BASF sehen im US-Deal neue Risiken für ihre Wettbewerbsfähigkeit.
15. Wird es einen Handelskrieg trotzdem noch geben?Der Deal verhindert vorerst einen Handelskrieg, löst die strukturellen Konflikte aber nicht. Viele Details sind ungeklärt, die EU agierte aus einer Position der Schwäche. Sollte Trump weitere Forderungen stellen oder den Deal als Hebel nutzen, könnte die Eskalation jederzeit zurückkehren.
Der Ökonom David Stelter: „Alle die jetzt rufen: ‚es wird den USA schaden!‘ verkennen – denke ich – die grundlegende Stossrichtung. Es geht um eine neue Weltordnung und da könnten die Kosten der Zölle am Ende mehr bei der EU als den US Konsumenten liegen.“
Eine neue Weltordnung, die die EU kalt erwischt.
Lesen Sie auch:








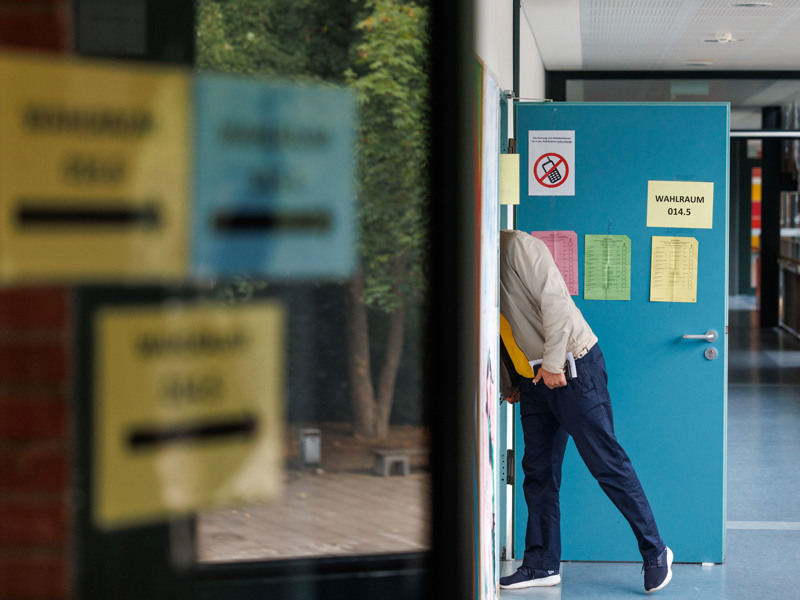
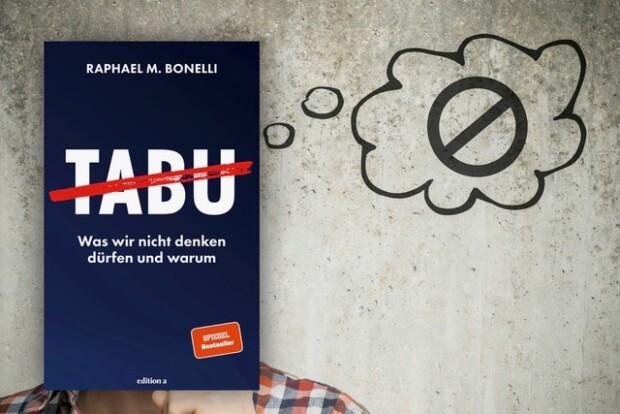
 DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE
DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE






























