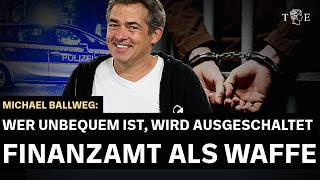Ein antisemitischer Zwischenfall überschattete am Wochenende die Eröffnungsfeier des Eurovision Song Contest (ESC) in Basel. Die israelische Sängerin, eine Überlebende des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023, wurde am Rande der Veranstaltung von einem pro-palästinensischen Demonstranten mit einer symbolischen Tötungsgeste bedroht und bespuckt.
Der Vorfall ereignete sich während der Eröffnungsparade in der Innenstadt von Basel. Auf Videoaufnahmen, die auf der Plattform X (ehemals Twitter) unter anderem vom offiziellen Account des Staates Israel veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie die israelische Delegation von mehreren pro-palästinensischen Demonstranten begleitet, bedrängt und belästigt wird. Zu sehen ist auch, wie sich ein Mann mit palästinensischer Flagge demonstrativ mit der Hand über den Hals fährt – eine Geste, die international als Morddrohung verstanden wird. Laut israelischen Medienberichten spuckte der Mann zudem mehrfach in Richtung der israelischen Delegation.
Click here to display content from Twitter. Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von X.
Inhalt von X immer anzeigen
Bei dem Opfer des Vorfalls, der 24-jährigen Yuval Raphael, handelt es sich um eine Überlebende des Massakers, bei dem Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023 während des Musikfestivals „Nova“ über 1.200 Menschen ermordet haben. Nachdem sie vor weniger als zwei Jahren denkbar knapp mit dem Leben davongekommen ist, musste sie nun inmitten Europas, auf Schweizer Boden, zum zweiten Mal erleben, wie man ihr nach dem Leben trachtet – dieses Mal (noch) mit symbolischen Tötungsgesten. Ungeachtet dieses unverhohlenen Antisemitismus und aller Einschüchterungsversuche vertritt sie mit dem Lied „New Day Will Rise“ nun Israel beim ESC, allerdings unter hohen Sicherheitsvorkehrungen.
Vor dem Hintergrund des gestrigen Vorfalls ist die Sorge um die Sicherheit der israelischen Delegation erneut in den Fokus gerückt. Dass eine Überlebende eines Terroranschlags auf offener Bühne Ziel antisemitischer Drohgebärden wird, wirft ein düsteres Licht auf das Umfeld des diesjährigen ESC – ein Wettbewerb, der eigentlich für Völkerverständigung stehen soll.
Gleichwohl ist die öffentliche Anfeindung in Basel ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits beim letztjährigen Songcontest, der im schwedischen Malmö ausgetragen wurde, kam es zu einer Reihe antiisraelischer Protestaktionen, Boykottaufrufen und Bedrohungen.
Auch im Vorfeld des diesjährigen Wettbewerbs haben kürzlich massive Proteste für Aufsehen gesorgt. Insgesamt 72 ehemalige ESC-Teilnehmer – darunter auch der Vorjahressieger Nemo – unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie den Ausschluss Israels forderten. Als Begründung nannten sie neben der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen, die sie als „Völkermord“ bezeichneten, auch dessen „jahrzehntelanges Regime der Apartheid“. Zudem wurde Parallelen zu Russland gezogen, das seit dem Angriff auf die Ukraine von der Teilnahme am ESC ausgeschlossen ist.
Auch Nemo, der sich als non-binär identifizierende, schweizerische ESC-Sieger von 2024, hat sich unlängst gegen eine Teilnahme Israels ausgesprochen. Er begründete dies mit einem vermeintlichen Widerspruch zwischen dem Leitbild des Wettbewerbs von Frieden und Menschenrechten und dem israelischen Vorgehen im Gaza-Krieg.
Die Europäische Rundfunkunion (EBU), die den ESC organisiert, verteidigte unterdessen die Teilnahme Israels. Der israelische öffentlich-rechtliche Sender KAN, der für die Organisation der israelischen ESC-Delegation verantwortlich ist, erfülle die Anforderungen an Unabhängigkeit und journalistische Standards, hieß es in einer Stellungnahme. Die EBU betonte darin, dass nicht Staaten, sondern Rundfunkanstalten Mitglied seien und am Wettbewerb teilnehmen.
Die Sicherheitslage rund um den ESC bleibt nichtsdestotrotz angespannt – insbesondere für israelische Fans. Vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse sah sich etwa der israelische Sicherheitsrat dazu gezwungen, eigene Staatsbürger dazu aufzurufen, bei Reisen in die Schweiz zum Zwecke des Selbstschutzes auf das Tragen israelischer Symbole zu verzichten und Aufenthaltsorte nicht öffentlich zu machen.










 BEBEN IM BUNDESTAG: Spahns Versäumnis bei Richterwahl wird zur Blamage für gesamte Union | STREAM
BEBEN IM BUNDESTAG: Spahns Versäumnis bei Richterwahl wird zur Blamage für gesamte Union | STREAM