
Über viele Jahre galt der Süden Deutschlands als wirtschaftlicher Motor, doch nun erleben Bayern und Baden-Württemberg dramatische Rückschläge auf dem Arbeitsmarkt.
Während Bayern einen Anstieg der Arbeitslosigkeit von 12,5 Prozent zum Vorjahr verzeichnet, liegt Baden-Württemberg mit 9,8 Prozent nur knapp dahinter. Trotz des immer noch unterdurchschnittlichen Niveaus der Arbeitslosigkeit zeigen die aktuellen Entwicklungen deutlich, dass der Abstieg des wirtschaftlichen Kerns Deutschlands begonnen hat.
In den letzten 12 Monaten ist die Anzahl der Arbeitslosen in Deutschland um 6,8 Prozent gestiegen. An der Spitze standen dabei die südlichen Länder Bayern und Baden-Württemberg.
In beiden Bundesländern ist die Arbeitslosigkeit weiterhin im bundesweiten Vergleich gering. In Bayern beträgt sie 3,8 Prozent und in Baden-Württemberg 4,3 Prozent, während sie bundesweit bei 6,0 Prozent liegt. Jedoch steigt sie vor allem im industriell starken Süden des Landes. Die weiterhin höchste Arbeitslosigkeit besteht in Bremen mit 11,1 Prozent.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den gewaltigen Stellenstreichungen wider, die in den letzten zwölf Monaten die Region erschütterten. Viele der bedeutendsten Unternehmen im Süden Deutschlands müssen sich umstrukturieren oder angesichts finanzieller Herausforderungen auf den Stellenabbau zurückgreifen.
Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen hat angekündigt, bis zu 14.000 Stellen abzubauen. Auch Bosch plant, tausende Arbeitsplätze zu streichen. Insgesamt stehen bis zu 7.000 Stellen zur Disposition. In der Kernsparte Automobiltechnik fast die Hälfte davon. Die Bosch Tochtergesellschaft Rexroth will 240 Stellen streichen, davon den Großteil in Lohr.
Der ZF-Standort in Friedrichshafen: Bis zu 14.000 Stellen sollen gestrichen werden.
Der Pressenhersteller Schuler aus Göppingen wird voraussichtlich 500 Stellen streichen, aufgrund der Krise in der Automobilindustrie.
Der Softwaregigant SAP aus Walldorf hat den Abbau von 9.000 bis 10.000 Arbeitsplätzen angekündigt, und Chiphersteller Infineon plant eine neue Fabrik in Malaysia – nach der Ankündigung eine mittlere dreistellige Anzahl an Arbeitsplätzen, unter anderem in Regensburg, zu streichen.
Dies sind keine Einzelfälle, sondern Teil eines größeren Trends, der zeigt, dass auch traditionsreiche Unternehmen in dieser Region zunehmend in Bedrängnis geraten.
Weitere Beispiele für die Stellenstreichungen sind Thyssenkrupp aus Essen, mit 3.500 Stellenstreichungen, und der Haushaltsgerätehersteller Miele aus Gütersloh, der 1.300 Arbeitsplätze abbaut. Volkswagen aus Niedersachsen wird möglicherweise bis zu 30.000 Stellen in Deutschland kürzen, wie das Manager Magazin zuletzt berichtete.
Proteste gegen den geplanten Stellenabbau: VW-Markenchef Thomas Schäfer Anfang September im Werk Zwickau.
Bereits im letzten Jahr hat BASF angekündigt 2.600 Stellen, hauptsächlich in Europa und insbesondere am Standort Ludwigshafen, dem größten integrierten Chemiekomplex der Welt, zu streichen.
Auch Tesla, das in Brandenburg ein Werk betreibt, hat 400 Stellen gestrichen. Die Deutsche Bank aus Frankfurt am Main streicht 3.500 Arbeitsplätze. Selbst in der Getränkeindustrie gibt es Einschnitte: Coca-Cola plant die Schließung von fünf deutschen Niederlassungen, was den Verlust von rund 500 Arbeitsplätzen zur Folge haben könnte.
Der Rückgang der Beschäftigungsmöglichkeiten insbesondere im (industriellen) Süden Deutschlands ist eine deutliche Warnung. Die politischen Rahmenbedingungen und die Unsicherheit in wichtigen Industrien wie der Automobilproduktion und der Chemieindustrie haben eine massive Deindustrialisierung in Gang gesetzt.
Die wirtschaftlichen Vorzeigeregionen Bayern und Baden-Württemberg sind von dieser Entwicklung aktuell besonders stark betroffen. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) rechnet in den nächsten Jahren mit einem starken Stellenabbau in der bayrischen Autoindustrie. Bis 2040 dürften 106.000 Arbeitsplätze bei Autobauern, Zulieferern, Kfz-Werkstätten und im Autohandel wegfallen.
Die Konsequenzen sind klar: Wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden, könnten sich die wirtschaftlichen Strukturen in diesen Bundesländern langfristig dramatisch verändern.
Lesen Sie auch:Deutschlands Deindustrialisierung: Die gefährliche Abwanderung der BASF nach China


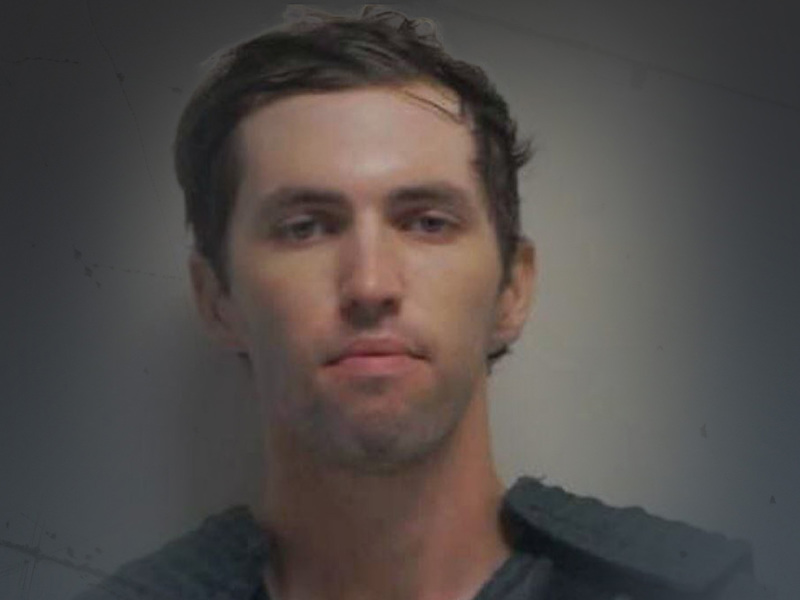







 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























