
Unser Nachbarland Frankreich gilt als politisch festgefahren und reformunfähig. Einschnitte in die Sozialkassen, Nullrunden bei den Renten oder Kürzungen im Bereich der Krankenversicherung endeten in der Vergangenheit in der Regel mit Generalstreiks, Autobahnblockaden oder Krawallen in den Vorstädten. Medial wird dieses Verhalten als Charakterstärke interpretiert: ein Volk, das sich dem geizigen Staat in den Weg stellt und für seine Rechte kämpft.
Was in der Berichterstattung verschwiegen wird, ist, dass sich Frankreich mit einer Staatsquote von 57 Prozent den mit Abstand größten Wohlfahrtsstaat der Europäischen Union leistet. Möglicherweise sind sie in Paris sogar Weltmeister der Umverteilung unter den Demokratien dieser Welt. Diese wesenhaft sozialistische Politik hat ihren Preis und sie hat das Land sowohl fiskalisch als auch ökonomisch in eine Sackgasse manövriert.
Die Staatsverschuldung liegt derzeit bei etwa 114 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und die Regierung von Premierminister François Bayrou plant eine Neuverschuldung im laufenden Jahr von 5,4 Prozent. Diese Zahlen weichen in einem Maße von den verblichenen Maastricht-Kriterien ab, dass es einem schwindelt. Verständlich, dass niemand in der EU mehr an die einst feierlich verkündeten Regeln zur Disziplinierung der Politik erinnert werden will.
Man kann es nicht mehr länger kaschieren: Die Politik mit dem Füllhorn materialisiert sich nun auch an den Anleihenmärkten. Zinsen französischer Staatsanleihen haben, wie allgemein zu beobachten, die Richtung gewechselt und sind in den vergangenen 12 Monaten bei den 10-jährigen Anleihen um 30 Basispunkte auf 3,3 Prozent gestiegen. Für den Staatskämmerer bedeutet das einen Anstieg der Zinskosten auf mindestens 67 Milliarden im laufenden Jahr – 16 Milliarden mehr als noch im Vorjahr. Der Handlungsspielraum der Regierung schrumpft zusammen wie Eis in der Sommersonne der Côte d’Azur.
Dennoch ist es merklich still geworden um den französischen Staatshaushalt. Das Sommerloch hat die Debatte und die zum Bersten angespannte fiskalische Situation sprichwörtlich geschluckt – seit Bayrous Reformpaket Mitte Juli ist das Thema aus den Medien verschwunden. Dass Staatshaushalte wie der Frankreichs, Spaniens oder Italiens nicht längst kollabiert sind, ist ausschließlich der Europäischen Zentralbank zu danken. Diese steht seit der großen Staatsschuldenkrise vor eineinhalb Jahrzehnten Gewehr bei Fuß, wenn es darum geht, drohendes Ungemach am Anleihenmarkt durch massive Interventionen zu ersticken.
Abgesehen von wenigen Ausnahmen wie Luxemburg wäre wohl nicht ein einziger der größeren europäischen Staaten aus eigener Kraft in der Lage, eine heraufziehende Staatsschuldenkrise abzuwenden. Im Grunde ist es für Reformen bereits zu spät.
Jede drastische Kürzung bei den Staatsausgaben würde die an das süße Gift aus Subventionen, Billigkredit und Staatsinterventionismus gewöhnten Ökonomien zusammensacken lassen und eine schwere gesellschaftliche Krise mit Massenarbeitslosigkeit auslösen. Stehen wir wieder an demselben Punkt, an dem Europa bereits Ende der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts angelangt war?
Immerhin scheint es so, als habe man in Paris die Dringlichkeit einer Haushaltskonsolidierung sowie die Bedeutung der nationalen Politik für das europäischen Gesamtgefüge erkannt. Trotz des politischen Patts präsentierte die Regierung von Premierminister Bayrou vor drei Wochen das nächste Konsolidierungspaket. 44 Milliarden Euro an Staatsausgaben will man im kommenden Jahr einsparen. Das entspricht etwa 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
Das alles bietet dennoch kaum Anlass zu übermäßiger Begeisterung, korrigiert aber immerhin das Netto-Defizit des Staates, sollte die Wirtschaft nicht weiter abstürzen, auf etwa 4,6 Prozent. IIm Jahr 2029 plant die Regierung, wenigstens dieses Kriterium der Maastricht-Regeln einzuhalten und das Defizit auf unter drei Prozent gemessen am BIP zu reduzieren.
Bedenkt man, dass Budgetplanungen in Frankreich seit geraumer Zeit bereits obsolet waren, als sie dem Parlament von der jeweiligen Regierung vorgelegt wurden, besteht wenig Grund zur Hoffnung, dass es in diesem Falle anders ausginge. Stets standen am Ende der Haushaltsdebatten höhere Schulden, um den sozialen Frieden im Land zu wahren. Europäische Politik beschränkt sich inzwischen auf Maßnahmen zur Schmerzvermeidung. Notwendige ökonomische Bereinigungsprozesse wie auch die Neuausrichtung privatwirtschaftlicher Investitionen werden im Offensivmodus der Fiskalpolitik systematisch unterdrückt.
Flankiert werden soll das Konsolidierungspaket durch die Streichung zweier Feiertage. Neben dem bislang freien Ostermontag soll ausgerechnet der 8. Mai, der Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkrieges und des Sieges über Nazi-Deutschland, gestrichen werden.
Der Versuch der Regierung, die schwächelnde Produktivität der französischen Wirtschaft ein wenig zu stützen, ist verständlich. Doch dürften viele patriotische Franzosen die Streichung des Gedenktages als offene Provokation auffassen. In diesem Modus gewinnt man die Bevölkerung ganz bestimmt nicht für den notwendigen Konsolidierungsprozess der Staatsfinanzen.
Ob es dem Regierungschef gelingen wird, den öffentlichen Druck mit diesem Schritt zu reduzieren, ist fraglich. Selbst kleinste Korrekturen des überbordenden Sozialwesens scheiterten stets am gut organisierten öffentlichen Widerstand von politischen Interessengruppen, Gewerkschaften und Sozialverbänden.
Ähnlich wie im Falle Deutschlands spielt sich auch in Frankreich die ungleich extreme Haushaltskrise vor dem Hintergrund einer anhaltenden Rezession ab. Neben der schwachen Verbraucherstimmung und des rückläufigen Einzelhandelsgeschäfts ist es lediglich der Tourismus, der der konsumorientierten französischen Ökonomie ein wenig Stabilität verleiht. Um sechs Prozent soll der Sektor in diesem Jahr wachsen, während es in Deutschland auch hier bergab geht.
Der Index, der die Aktivität im Gewerbe misst, liegt seit geraumer Zeit unter der Wachstumsschwelle von 50 bei etwa 48 Punkten. Auch die Bauproduktion mit einem Indexwert von 43 weist auf eine tiefe Rezession der französischen Wirtschaft hin.
Wie gesagt, es ist Sommerloch. Und das bietet eine gute Gelegenheit, dieses lästige Thema beiseite zu schieben und sich medial auf die Haushaltskrise in den Vereinigten Staaten zu fokussieren, um von den eigenen Problemen abzulenken. Die größte Angst in Brüssel bleibt, dass sich eine französische Schuldenkrise am Anleihenmarkt psychologisch manifestiert und das ganze Schuldenkartenhaus der EU zum Einsturz bringt.
Die Rezession dürfte sich derweil über die Sommermonate nicht zuletzt wegen des Handelskriegs mit den USA weiter vertiefen. Wir müssen also davon ausgehen, dass das Thema der französischen Haushaltskrise, die sich sehr schnell in eine europäische Krise übersetzen kann, bereits in wenigen Wochen wieder die Schlagzeilen dominieren wird. Dann werden wir sehen, ob es der französischen Regierung gelungen ist, den Konsolidierungsprozess aufrechtzuerhalten, oder ob uns ein heißer Herbst in Paris und ein europäisches Schuldendrama bevorstehen.



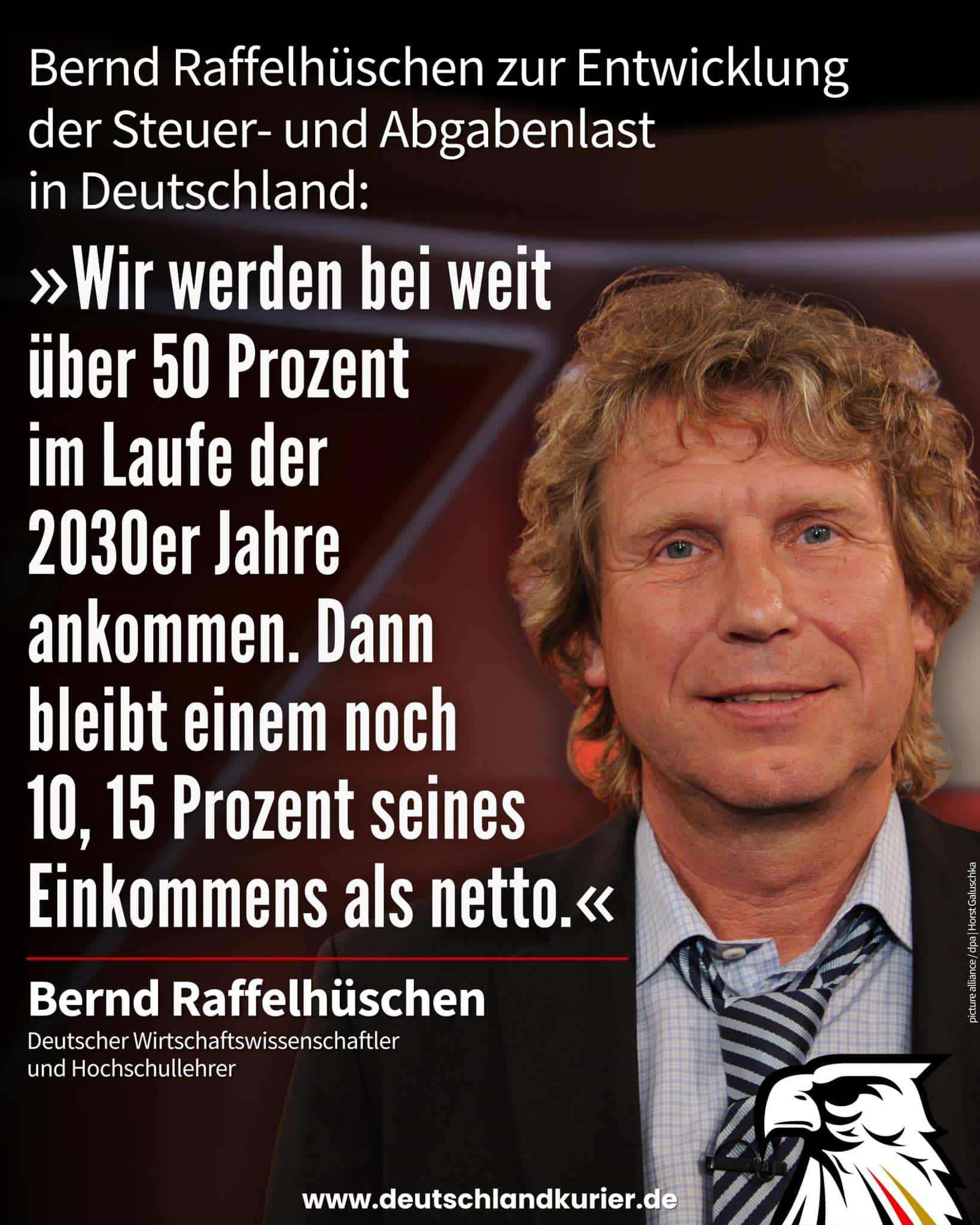





 DEUTSCHLAND: Es brodelt! Söders CSU nach Israel-Waffenwende sauer! WELT STREAM
DEUTSCHLAND: Es brodelt! Söders CSU nach Israel-Waffenwende sauer! WELT STREAM





























