
Nach der Einigung im Zoll-Deal zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten stehen die EU und deren Repräsentantin Ursula von der Leyen (CDU) als große Verlierer dar. Obwohl Medien und politische Vertreter zurückhaltend von einem Erfolg sprechen, ist der Deal in Wahrheit das Gegenteil. Ein Experte der Automobilindustrie weiß, welche Konsequenzen die neuen Zölle für die deutschen Automobilhersteller haben könnte.
Wie sehr sich die europäischen Staaten haben vorführen lassen, zeigt sich mit einem Blick auf die Zollhistorie zwischen den USA und Europa. Lag der durchschnittliche Zollsatz in Trumps erster Regierungsperiode noch bei etwa zwei Prozent, stieg er auch unter seinem Nachfolger Joe Biden nur auf 2,5 Prozent. Bis zum großen Zollhammer Anfang April. Den Zollsatz für Produkte aus der Europäischen Union hiefte der US-Präsident auf satte 27,5 Prozent.
Trump bei der Verkündung seiner neuen Zollsätze
Nun soll die Beinahe-Halbierung der Prozentzahlen als europäischer Verhandlungserfolg verkauft werden. In der Tagesschau und der Deutschen Welle spricht man von einem „Kompromiss“, Bundeskanzler Friedrich Merz legte sogar noch einen drauf. Bei ihm hieß es: „Mit der Einigung ist es gelungen, einen Handelskonflikt abzuwenden, der die exportorientierte deutsche Wirtschaft hart getroffen hätte.“
Dabei ist der Deal alles andere als gelungen: Nimmt man die Zölle unter Biden als Maßstab, liegt mit dem neuen Zollsatz von 15 Prozent eines Versechsfachung des Zollsatzes vor. Dass sich daran in naher Zukunft etwas ändern könnte, ist unwahrscheinlich.
Der Zoll-Deal ist keine Zollhalbierung, sondern eine Versechsfachung
Der Wirtschaftswissenschaftler und Gründer des Center Automotive Research, Ferdinand Dudenhöffer, rechnet daher für die Automobilbranche mit gravierenden Konsequenzen: „Die Beschäftigten in der Auto- und Zulieferindustrie sind die Verlierer“. Er glaubt an eine deutliche Verschiebung der Arbeitsplätze. Gegenüber NIUS sagt Dudenhöffer: „Sollten keine Verrechnungen stattfinden, gehen wir von einem mittelfristigen Arbeitsplatz-Export der Autoindustrie von bis zu zehn Prozent aus Deutschland in die USA aus.“ Bis Ende 2024 waren etwas mehr als 761.000 Beschäftigte in der Automobilbranche tätig, konkret wären also über 70.000 Stellen in Deutschland in Gefahr.
„Autopapst“ Ferdinand Dudenhöffer beim Car Symposium in Bochum
Die zukünftigen Zahlen wären dann nicht der Ursprung der Personal-Problematik, sondern eine weiter fortschreitende Verschlechterung. Wie aus einer Studie des Beratungsunternehmens EY hervorgeht, wurden bereits im vergangenen Jahr rund 19.000 Stellen in der Automobilbranche abgebaut.
Die US-Standorte leiden aber nicht: „Es gibt keine Gegenzölle, damit können die Produktion-Hubs von BMW und Mercedes in den USA weiter die SUV nach Europa ohne Zusatzkosten schicken“, sagt Dudenhöffer.
Neben Deutschland seien auch die Werke von Volkswagen und BMW in Mexiko betroffen. Beide werden ihre dortige Produktion wohl „verkleinern“ und die Standorte in den USA ausbauen, so der Experte.
Volkswagen aus Mexiko könnten für Amerikaner in Zukunft teurer werden.
Während bei den großen Automobilherstellern Standortverlagerungen einfacher durchzuführen sind, ist das in anderen Branchen keine leichte Hürde. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau sagt gegenüber NIUS: „Wenn man mit 200 Fachkräften auf der Schwäbischen Alb sitzt, findet man nicht so einfach 200 andere, ebenso gute Fachkräfte in Kentucky“.
Bisher tappe die Branche im Dunkeln, weil es eine „Ankündigung eines Zollabkommens gibt, aber keinerlei schriftliche Dokumente, die erkennen lassen, was da vielleicht wirklich auf die Betriebe zukommt oder nicht“, heißt es aus dem Verband. Die Kritik an der Europäischen Union machte der Verband bereits vorgestern in einem Pressestatement deutlich: „Die EU muss jetzt konsequent ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken, den Binnenmarkt ausbauen, die eigene Unabhängigkeit bei Verteidigung und Rohstoffen erhöhen, sich als offenen Wirtschaftsraum des Rechts unter Gleichen behaupten und Handelsabkommen mit neuen Partnern abschließen“, heißt es darin.








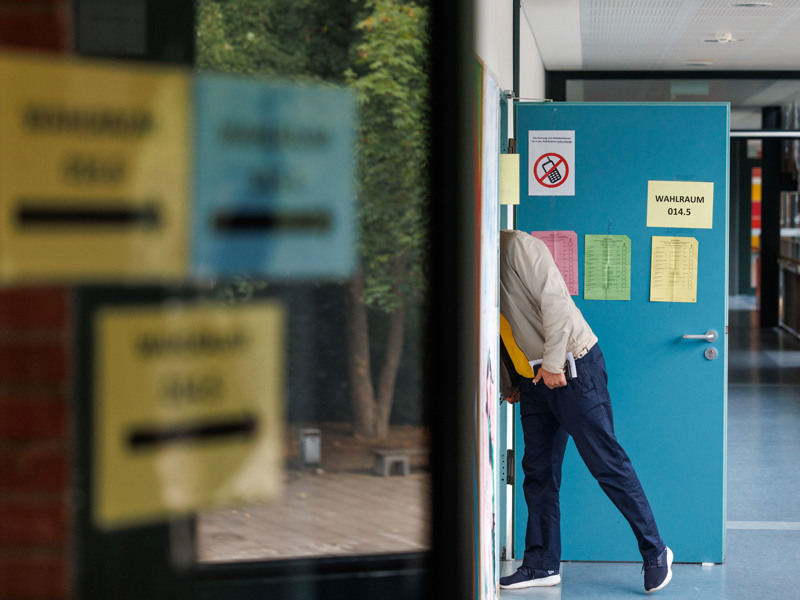
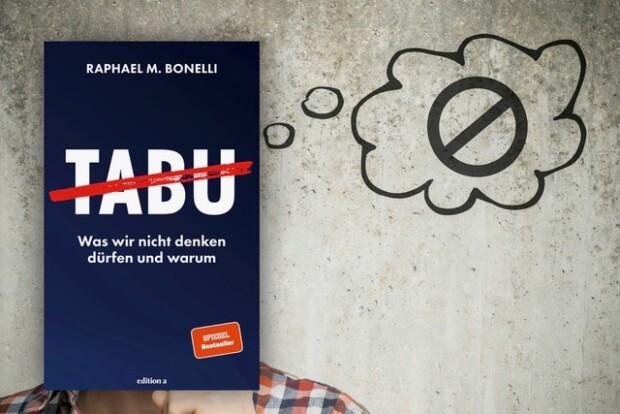
 DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE
DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE






























