
Die Fraktionen von CDU und Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag haben gemeinsam einen Antrag eingereicht, in dem gefordert wird, die Mehrsprachigkeit an Schulen zu fördern. „Die Förderung von Mehrsprachigkeit als Kompetenzförderung muss von der Grundschule bis zum Abitur als integraler Bestandteil des Bildungswegs gedacht werden“, heißt es in dem Antrag, der am Mittwoch vorgestellt und am Freitag veröffentlicht wurde. Der Unterricht solle an die Lebensrealität der Schüler angepasst werden.
„Nordrhein-Westfalen bietet aufgrund seiner Einwanderungsgeschichte ein Potenzial für gelebte Mehrsprachigkeit“, heißt es. Mehrsprachigkeit würde auch „beim Erwerb der Zweitsprache, in diesem Fall der deutschen Sprache“ helfen und dazu beitragen, dass Vorurteile abgebaut würden. Es wird auch von einer „Demokratieförderung“ durch Mehrsprachigkeit gesprochen. In der Oberstufe könnten „Projektkurse auch in der Erstsprache“ durchgeführt werden, wenn die Kultusministerkonferenz die jeweilige Sprache als Unterrichtsfach für die Sekundarstufe anerkennt.
In Nordrhein-Westfalen wird unter anderem Russisch, Türkisch und Japanisch gelehrt. Die Mehrsprachigkeit soll auch in der Lehrerausbildung gefördert werden, heißt es in dem Antrag. Lehrern mit internationalen Biografien komme eine Schlüsselrolle zu. Wie das praktisch aussehen soll, ist noch offen. Allerdings gibt es eine Passage, die aufhorchen lässt: Regelungen sollen angepasst werden, „sodass fachliche Kompetenzen auch dann angemessen erfasst werden können, wenn ein Kind aufgrund noch unzureichender Deutschkenntnisse seine Kompetenzen nicht vollständig darstellen kann“. Ob das auch Klassenarbeiten oder Tests auf anderen Sprachen bedeutet, ist offen.
FDP-Fraktionschef Hennig Höne schrieb am 2. September auf X: „Schwarz-Grün plant in NRW Klassenarbeiten in der Herkunftssprache: integrations- und bildungspolitisch eine Kapitulation. Zu oft sprechen Kinder zwei Sprachen, aber keine richtig gut. Wer Pilot des eigenen Lebens sein will, braucht die deutsche Sprache“. Laut Antrag soll auch geprüft werden, wie Eltern „bestärkt werden können, auch in ihrer Herkunftssprache mit ihren Kindern Basiskompetenzen zu fördern“.
Laut dem Mikrozensus für 2022 betrug der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund, die neben Deutsch noch mindestens eine weitere Sprache zu Hause sprechen, 52,1 Prozent. Am häufigsten werden Türkisch, Russisch und Arabisch gesprochen. 18,7 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund sprechen zu Hause gar kein Deutsch. In dieser Gruppe wird am häufigsten Türkisch, Arabisch und Russisch gesprochen. In ganz Nordrhein-Westfalen haben 44 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund.







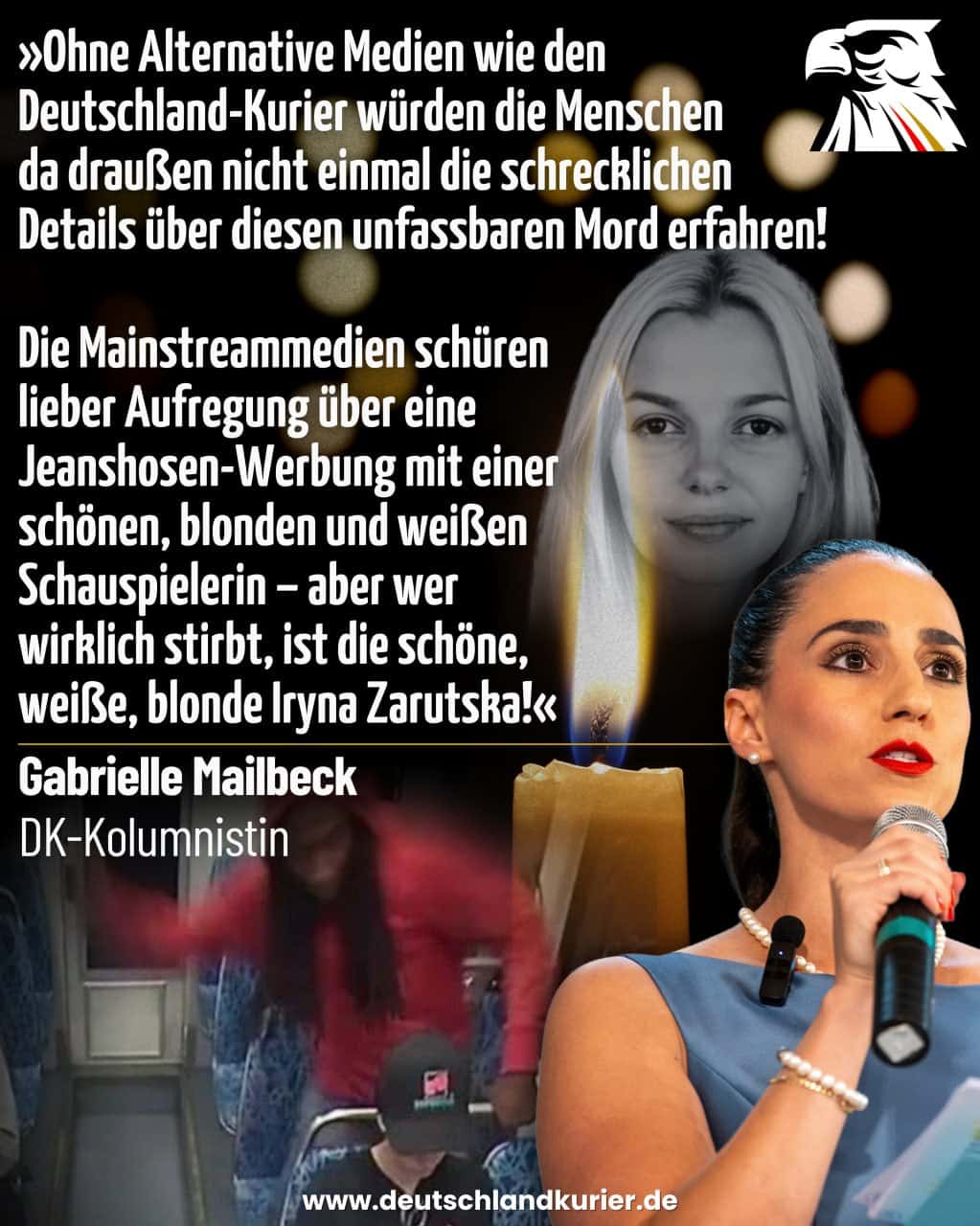


 🚨Kirk-Attentat! So wird Gewalt gegen Konservative vertuscht | NIUS Live am 12. September 2025
🚨Kirk-Attentat! So wird Gewalt gegen Konservative vertuscht | NIUS Live am 12. September 2025






























