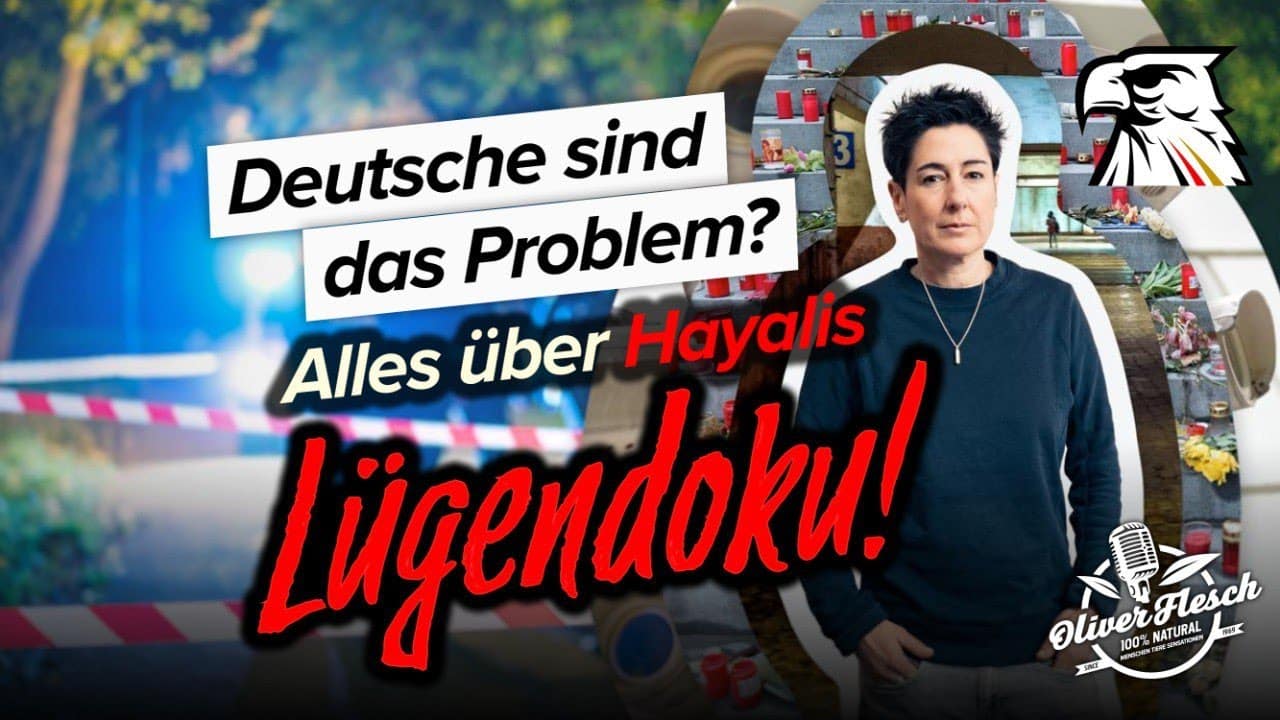Über Jahrzehnte war das zunächst westdeutsche und ab 1990 gesamtdeutsche Parteiensystem von der Vorherrschaft zweier Volksparteien geprägt. Sie sprachen mit ihren Programmen verschiedene Wählerschichten an und erzielten so konstant auch Wahlergebnisse von deutlich über 30, nicht selten sogar über 40 Prozent. Das deutsche Parteiensystem wurde so über lange Zeit von zwei Parteien dominiert, die in Koalitionen mit kleineren Partnern das Land entweder christdemokratisch oder sozialdemokratisch regierten.
Wenn es rechnerisch zur Bildung einer kleinen Koalition nicht reichte, schlossen sich CDU/CSU und SPD ausnahmsweise zu großen Koalitionen zusammen, um das Land zu regieren. Geführt wurden diese bislang durchweg von den beiden Unionsparteien. Erstmals geschah dies im Jahr 1966 unter der Kanzlerschaft von Kurt Georg Kiesinger (CDU), danach erst wieder im Jahr 2005 unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU). Dazwischen lagen mehrere kleine Koalitionen zwischen SPD und FDP und CDU/CSU und FDP sowie zwischen SPD und den Grünen. Nach der großen Koalition des Jahres 2005 kam es im Jahr 2009 nochmals zu einer kleinen Koalition von CDU/CSU und FDP. Sie führte dazu, dass die FDP bei der anschließenden Bundestagswahl 2013 an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Seitdem geben die jeweiligen Ergebnisse der Bundestagswahl für CDU/CSU oder SPD rechnerisch keine Mehrheiten für stabile Zweier-Koalitionen mit der FDP oder den Grünen mehr her.
Das Desaster von Schwarz-Gelb ab 2009 beendete schließlich endgültig alle konservativ-liberalen Hoffnungen auf eine Rückkehr zu stabilen Mitte-Rechts-Koalitionen wie zu Zeiten Helmut Kohls (CDU) und Hans-Dietrich Genschers (FDP). Ab dem Jahr 2013 wurde Deutschland stattdessen erneut von einer großen Koalition aus CDU/CSU und SPD unter Kanzlerin Merkel geführt, die erst 2021 endete. Abgelöst wurde sie danach von einer kleinen Koalition aus SPD, Grünen und FDP, nachdem die beiden Unionsparteien mit knapp 27 Prozent aller Sitze ihr bislang bei einer Bundestagswahl schlechtestes Ergebnis eingefahren hatten.
Damit scheint es inzwischen vorbei zu sein. Seit dem Jahr 2013 findet ein politischer Wechsel nach Mitte-Rechts nämlich nicht mehr statt. Regiert wurde das Land seitdem zweimal erneut von einer großen Koalition aus CDU/CSU und SPD und danach von einer kleinen Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Diese ist 2024 erneut von einer schwarz-roten Koalition abgelöst worden, obwohl sich die rechnerischen Mehrheitsverhältnisse im Bundestag nicht erst 2024 stark nach Mitte-Rechts verschoben haben, wie die folgende, sich aus Erst- und Zweitstimmenergebnissen ergebende Sitzverteilung im Deutschen Bundestag zeigt.
Waren das Mitte-Rechts-Lager aus CDU/CSU und FDP und das Mitte-Links-Lager aus SPD, Grünen und Linken nach der Wahl 2013 im Bundestag mit rund 49 bzw. 51 Prozent noch fast gleich stark vertreten, überflügelt inzwischen das Mitte-Rechts-Lager mit rund 57 Prozent der Sitze das Mitte-Links-Lager, das nur noch über rund 42 Prozent der Sitze verfügt.
Die Sitzverhältnisse haben sich aber nicht nur zwischen den beiden Lagern, sondern noch stärker innerhalb dieser Lager verschoben. Besonders prägnant ist dabei sicherlich der ebenso schnelle wie starke Zuwachs des Sitzanteils der erst 2013 gegründeten Alternative für Deutschland (AfD) im Mitte-Rechts-Lager auf inzwischen rund 24 Prozent. Ihm korrespondiert nicht nur das abermalige Verschwinden der FDP aus dem Bundestag, sondern auch der Rückgang des Sitzanteils von CDU/CSU von rund 49 Prozent im Jahr 2013 auf rund 33 Prozent im Jahr 2024. Numerisch sind CDU/CSU im Bund damit auf eine Größenordnung zusammengeschrumpft, die es nicht mehr einschränkungslos erlaubt, sie weiter als große Volkspartei zu charakterisieren.
Geschuldet ist die offenkundige Beschleunigung des Verfalls des bisherigen deutschen Parteiensystems in erster Linie dem von beiden ehemaligen Volksparteien und ihren einstigen Koalitionspartnern mehr oder weniger in Kauf genommenen, zeitweise sogar aktiv betriebenen langjährigen Missbrauch des Asylrechts zur Masseneinwanderung. Der Preis, den insbesondere CDU/CSU und SPD dafür bezahlten, ist hoch und hat im Ergebnis dazu geführt, dass trotz einer stark gewachsenen rechnerischen Stimmenmehrheit für eine Mitte-Rechts-Koalition im Bundestag das Land in Gestalt der SPD weiterhin von einer linken Partei (mit-)regiert wird, die 2024 als Kanzlerpartei die Wahl krachend verlor.
Gerechtfertigt wird diese schwarz-rote Kleiko von ihren Partnern mit dem Argument, nur so ließe sich verhindern, dass mit der AfD eine Partei an die Regierung gelangt, die „unsere Demokratie“ abschaffen wolle. Eine gegen die AfD errichtete „Brandmauer“ zur Verhinderung von jeglicher Art von politischer Zusammenarbeit aller anderen Parteien mit ihr soll bewirken, dass sie von weniger Bürgern gewählt wird. Diese sollen so erkennen, dass die AfD niemals in Regierungsverantwortung kommen wird, sodass jede abgegebene Stimme für diese Partei zu einer verschenkten Stimme werde.
Der Wunsch der allermeisten AfD-Wähler laut Umfragen ist es, in Deutschland mit Wahlen wieder einer stabilen und schlagkräftigen Mitte-Rechts-Regierung an die Macht zu verhelfen, die seit der ersten, 1998 gebildeten rot-grünen Koalition von der Macht verdrängt ist. Ein politisches Ansinnen, das man nicht teilen muss, an dem in einer gut funktionierenden Demokratie aber nichts auszusetzen ist. Sie lebt vom politischen Richtungswechsel und droht zu sterben, wenn dieser nicht mehr stattfindet.
So ist nicht auszuschließen, dass stattdessen die Stimmenenteile der AfD im Bundestag in den nächsten Jahren noch weiter anwachsen und deswegen das Land unter Beteiligung nicht mehr nur der SPD, sondern zusätzlich der Grünen und/oder der Linken unter Führung der beiden Unionsparteien noch stärker mitte-links als bislang schon regiert wird. Ob die Wähler in Deutschland ein solches Vorgehen zur Bildung bloßer Anti-AfD-Koalitionen auf Dauer akzeptieren werden, wird man sehen. Von einem großen Respekt der etablierten Parteien gegenüber dem in Wahlen demokratisch geäußerten Volkswillen zeugt es jedenfalls nicht.