
Nach einer Hängepartie von zwei Jahrzehnten kommt nun Bewegung in das Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Südamerikas. Die harte Linie von Donald Trump macht es möglich. Kritik kommt von den üblichen Verdächtigen.
Vor einem Vierteljahrhundert, im Jahr 2000, begannen die Handelsgespräche zwischen der EU und den Mercosur-Staaten – Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, zu denen sich zwischenzeitlich auch Venezuela gesellt hat. Ziel von Mercosur ist der Abbau von Handelshemmnissen, die Einrichtung eines integrierten Zollregimes und die Schaffung eines eigenen Binnenmarkts, ähnlich den europäischen Strukturen.
Es war stets ein zähes Ringen, doch am Mittwoch hat immerhin die EU-Kommission der zuletzt Ende 2024 vorgelegten Version des Abkommens zugestimmt.
Kernpunkt ist der Abbau von Zöllen auf einen Großteil der Waren, was sowohl europäische Industrieprodukte wie Maschinen, Fahrzeuge und Pharmaerzeugnisse als auch südamerikanische Agrar- und Rohstoffexporte betrifft. Zugleich sieht das Abkommen Handelsquoten und Schutzmechanismen vor, um sensible Sektoren – insbesondere die europäische Landwirtschaft – gegen drohende Konkurrenz abzusichern. Rund 350 geographische Indikationen sollen die Einzigartigkeit europäischer Produkte sichern – EU-Protektionismus in seiner reinsten Form.
Unter keinen Umständen darf man das Mercosur-Abkommen als ein Freihandelsabkommen bezeichnen, selbst wenn dies gerne im politischen Feuilleton praktiziert wird. Von dem Gedanken, dass offener Wettbewerb der beste Verbraucherschutz sei und die Märkte am besten versorgen könnte, ist man sowohl in Südamerika als auch in der Europäischen Union meilenweit entfernt.
Ein weiterer Schwerpunkt des Abkommens liegt auf Nachhaltigkeit und Regulierung: Unternehmen aus Mercosur müssen Umwelt- und Sozialstandards der EU einhalten und Nachweise für „abholzungsfreie“ Produktion und Compliance mit der CO₂-Taxonomie vorlegen. Das Abkommen enthält zudem Mechanismen für Investitionsschutz und betriebliche Streitbeilegung, die Planungssicherheit für beide Seiten bieten sollen. In diesem regulatorischen Spannungsfeld definiert Brüssel seine protektionistische Macht und zieht Schutzwall um Schutzwall nicht-tarifären Charakters in die Handelsbeziehungen mit außereuropäischen Staaten ein.
Und ähnlich wie die Europäer taten sich auch die Südamerikaner stets schwer, freien Handel zuzulassen, wenn er bestehende ökonomische Privilegien bedrohte. So geriet das Mercosur-Abkommen lange zum Geistervertrag, wurde 2016 neu belebt und erscheint nun – nicht zuletzt unter dem Druck der Amerikaner – für beide Seiten wieder als attraktive Lösung, um den gegenseitigen Handel zu stärken und für wirtschaftliche Impulse in den wachstumsschwachen Regionen zu sorgen.
Das rohstoffreiche Südamerika spürt seit längerem, dass die Zeit des großen Exportbooms fürs Erste der Vergangenheit angehört – nicht zuletzt wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise in China. Die Wachstumsraten liegen heute deutlich unter dem Niveau der ersten Dekade dieses Jahrhunderts und erreichen im Schnitt nur noch etwa 2,5 Prozent. Gleichzeitig steigt die Arbeitslosigkeit langsam an, während die Staatsverschuldung deutlich höher ausfällt – in Brasilien etwa rund 77 Prozent des BIP. Abgesehen vom Sonderfall Argentinien, das sich einem radikal marktwirtschaftlichen Kurs verschrieben hat, wächst damit der Handlungsdruck allerorten.
Vor allem im Rohstoff- und Agrarexport müssen neue Märkte erschlossen werden. Gerade deshalb gewinnt das Mercosur-Abkommen mit der EU auch für die südamerikanischen Staaten wieder an Attraktivität, sollte es gelingen, die hohe Schutzmauer der EU wenigstens in Teilen einzureißen.
Und genau hier liegt die Krux aus europäischer Sicht: Die zwar volkswirtschaftlich marginale, politisch aber überaus einflussreiche Agrarlobby – insbesondere in Frankreich – wird alles daransetzen, sich die Konkurrenz aus Südamerika vom Hals zu halten.
Die EU-Kommission hat das Abkommen vor dem Abstimmungsprozess in zwei Teile („Splitting“) geteilt, um den Handelsbereich schneller und mit qualifizierter Mehrheit durchzubringen und so das Einstimmigkeitsprinzip im Rat für diesen Bereich zu umgehen. Zur Unterzeichnung des kommerziellen Parts Abkommens bedarf es im EU-Rat nicht der Einstimmigkeit. Für die Ratifizierung des Handelsteils reicht eine qualifizierte Mehrheit im EU-Ministerrat aus. Das heißt mindestens 55 Prozent der Mitgliedstaaten, die zugleich mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, müssen zustimmen, was als sicher gilt. Auch das EU-Parlament muss dem Handelsteil mit einfacher Mehrheit zustimmen.
Der politische Teil des Abkommens, der etwa Menschenrechte, Umwelt- und Sozialstandards umfasst, gilt hingegen als sogenanntes „gemischtes Abkommen“ und muss von allen nationalen Parlamenten einstimmig ratifiziert werden. Hier kann also ein einzelner Mitgliedstaat eine Blockade organisieren.
Neben polnischen und italienischen Interessengruppen bleibt vor allem Frankreich kritisch. Angesichts innenpolitischer Spannungen, etwa bei der bevorstehenden Abstimmung über Sozialausgaben, droht das Land auch beim Mercosur-Abkommen zum Bremsklotz zu werden. Es ist denkbar, dass Frankreich vor der Abstimmung über den zweiten Teil, der Menschenrechte und Umweltstandards umfasst, im Europarat sämtliche Lobbyregister ziehen wird, um den Ratifizierungsprozess auszubremsen.
Während sich Bundeskanzler Friedrich Merz in einem Beitrag auf „X“ zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis zeigt, bleibt man in Frankreich zwar weiterhin kritisch, steht den vorgeschlagenen Schutzmechanismen der EU-Kommission jedoch offen gegenüber.
Handelsminister Laurent Saint-Martin bezeichnete die Agrar-Schutzklausel als „Schritt in die richtige Richtung“ und kündigte eine gründliche Prüfung an.
Zuvor hatte die Regierung das Abkommen wegen möglicher Nachteile für heimische Landwirte als „inakzeptabel“ kritisiert, vor allem wegen billiger Rindfleischimporte aus dem Mercosur-Raum.
Die EU-Kommission versucht derweil, Bedenken mit zeitweisen Importbeschränkungen und einem Krisenfonds für Landwirte in Höhe von 6,3 Milliarden Euro abzufedern – die Zustimmung der Opposition wird also wieder einmal mit Steuergeld erkauft, die Begeisterung für freie Märkte hält sich entschieden in Grenzen.
Frankreichs Präsident Macron äußerte zwar inhaltliche Bedenken, verzichtete jedoch auf entschiedenen Widerstand gegen ein Verfahren, das eine Ratifizierung ohne Einstimmigkeit ermöglicht. Auch Agrarorganisationen setzen ihren Protest fort, während der Bauernverband FNSEA zunehmend in die Regierungspolitik eingebunden ist und weniger auf Importschutz pocht.
Sollte am Ende tatsächlich eine Einigung zwischen den Mercosur-Staaten und der EU stehen, ist dies zum größten Teil dem Druck aus Washington zu verdanken. Donald Trump hat vor allen Dingen die europäischen Exporteure mit seinem Zollregime massiv unter Druck gesetzt und die Notwendigkeit der Eröffnung neuer Absatzmärkte erzwungen.
Sollten die Mercosur-Staaten die europäischen Klima- und Sozialregeln weitgehend akzeptieren und auch die EU-Institutionen den Vertrag passieren lassen, hätte die EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen nach dem Debakel mit den USA einen ersten Etappensieg errungen. Abschließende Verhandlungen in Brüssel werden noch für dieses Jahr erwartet.

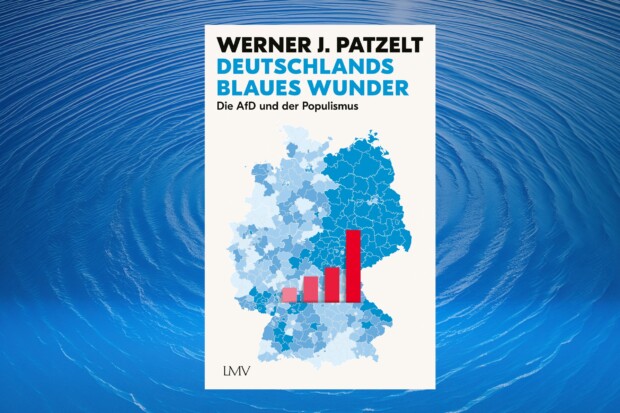





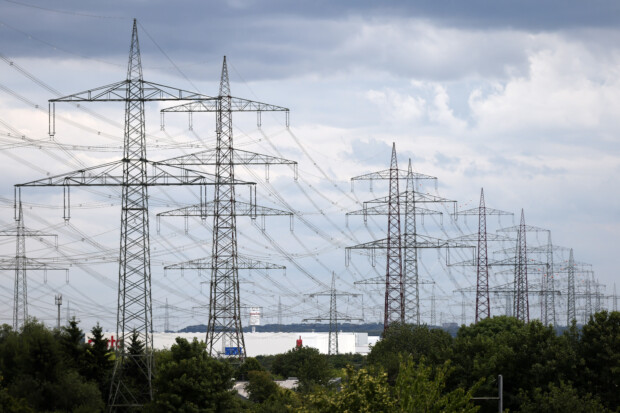

 UKRAINE-KRIEG: "Ausländische Soldaten wären legitimes Ziel!" Jetzt droht Putin Europa direkt! STREAM
UKRAINE-KRIEG: "Ausländische Soldaten wären legitimes Ziel!" Jetzt droht Putin Europa direkt! STREAM






























