
Es gibt Tage, da spüren Eltern schon vor dem Aufstehen: Heute wird einer dieser Tage. Ein Morgen, der Kraft verlangt, Geduld, Präsenz – obwohl man selbst nur einen Hauch davon im Schlaf getankt hat. Ein Tag, an dem das Kind nicht aufstehen will, sich nicht anziehen mag. Keine Motivation zeigt, in den Kindergarten zu gehen.
Der Idealfall – ein freudiger, neugieriger Start – scheint weit entfernt. Und doch kennen wir das alle. Ob 6, 16 oder 36 Jahre alt: Jeden Tag raus in ein System, in dem man funktionieren muss: Ob Kita, Schule, Uni oder Arbeitsplatz – die Mechanismen sind erstaunlich ähnlich. Nur die Verpackung verändert sich.
Ich denke zurück an meine eigene Kindergartenzeit. Erinnere mich an das großzügige Außengelände, an das Rennen, Toben, Durchatmen.
An die grauen Toilettenräume, vor denen ich etwas Angst hatte. An Geburtstagskinder im Morgenkreis – auf einem Stuhl, hochgehoben von Erzieherinnen, während wir sangen: „Hoch sollst du leben!“. Vor allem erinnere ich mich an das Basteln und Malen.
Diese Momente völliger Versunkenheit, wenn man klebte, pinselte, schnitt, faltete. Ganz bei sich. Ganz im Flow. Ich erinnere mich an Raum. An Möglichkeiten. An Freiheit. Und an die widersprüchlichen Gefühle, wenn ich abgeholt wurde: Ich freue mich meine Mutter zu sehen, bin zugleich aber auch traurig, diesen Rahmen nun zu verlassen, in dem ich irgendwie viel selbstständiger war als zuhause.
Ich erinnere mich an Malte. In den war ich verliebt. An meine beste Freundin mit mir zusammen im Sandkasten.
Ich erinnere mich nicht an Enge. Nicht an Überforderung. Nicht an Gewalt oder Aggressionen unter Kindern. Nicht an Selbstverteidigungskurse, die innerhalb von einer Stunde ausgebucht waren. Nicht an Lautstärke die nicht auszuhalten war. Nicht an Kopfhörer, die man tragen durfte, wenn „das besondere Kind“ besonders laut herumschrie. Das aber sind die Themen, um die es heutzutage in der Kita geht. Die berechtigten Gründe für das Jammern meiner Tochter: „Ich will nicht in die Kita, Mama!“ Diese Gespräche führe ich auch oft unter Zeitdruck mit ihr. Einige Dinge sind nun mal, wie sie sind, auch wenn sie sie nicht mag. Es gibt Dinge, die muss man aushalten: früh aufstehen, Zähne putzen, sich selbst anziehen usw.
Aber es kommen immer mehr Dinge hinzu, die ein Kind heutzutage aushalten muss – Dinge, die es eigentlich nicht aushalten sollte. Als Elternteil ist es ein ständiger Balanceakt: Gespräche mit den Erziehern zu führen, ohne zu viel zu kritisieren, dabei Wertschätzung zu zeigen, aber trotzdem für das Kind einzutreten. Und dann diese Angst, dass, wenn man zu viel sagt, das eigene Kind darunter leiden könnte – unbeliebt wird, sich ausgegrenzt fühlt. Also lieber weniger sagen.
Und Heute? Heute sitze ich wieder an einem dieser Tage vor meiner Tochter. Sie ist still, in sich gekehrt – und sagt es noch einmal: „Ich will nicht in die Kita, Mama.“
Ich frage sie, bemüht, verständnisvoll zu bleiben: „Warum willst du nicht in die Kita, Schatz?“ Und während ich die Worte spreche, hoffe ich insgeheim, dass es einer dieser typischen Gründe ist: Es ist langweilig. Es ist doof. Oder vielleicht der Satz, der mir jedes Mal einen leisen Stich versetzt – aber auf den ich innerlich vorbereitet bin: „Mit mir spielt niemand.“ Auch diesen Satz haben wir schon oft besprochen, aufgefächert, hinterfragt. Ich erkläre ihr dann, dass Beziehungen sich verändern dürfen. Ich baue sie auf, suche gemeinsam mit ihr nach Lösungen – damit sie nicht abrutscht in das Gefühl, ein Opfer zu sein. Es ist schwer geworden, Eltern zu sein, denke ich. Wirklich schwer.
Dann zögert sie. Und sagt leise: „Ich will heute nicht mit den anderen spielen.“
Erleichterung. In meiner Welt ist das ein lösbares Problem. Ich antworte fast euphorisch: „Das musst du auch nicht, Schatz. Konzentrier dich einfach auf dich selbst. Du malst doch so gern. Mal alle deine Gefühle raus. Mal für dich oder auch für mich. Du brauchst dazu niemanden.“
Dann schaut sie mich ernst an. „Aber Mama, ich darf nicht mehr so viel malen. Nur zwei Blätter am Tag für jedes Kind. Sonst tut das den Bäumen weh.“
Ich bin baff. Ich starre sie an. Mir schnürt es die Kehle zu. Wiederhole laut: „Zwei Blätter? Pro Tag? Für jedes Kind?“ Sie nickt. „Ja. Wegen der Umwelt.“, sagt sie.
Und plötzlich spüre ich nur noch Wut. Ich bin wütend. Nicht auf mein Kind – sondern auf ein System, das Kindern Schuldgefühle einpflanzt, ihnen ihre Kreativität nimmt, die Mittel, sich auszudrücken, und das ihren natürlichen Drang, die Welt zu begreifen, zu gestalten, zu verarbeiten, wahlweise abwürgt, ausnutzt oder manipuliert.
Ich verstehe, das Kitas Kinder für Ressourcenschonung zu sensibilisieren versuchen.
Doch statt vernünftigem Umgang werden Mangel und Zwang vermittelt. Angst. Begrenzung. Scham. Ausweglosigkeit.
Ein Kind, das sich nicht mehr traut, nach einem Blatt Papier zu fragen, weil es glaubt, dadurch dem Planeten zu schaden: Das ist keine Umweltbildung. Das ist emotionale Überforderung.
Das ist kein pädagogisches Konzept, sondern ein Frontalangriff auf die Freiheit – in ihrem kleinsten, sensibelsten Keim.
Kreativität ist kein Luxus. Sie ist Ausdruck innerer Freiheit. Wenn ein Kind malt, formt es seine Welt. Es denkt nicht darüber nach, ob das „nützlich“ oder „sinnvoll“ ist – es ist einfach im Tun. Im Sein. Im Jetzt. Im Fluss.
Und genau darin liegt Freiheit: spontan, zweckfrei, selbstbestimmt handeln zu dürfen.
Wenn diese Spontaneität begrenzt wird – mit Sätzen wie „Nur zwei Blätter, wegen der Bäume!“ – dann passiert etwas Grundlegendes: Das Kind lernt, dass sein Impuls zu viel ist. Dass es sich zurücknehmen muss. Dass freier Ausdruck anderen schadet.
Es lernt, sich zu zügeln – nicht aus Verständnis, sondern aus Schuldgefühlen. Ich habe meiner Tochter eine Packung Papier mit in die Kita gegeben und ihr gesagt: du malst so viel du willst!“ Und bei der Leitung angerufen.
Die Antwort: Ja, diese Regelung gab es. Aber sie werde nicht „so streng“ ausgelegt. Aber was bedeutet das? Was zählt, ist nicht, wie etwas gemeint ist – sondern was ankommt. Und bei den Kindern kommt an: „Wenn ich mich ausdrücke, schädige ich die Umwelt. Wenn ich ein drittes Blatt nehme, bin ich schlecht, denn ich schade der Umwelt.“
Das ist Manipulation in Reinform. Und das ist kein Einzelfall.
Immer mehr Eltern berichten von ähnlichen Einschränkungen in Kitas. Scheinbar kleine Maßnahmen, tatsächlich aber mit großer Wirkung: Weniger Spielmaterial, denn „weniger ist ja mehr“.
Ständig fällt dann das Stichwort: „Montessori-Konzept“. Aber wenn man nachfragt, heißt es schnell: „nur ein Teilkonzept“. Denn für eine echte Umsetzung fehlen das Personal, die Zeit, die Ausbildung. Kurz gesagt: Es wird genommen, was passt – pädagogisch klingt’s schick, in der Realität bedeutet es oft schlicht: Sparen.
Begrenzte Bastelzeiten. Zwei Blätter Papier am Tag. Kreativität auf Ration. Und das alles verkauft man uns als bewusste Erziehung. Doch was wie ein nobles Bildungskonzept daherkommt, ist in Wahrheit oft nichts anderes als: Notverwaltung.
Frühstück? Gibt’s vielerorts gar nicht mehr. Auch bei uns müssen wir es jeden Morgen selbst mitgeben. Individuell. Still abgeschafft. Offiziell zur „Selbstständigkeitsförderung“, inoffiziell natürlich aus Spargründen.
Was früher selbstverständlich war, Farben, Freiheit, gemeinsames Essen, Erkundung der Welt, wird heute nach und nach eingeschränkt. Und all das wird dann etikettiert mit wohlklingenden Begriffen wie „Nachhaltigkeit“, „Achtsamkeit“ oder „pädagogisch wertvoll“, „Elternarbeit“.
Ausflüge? Immer seltener – oder mit teils happigen Zusatzkosten verbunden. Ein besonders bitteres Beispiel aus unserer Kita: Vor einiger Zeit wurde ein Waldpädagogik-Kurs angeboten. Tolle Idee! Genau das brauchen Kinder. Draußen sein. Die Natur erleben. Erde unter den Fingernägeln. Wind im Gesicht. Leben spüren.
Und dann der Hammer: 130 Euro. Freiwillig natürlich. Aber: Nur wer zahlt, darf mit. Wer nicht – bleibt zurück.
Auf Nachfrage, was mit den Kindern passiert, die nicht teilnehmen, antwortet die Leitung: „Der Kurs ist ja freiwillig. Die übrigen Kinder werden in die jüngeren Gruppen gemischt.“
Hier zeigt sich der Widerspruch glasklar: Ein Kind lernt nicht, Bäume zu lieben, weil es auf Papier verzichtet. Es lernt, Bäume zu lieben, weil es unter ihnen liegt. Weil es sie sieht, riecht, spürt. Nicht durch Verzicht – sondern durch Verbindung.
Und genau die wird plötzlich zur Frage des Geldbeutels. Statt echte Verbindung zu ermöglichen, setzen wir auf symbolischen Verzicht.
Sie nehmen Kindern das dritte Blatt Papier – und verkaufen das als ökologisches Bewusstsein. Sie reduzieren Teilhabe – und nennen es Pädagogik. Dabei kommt bei den Kindern nicht Bildung an, sondern ideologisch geschwängerte Botschaften wie: „Weniger ist mehr.“ Also besser. „Wenn du mehr willst, schadest du der Welt.“ „Nur wer sich einschränkt, ist ein guter Mensch.“
Psychologischer Gehorsam unter grünem Deckmantel. Bei den Kleinsten und Schutzlosesten unserer Gesellschaft. Das erinnert an alte Muster: An Mangelpädagogik. An DDR-Ideologie. Nur heute nennt man es Nachhaltigkeit. FFF. Klimawandel, und so weiter.
Wenn Kinder in ihrer frühesten Entwicklungsphase lernen, dass ihr Bedürfnis nach Ausdruck und Entfaltung begrenzt, reguliert und moralisch bewertet wird, dann entsteht kein gesundes Umweltbewusstsein, sondern vorauseilender Gehorsam. Dann lernt ein Kind: „Ich muss mich klein machen, sonst schade ich anderen.“
Das ist keine Freiheit. Das ist erlernte Unterwerfung. Und genau deshalb nenne ich es einen Frontalangriff auf die Freiheit.
Denn wahre Freiheit beginnt nicht erst im Erwachsenenalter. Sie beginnt im Spiel, im Bild, im freien Strich auf dem dritten Blatt Papier.
Denn wenn ein Kind sich nicht mehr traut, danach zu fragen, ob es noch ein Blatt haben darf, weil es denkt, dann ein schlechter Mensch zu sein, jemanden oder etwas damit zu schaden, dann ist das kein Kollateralschaden. Dann ist das ein systematisches Problem.
Was sich ändern muss, ist nicht das Kind. Nicht sein Wunsch nach Farbe, Form, Papier. Sondern das System, das aus Kostendruck und pädagogischer und grüner Ideologie heraus Kindern ihre Entfaltung rationiert.
Kinder sind Freiheit in ihrer reinsten Form. Und das ist etwas, das geschützt werden muss, nicht mithilfe von Schuldgefühlen reguliert und gelenkt. Wir dürfen ihnen ihre Fantasie nicht nehmen, indem wir sie an Bedingungen knüpfen. Nicht jedes dritte Blatt Papier ist ein Umweltproblem – aber jedes verlorene Gefühl von Unschuld, Ausdruck und innerer Freiheit ist ein gesellschaftliches.
Wenn ein Erziehungssystem nicht erkennt, dass Fantasie gelebte Freiheit ist; wenn unter ideologischen Deckmänteln kindliches Sein als etwas gilt, das gesteuert werden muss, dann ist das, was wir heute unter dem Etikett „pädagogisch sinnvoll“ oder „nachhaltig“ praktizieren, am Ende gefährlicher als manch autoritäres System es je war.
Und auf jedes leise oder laute: „Ich will nicht in die Kita, Mama.“, antwortet ein Teil von mir lautlos – aber unüberhörbar: „Ich will auch nicht mehr, dass du dorthin gehst.“
Und genau das spüren unsere Kinder. Sie spüren, wenn wir innerlich mitgehen – aber äußerlich zurückbleiben. Sie spüren, dass die Wahrheit oft lautet: Mama kann nichts machen außer dich lieben, dich stützen. Ich versuche, mir einzureden, dass das reicht. Es muss reichen. Denn Mama muss zur Arbeit. Mama ist auch nicht frei… und Mama hasst diese Wahrheit. Unsere Kinder spüren unsere eigene innere Zerrissenheit, und tun es uns gleich.





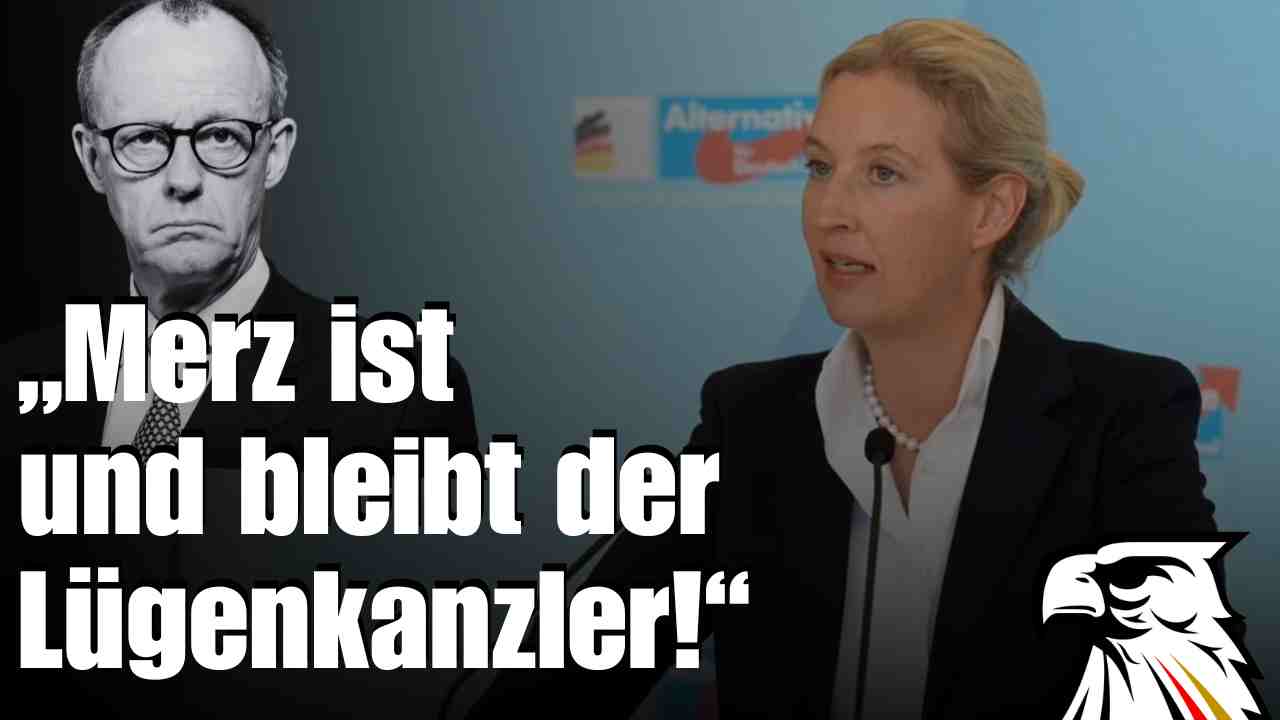



 FRANKREICH: Premierminister Bayrou verliert Vertrauensfrage! Droht Macron nun der Rücktritt? | LIVE
FRANKREICH: Premierminister Bayrou verliert Vertrauensfrage! Droht Macron nun der Rücktritt? | LIVE






























