
Am 28. April 2025 kam es in Spanien und Portugal zu einem der größten Stromausfälle in Europa seit Jahren. Rund 50 Millionen Menschen waren betroffen. Was sind die Ursachen, was die Auswirkungen auf die energiepolitische Debatte?
Die genaue Ursache des Blackouts ist weiterhin Gegenstand von Untersuchungen, doch es gibt mehrere zentrale Erkenntnisse. Um 12:33 Uhr brachen innerhalb von fünf Sekunden 15 Gigawatt Erzeugungsleistung weg – das entsprach etwa 60 Prozent des damaligen Stromverbrauchs in Spanien. Nach Angaben des spanischen Netzbetreibers Red Eléctrica (REE) gab es zwei Erzeugungsausfälle im Abstand von nur eineinhalb Sekunden. Das Netz konnte sich vom ersten noch erholen, nicht aber vom zweiten, was zum Zusammenbruch führte.
Die betroffene Region im Südwesten Spaniens verfügt über hohe Photovoltaik-Kapazitäten, die an dem Tag in großem Stil geliefert haben. Da das spanische Netz die Überproduktion nicht aufnehmen konnte, musste Strom nach Frankreich transportiert werden. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der plötzliche Ausfall großer Mengen Solarstroms – möglicherweise durch automatische Schnellabschaltungen – den Dominoeffekt auslöste. Die geringe Vernetzung der iberischen Halbinsel mit dem restlichen europäischen Stromnetz (nur etwa zwei Prozent Interkonnektivität) verschärfte die Lage, Nachbarn konnten nicht aushelfen.
Noch immer ist unklar, was die genaue Ursache der Störung war. Zunächst wurde behauptet, ein Brand in Frankreich hätte zur Notabschaltung einer Hochspannungsleitung geführt. Schnell kursierten jedoch Bilder von der vermeintlichen Brandstelle, die keinerlei Rauchentwicklung zeigten. Andere spekulierten, ob nicht Cyberangriffe die Solaranlagen lahmgelegt hätten. Auch hierfür fanden sich keinerlei Hinweise. Stattdessen verdichten sich die Hinweise, dass die Notabschaltung Ursachen haben, die im Betrieb des Stromnetzes selbst begründet sind.
Lokale Schwankungen schaukelten sich auf, führten zu Überspannung und es „brannten Sicherungen durch“, um Systeme vor Überspannung automatisch zu schützen. Umgekehrt haben die automatischen Schutzsysteme das Netz auch wieder schnell stabilisiert. Während sie zunächst große Teile des Netzes und viele Großverbraucher automatisch abschalteten, um Schäden durch Überlastung zu verhindern, konnte die Stromversorgung schon zu Montagabend weitgehend wiederhergestellt werden. Wesentliche Hilfe leisteten das Ausland und schwarzstartfähige Wasserkraftwerke. Mittlerweile arbeiten alle Umspannwerke wieder.
Interessant wird die Angelegenheit, wenn man sich den Zustand des europäischen Verbundnetzes in den Stunden vor dem Blackout ansieht. Der Brancheninformationsdienst R2J Energietechnik, der sich intensiv mit der Verbundnetzstabilität und der Netzfrequenz in Europa beschäftigt und permanent die Netzfrequenz misst, berichtet am Abend des Folgetages, dass es in den Stunden vor dem Blackout zu Schwingungen der Netzfrequenz gekommen war.
Hier wird es spannend. Das europäische Verbundnetz ist mit Abstand die größte Maschine, die die Menschheit je gebaut hat. Es umspannt Europa vom Atlantik bis Osteuropa und vom Nordkap bis um den Mittelmeerraum herum. In diesem riesigen Gebiet müssen Spannung, Frequenz und Phase im Stromnetz immer genau geregelt werden, gleichgültig, wie hoch der Stromverbrauch gerade ist.
In der Vergangenheit waren es die großen Schwungmassen der Generatoren von Kohle-, Kern- und Gaskraftwerken, die kleine Schwankungen in Angebot und Nachfrage ausgleichen konnten. Je mehr diese Schwungmassen fehlen, desto„anspruchsvoller“wird die Netzsteuerung. Es muss nun händisch nachgeregelt werden, was vorher durch einfache Physik bewerkstelligt wurde.„Händisch“trifft es nicht ganz, es sind zahlreiche Steuerungsmechanismen implementiert, um auf das Netz einzuwirken.
Genau hier kommt die Kybernetik ins Spiel. Je mehr Sensoren (Messgeräte) und Aktoren (Steuerelemente) in einem System enthalten sind, desto unberechenbarer wird es. Es gibt in der Physik eine ganze Disziplin, die solche Systeme untersucht, die „Nichtlineare Dynamik“. Mein Schwerpunkt im Studium vor dreißig Jahren.
Oszillationen wie hier die Frequenzschwingungen sind ein klares Anzeichen für Instabilität. Schaukeln sie sich durch zufällige Ereignisse auf, können leicht Schwellwerte in der Netzfrequenz überschritten werden, ab denen automatische Eingriffe wirken: Sinkt die Netzfrequenz unter bestimmte Werte, schalten sich große Verbraucher oder gar ganze Teilnetze von selbst ab; steigt die Netzfrequenz, schalten sich Kraftwerke ab. Auch die PV-Anlagen in Spanien haben solche Notfallmaßnahmen eingebaut. Die Crux ist, dass diese Maßnahmen „im Autopilot“ an anderer Stelle noch mehr Instabilität verursachen können.
Ich halte es für wahrscheinlich, dass nach genauer Untersuchung des Blackouts in Spanien die einzige Ursache nicht gefunden wird, sondern eine Verkettung von kleinen, aber unvermeidlichen Ereignissen festgestellt wird, die zum Zusammenbruch des Netzes geführt haben.
Im Systemdesign kennt man solche Instabilitäten und baut deswegen Dämpfungen beziehungsweise Trägheitselemente ein. Diese waren, wie oben erwähnt, die rotierenden Massen, aber diese Kraftwerke sind im Zuge der Energiewende immer weniger im Netz. Am Montag lieferten PV-Anlagen und Windkraftwerke in Spanien drei Viertel der Leistung, und ein Teil der Energie musste nach Portugal und Frankreich entsorgt werden. Die wetterabhängigen Kraftwerke produzieren aber keine Dämpfung, sondern drängen Trägheit in Form von thermischen Kraftwerken aus dem Netz.
Leider konnten die spanischen Kernkraftwerke nicht unterstützen. Nur eines davon (Prillo) ist neuerer deutscher Bauart und hätte in den sogenannten Inselbetrieb gehen können. Dieses ist aber derzeit in Revision und vom Netz getrennt. Im Gegensatz dazu sind die anderen Kernkraftwerke in Spanien älterer und amerikanischer Bauart. Sie sind für den Inselbetrieb technisch nicht ausgerüstet. Dieser hätte dafür gesorgt, dass die Kraftwerke zwar vom Netz entkoppelt sind, aber sofort wieder einspeisen können, wenn das Netz aus dem Stillstand wieder hochgefahren wird. Übrigens hatten alle deutschen Kernkraftwerke diese Fähigkeit zum Inselbetrieb – das war mit ein Grund für die Robustheit der Stromversorgung in Deutschland.
Allerdings ist es erklärtes Ziel der sich derzeit formenden Bundesregierung, die wetterbedingt schwankenden Kraftwerke schnell weiter auszubauen. Auch hierzulande werden wir also mehr und mehr Situationen erleben, in denen sich kleine Störungen im Netz aufschaukeln. Deutschland ist in der komfortablen Lage, ein viel größeres Stromnetz zu haben als Spanien, und zusätzlich ist das deutsche Netz besser in die Nachbarnetze eingebunden als das spanische. Dafür betreibt Deutschland den Ausbau der wetterabhängigen Energien mindestens so rigoros wie Spanien und schaltet gleichzeitig Kraftwerke ab, die das Netz bislang stets stabilisieren konnten.
Es zeichnet sich hier ein „Tschernobyl-Moment“ der „erneuerbaren“ Energien ab. Der Reaktorunfall in dem ukrainischen Kernkraftwerk war für die Atomtechnik viel mehr eine Katastrophe als für die Region ums Kraftwerk. Dort hat sich die Natur bestens erholt, aber bis heute halten sich Mythen von der mangelnden Beherrschbarkeit der Kerntechnik in der öffentlichen Diskussion, auch wenn diese für Kernkraftwerke westlicher Bauart geradezu absurd sind nach so vielen tausend erfolgreichen Betriebsjahren.
In Deutschland kann der spanische Blackout dazu führen, dass endlich die Systemfrage gestellt wird. Die einseitige Wette auf ein Duopol von Solar- und Windenergie führt erkennbar zu Risiken, die, wenn sie eintreten und mehrere Tage anhalten, zum völligen Zusammenbruch der Gesellschaft führen können. Nach Berichten von Betroffenen auf der Plattform X fehlten in Spanien manchen Menschen für 20 Stunden Energie, Telefone, Internet, Geld, Benzin und alles Lebensnotwendige. Sollte ein Blackout länger als ein Tag anhalten, womöglich nicht bei 25 Grad Celsius Außentemperatur, sondern im Winter, blieben Wohnungen kalt und in den Städten würde sich schnell Chaos und Gewalt ausbreiten.
Dass die wetterabhängigen Energien zur Ursache für einen Systemkollaps werden können, war bislang nur wenigen bewusst. Die Debatte beschränkte sich auf die Frage, von woher bei Dunkelflaute, wenn weder Sonne noch Wind liefern, der Strom kommen wird. Zunehmend rückt in den Blick, dass die noch größere Gefahr bei „Hellbrisen“ (Stefan Spiegelsberger / Outdoor Chiemgau) entsteht: Solar- und Windkraftwerke erzeugen hohe Überschüsse, die das Netz destabilisieren und es zum Kollaps bringen können. Es wird spannend sein zu beobachten, ob die Politik ihre Energiestrategie endlich grundsätzlich zu hinterfragen wagt.
Dr. Björn Peters ist Physiker, Energieökonom und Buchautor („Schluss mit der Energiewende! Warum die deutsche Volkswirtschaft dringend ökologischen Realismus braucht“).


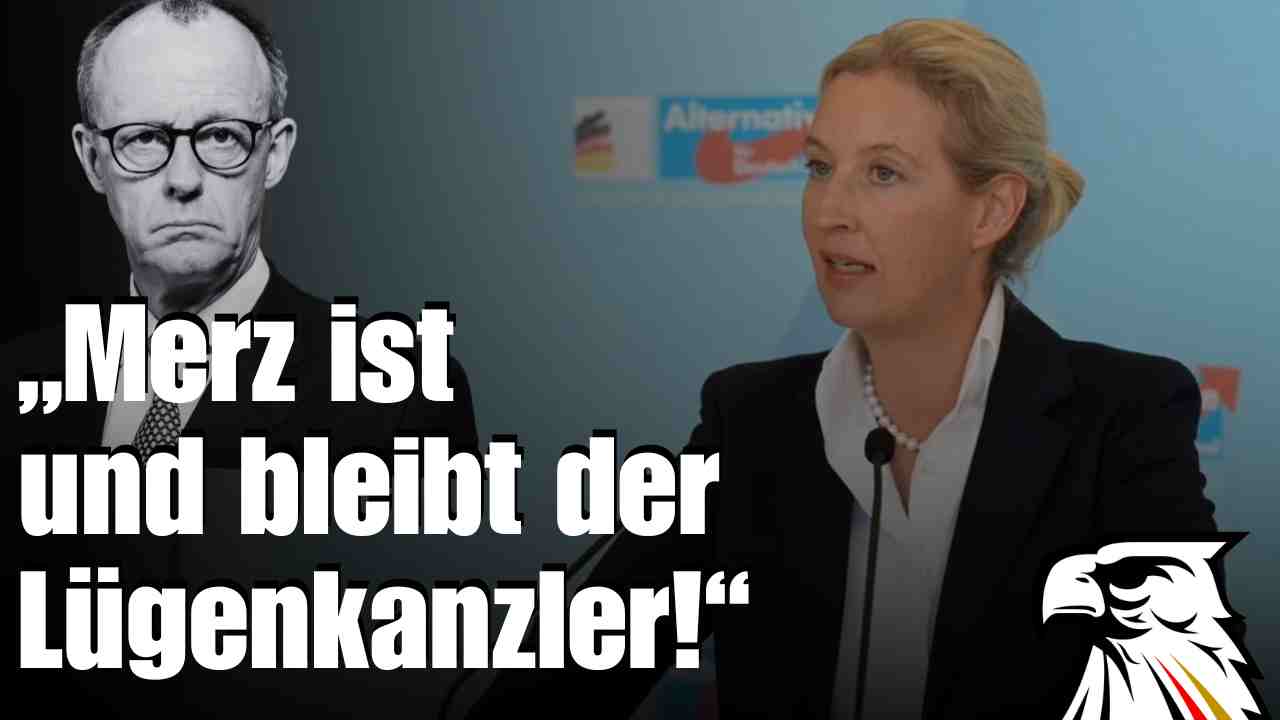







 FRANKREICH: Premierminister Bayrou verliert Vertrauensfrage! Droht Macron nun der Rücktritt? | LIVE
FRANKREICH: Premierminister Bayrou verliert Vertrauensfrage! Droht Macron nun der Rücktritt? | LIVE






























