
Der Technologieriese Bosch steckt in der Krise. Insbesondere der forcierte Umbau der Automobilbranche hin zur Elektromobilität bringt den Traditionskonzern zunehmend in Bedrängnis. Die nötigen Investitionen in neue Technologien sind hoch – die Erträge hingegen bleiben aus. Während chinesische Konzerne den Markt dominieren, verlieren Volkswagen, Mercedes & Co. global betrachtet an Boden. Was die Konzerne an Marktanteilen verlieren, kommt über sinkende Aufträge mit voller Wucht bei Zulieferern wie Bosch an.
Erschwerend wirken sich zudem die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik aus. Hohe Strompreise und eine überbordende Bürokratie treffen die Unternehmenslandschaft mit voller Härte. Wie ernst die Lage ist, zeigt ein Blick auf die Geschäftszahlen von Bosch: Der operative Gewinn (EBIT) ist im Jahr 2024 um ein Drittel eingebrochen – von 4,8 Milliarden Euro im Vorjahr auf nur noch 3,2 Milliarden Euro. Ein Rückgang, der die strukturellen Defizite am Standort Deutschland ebenso widerspiegelt wie die Folgen einer missglückten Industriepolitik.
Die angekündigten Sparmaßnahmen bei Bosch treffen die Werke in Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg) und Hildesheim (Niedersachsen) besonders hart. Ende 2024 hatte der Konzern einen weitreichenden Stellenabbau verkündet, der in den kommenden Jahren tiefe Spuren hinterlassen dürfte.
In Schwäbisch Gmünd befindet sich das Herzstück der Robert Bosch Automotive Steering GmbH – ein Unternehmen mit langer Tradition, das einst als Joint Venture mit ZF Friedrichshafen ins Leben gerufen wurde und sich heute zu den führenden Anbietern im Bereich Lenkungstechnik zählt. Im Zuge der laufenden Sparoffensive sollen bis 2027 etwa 1.300 der einst3.500 Arbeitsplätze wegfallen.
Ein Teil des Standorts wurde bereits abgewickelt und an ein Robotikunternehmen übergeben – ein erster Vorbote für das, was folgen könnte. Oberbürgermeister Richard Arnold (CDU) zeigt sich alarmiert. Angesichts weiterer angekündigter Einschnitte sei das Schlimmste zu befürchten. Auch Bosch-Personalchef Stefan Grosch schließt im „Worst Case“ eine komplette Schließung des traditionsreichen Werks nicht aus.
Die Zeichen stehen auf Rückzug: Angesichts der Pläne, Teile der Produktion vom Standort Schwäbisch Gmünd nach Ungarn zu verlagern, steht längst mehr als nur ein Teilumzug im Raum. Auch eine komplette Abwanderung erscheint zunehmend realistisch, vor allem da das osteuropäische Land mit deutlich „unternehmensfreundlicheren‟ Rahmenbedingungen lockt.
Allen voran sind es die massiv niedrigeren Lohnkosten, die den Ausschlag geben. Bosch-Finanzvorstand Harald Wilhelm machte keinen Hehl aus den Beweggründen: Einsparungen von bis zu 70 Prozent bei den Personalkosten seien ausschlaggebend für den Schritt. Und tatsächlich: Während der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland seit dem 1. Januar 2025 bei 12,82 Euro brutto pro Stunde liegt – das entspricht rund 2.220 Euro im Monat bei einer 40-Stunden-Woche, verdient ein ungarischer Mindestlohnempfänger mit rund 700 Euro monatlich nur einen Bruchteil davon.
Doch auch abseits der Lohnkosten punktet Ungarn mit einem unternehmerfreundlichen Klima: Die Körperschaftsteuer liegt bei lediglich 9 Prozent. Dies ist der niedrigste Satz in der gesamten EU. Zudem gilt eine einheitliche Einkommensteuer von 15 Prozent – unabhängig vom Verdienst. Des Weiteren sind die bürokratischen Hürden vergleichsweise niedrig, der Aufwand überschaubar. Für Bosch ergibt sich damit ein klarer Vorteil.




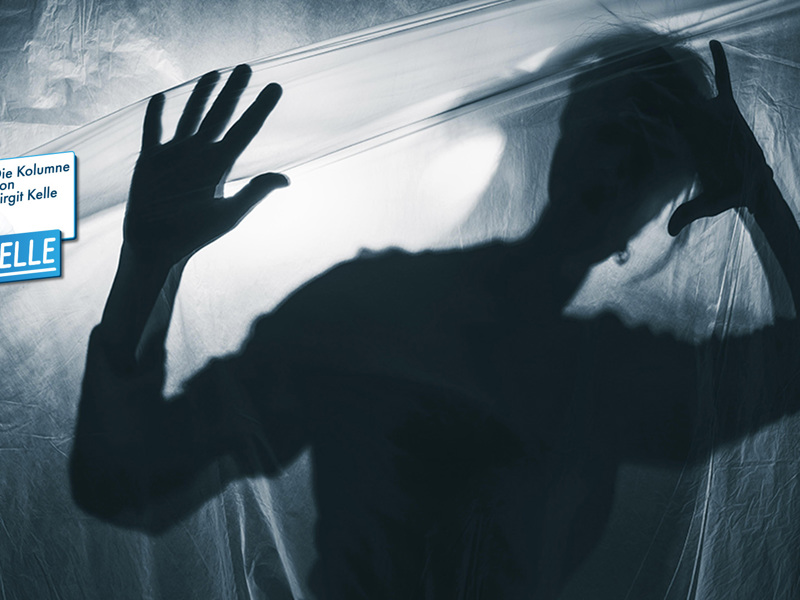



 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























