
Noch nie in ihrer Geschichte stand die Europäische Union vor derart epochalen Herausforderungen wie am Beginn des Jahres 2025. Wir erleben eine rasante Entwicklung der digitalen Technologien, schnelle Innovation, vielversprechende Firmengründungen und schnell wachsende digitale Großunternehmen, bei gleichzeitig geopolitischer Dynamik. Während die beiden Großmächte USA und China in einen knallharten Wettbewerb um die führenden Technologien unseres Jahrhunderts eingetreten sind, beschäftigt sich Europa mit dem Drehen ganz kleiner Schräubchen und verliert sich in einem Dickicht aus Bürokratie.
Die neue EU-Kommission hat bestenfalls noch 5 Jahre Zeit, wenn sie Augenhöhe mit USA und China wiedergewinnen möchte. 16 der neuen EU Kommissionäre (von 27) gehören der EVP Parteifamilie an, die Mehrheit für eine Kehrtwende ist vorhanden. Zuvor wurde in die völlig falsche Richtung gearbeitet. Sinnbildlich für diese fatale Entwicklung steht die EU-Kommission der letzten Jahre. Statt sich auf zentrale, strategische Integrationsprojekte zu fokussieren, die unsere Stellung in der Welt stärken, ist sie zur obersten Regulierungsbehörde mutiert. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte „Green Deal“, der nichts weiter ist als ein Deindustrialisierungsprogramm für Europa. Europa hat hier eine „Alleinstellung“, weil andere diesem Beispiel nicht gefolgt sind. Der „Green Deal“ fördert Technologien, in denen andere, vorzugsweise China, Marktführer sind (Wind, Solar, Lithiumbatterien, etc). Ein weiteres Beispiel ist die „Datenschutzgrundverordnung“ aus dem Jahr 2016, die einen erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass die EU in der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft global immer weiter zurückfällt. Und digitale Geschäftsmodelle, wie die der großen Plattformen, im Ansatz durch Bürokratie und Regulierung behindert oder gar erstickt hat.
Einer, der das erkannt hat, ist Friedrich Merz, der das System Brüssel noch aus seiner Zeit als EU-Abgeordneter kennt. Der Unions-Kanzlerkandidat sagte vor wenigen Tagen, Europa brauche einen „radikalen Bürokratieabbau“ und müsse jetzt „ans Eingemachte. Er sei nicht mehr bereit, „mit kleinen Schräubchen zu antworten auf große Fragen“.
Was sind die großen Fragen, die sofort auf die Tagesordnung der EU gehören? Hier sind die elf dringendsten Maßnahmen für die nächsten fünf Jahre:
Die nächste Bundesregierung muss der EU-Kommission gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs die Prioritäten neu ordnen: Erst Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Europa sichern, dann neue Regeln einführen. Derzeit harren weitere 12.000 von der EU verabschiedete Rechtsakte der Umsetzung in nationales Recht. Das ist Irrsinn! Die Ansage muss lauten: Alle neue EU-Regulierungen müssen nicht nur auf den Prüfstand sondern gestoppt werden, bis die Kommission die großen Themen zuerst abgearbeitet hat – also eine Umkehrung der Prioritäten.
Es ist elementar wichtig, dass das Mercusor-Abkommen mit den südamerikanischen Staaten zustande kommt. Genauso müssen wir die Gespräche über eine Freihandelszone mit den USA (TTIP) wieder aufnehmen. Es wäre nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch ein Signal an die Welt: Europa und die USA haben den klaren Willen, ihr Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell auch im 21. Jahrhundert zum globalen Maßstab zu machen. Ein Deal mit der neuen US-Regierung sollte möglich sein. Trump ist ein Dealmaker. Und er weiß: Ein guter Deal ist es dann, wenn beide Seiten profitieren. Europa sollte sich von diesem Pragmatismus inspirieren lassen.
Der viel gepriesene "Green Deal" hat sich als Wachstumsbremse und Bürokratiemonster entpuppt. Statt Zukunftsinvestitionen zu fördern, treibt er Europa in die Deindustrialisierung, gleichzeitig fördert und subventioniert er vorwiegend Technologien, in denen China weltweit führend ist (Solar, Wind, Batterien, elektrischer Antrieb etc.) Wir haben damit unsere gesamte Elektromobilität in die Abhängigkeit von China gegeben. Diese ist mittlerweile größer als es die von russischem Gas jemals war. Wenn die USA Batterien aus chinesischer Produktion sanktionieren sollte, dann hat die deutsche Automobilindustrie ein gravierendes Problem. – Ferner: der „Green Deal“ konnte mit der bestehenden Infrastruktur an Netzen- und Produktionskapazitäten niemals umgesetzt werden. Also muss eine zweite zusätzliche Infrastruktur errichtet werden, die für den Green Deal geeignet ist. Die hohen Kosten allerdings verteuern Strom für Industrie und Haushalte. Diese Fehlentwicklungen des „Green Deals“ sind zu stoppen. Die Infrastrukturkosten explodieren, während das Wirtschaftswachstum stagniert. Der "Green Deal" ist kein Deal – er fördert Deindustrialisierung. Europa braucht beim Umwelt- und Klimaschutz pragmatische Lösungen, denen auch andere in der Welt folgen, statt Luftschlösser.
Eine digitale Gesellschaft gibt es nur mit kostengünstiger Energie. Energie ist in Europa viel zu teuer. Das belastet die Industrie und die Bürger gleichermaßen. Eine McKinsey-Studie zeigte bereits 2004: Europa kann CO2-frei werden mit 50 Prozent erneuerbaren Energien und 50 Prozent Kernenergie. Solange aber die Hälfte der Mitgliedstaaten weiter auf Kohle setzt und Deutschland sich noch dazu seiner irrationalen Angst vor der Kernenergie hingibt, wird dieses Ziel nicht erreichbar sein. Der Vorrang von ideologischen Entscheidungen statt Technologieoffenheit hat uns international ins Abseits geführt. Unserer Energiepolitik folgt bislang keiner.
AI ist nicht nur ein Werkzeug, sondern eine neue Kraft, die Industrien, Regierungsapparate und digitale Wettbewerbsfähigkeit neu ordnet. Die EU reguliert Künstliche Intelligenz viel zu früh und zu restriktiv. Wir müssen KI entwickeln und wachsen lassen, bevor wir sie regulieren. Schon jetzt sehen wir die negativen Folgen der Innovationsfeinde in Brüssel: Technologien werden für Europa beschnitten, das iPhone 16 mit AI-Komponenten kommt womöglich (noch) nicht auf den europäischen Markt. Meta wiederum hat entschieden, seine LaMDA AI Software in dieser Form für Europa zunächst nicht zu öffnen, aus Sorge vor einem möglichen Verstoß gegen den Digital Services Act. LaMDA ist bislang die einzige Open Source AI Software. Wichtig für die Verfügbarkeit im wissenschaftlichen Bereich. So katapultieren wir uns selbst aus dem globalen Wettbewerb. Europa muss seine digitale Zukunft gestalten – nicht verhindern.
Europa hat leichtfertig seinen Wettbewerbsvorsprung bei der Verbrennungsmotor-Technologie aufgegeben. Dafür aber den „chinesischen Antrieb“ (also im Schwerpunkt die dominierenden Marktanteile bei Lithionenbatteren) ab 2035 zur Pflicht gemacht. Politiker aller Lager haben ernsthaft geglaubt (und einige glauben es weiterhin), Automobilhersteller und Zulieferer könnten mit staatlicher Regulierung zu Spitzenreitern in der E-Mobilität werden. Wenn das nicht funktioniere, so die weit verbreitete Auffassung, liege es an schlechten Managern in den jeweiligen Vorstandsgremien. Die Wahrheit ist: Europa ist mit Blick auf Rohstoffe, Volumina und Energiepreisen gegen China schlichtweg nicht wettbewerbsfähig. Die EU-Regulierung hat damit unsere künftige Mobilität in die Abhängigkeit von China getrieben. (Noch dazu nutzen chinesische Hersteller mittlerweile europäische Verbrennertechnologie, um erfolgreich Hybridfahrzeuge zu bauen.) Viel zu spät hat die EU diese Abhängigkeit erkannt und versucht gegenzusteuern: mit Northvolt sollte im Bereich Batterien diese Abhängigkeit begegnet werden. Northvolt endete in einem 15 Mrd Disaster. Ein weiteres Beispiel – neben Satelliten, Chips und Raketen -, dass EU Großprojekte nicht erfolgreich managen kann.
Ohne starke Kapitalmärkte bleibt Europa ein Innovationszwerg. Europaweite Verbriefungen und Syndizierungen müssen endlich umgesetzt werden. Start-ups und Zukunftstechnologien brauchen Kapital – schnell und unkompliziert. Die Überregulierung der Banken ist hierbei hinderlich. Eine europäische Bankenunion ist die Voraussetzung dafür. Vor allem Deutschland muss seinen Widerstand gegen eine europäische Einlagensicherung aufgeben. Ohne ausreichend Kapital gibt es kein ausbrechendes Wachstum in Europa – und damit auch nicht in Deutschland.
Europa droht auch im Weltraum abgehängt zu werden. Während ein einzelner Unternehmer wie Elon Musk über 6.000 Satelliten ins All geschickt hat (das Ziel sind 15.000), bringt es die EU gerade einmal auf 30 Satelliten (Galileo). Europa muss erkennen: wer den Weltraum beherrscht, beherrscht das Internet. Wir fallen in der Raketentechnologie weit zurück. Die verspätete Ariane 6 liegt technologisch in der SpaceX und Rocket Lab weit zurück. Als Europäer müssten wir den Anspruch haben, jedem Menschen weltweit ein kommerzielles Breitbandinternet zur Verfügung zu stellen! Dieses profitable Geschäftsmodell hat Europa vollständig verschlafen. Eigentlich unverzeihlich. Europäische Regierungen – zB Italien – benutzen nun Starlink für gesicherte Kommunikation im Regierungsapparat. Wie konnte Europa dies so weit kommen lassen? Andere Regierungen werden folgen. Möglicherweise auch die EU selbst. Großprojekte sind wichtiger als die populären „kleinteiligen“ Regulierungen. Und: Nur, wenn wir als Europäer eine starke Rolle im All spielen, werden wir in Zukunft noch in der Lage sein, uns militärisch gegen Aggressoren zu verteidigen. Der Drohnenkrieg, den wir in der Ukraine erleben müssen, zeigt dies deutlich: dort werden Drohneneinsätze durch Starlink gestützt und ermöglicht.
Europa kann nicht länger auf die USA als Schutzmacht vertrauen. Darüber hinaus ist Insbesondere Deutschland mittlerweile zum Zentrum der hybriden Kriegsführung durch Russland geworden. Wir müssen in den kommenden Jahren massiv aufrüsten, gemeinsame Rüstungsprojekte vorantreiben und ein effizientes, europäisches Beschaffungssystem aufbauen. Jedoch: wenn jedes EU-Mitgliedsland 2 oder 3 % investiert, aber wir es nicht schaffen gemeinsame Platformen zu entwickeln (bei Flugzeugen, Panzern, Drohnen, gesichertee Kommunikation, Navigationssystemen etc), dann stehen wir in fünf Jahren noch schwächer und unkoordinierter da als heute. Platformkoordination ist das Gebot der Stunde. Europa muss seine Ressourcen bündeln, statt in nationale Alleingänge zu investieren. Nicht zuletzt: Wenn wir unsere Außengrenzen nicht sichern können, werden offene Binnengrenzen in Europa langfristig nicht mehr möglich sein.
Europa hatte Anfang der 90er Jahre noch ca 40% Marktanteil an der weltweiten Chipproduktion. Heute sind es noch knapp über 8%. Wir sind noch immer ein signifikanter Spieler im Bereich über 20 Nanometer, unter 10 Nanometer spielen wir allerdings keine Rolle, obgleich hier die Zukunft stattfindet, sowohl wirtschaftlich als auch technologisch: Cloud Computing und Artificial Intelligence erfordern Hyperscale Datacenter. Die Anzahl ist weltweit über 1.000 gestiegen. Diese Datencenter sind auf der einen Seite enorme Energiefresser, gleichzeitig, aber konstruktiv für die digitale Gesellschaft. AI und Cloudcomputing sind schnell wachsende und hochprofitable Geschäftsfelder. Europa hat mit seiner Regulierungswut und der falschen Energiepolitik diese Geschäftsfelder stark behindert. Effekt: wir hängen in den Zukunftsmärkten der digitalen Welt massiv hinterher.
Die Demokratie in Europa muss auf den Pfad des Erfolges zurückgeführt werden. Die Gefahr besteht, dass sie durch fremde kulturelle Einflüsse von innen und außen gefährdet wird, indem der demokratische Konsens zerrissen wird. Die unkontrollierte Migration muss durch den konsequenten Schutz der Außengrenzen beendet werden. Ansonsten fehlt eine wesentliche Errungenschaft der EU: die offenen Grenzen und gefährdet unsere Demokratie von innen. Eine neue auf Wachstum abzielende Politik, die den Wohlstand der Bürger nährt und nicht durch Regulierungsarien einschränkt, ist Voraussetzung, dass Einflüsse von außen in ihrer Wirkung eingeschränkt werden können. Denn die Digitalisierung überspringt die Grenzen der Meinungsbildung. Wir müssen damit leben, dass internationale Akteure, wie Elon Musk auf X 211 Mio Follower hat, Mark Zuckerberg 118 Mio, 15 Mio auf Instagram, Trump 97 Mio auf X und weitere 8,5 Mio auf Truth Social auffahren lassen und ihre eigene Meinung digital verstärken können, und zwar grenzüberschreitend. Ob es uns gefällt oder nicht. Wenn wir erfolgreicher als andere sind, stört uns das wenig. Wenn wir stagnieren, fallen sie über uns her. Eine Regulierung hilft hier nur wenig, es sei denn, wir schalten die grenzüberschreitende Meinungsfreiheit ab.
Diese elf Punkte anzupacken und umzusetzen, ist ohne Zweifel eine Herkulesaufgabe. Sie ist jedoch jetzt gestellt. Nur wenn die EU groß denkt und sich radikal verändert, kann sie wieder in die Erfolgsspur kommen. Friedrich Merz hat als mutmaßlich nächster deutscher Regierungschef die Chance, zum Antreiber und Koordinator dieser Agenda zu werden. Wenn es ihm gelingt, kann er als ein großer Kanzler und noch größerer Europäer in die Geschichtsbücher einzugehen.
* Kurt Joachim Lauk (CDU) war Vorstands-Vize von Audi, Finanzvorstand von EON und als Vorstand verantwortlich für die Nutzfahrzeuge von Daimler. Nach seinem Lehrauftrag an der Stanford Universität in Kalifornien wurde er im Jahr 2000 Präsident des Wirtschaftsrates der CDU, welchen er 15 Jahre lang als Präsident führte.





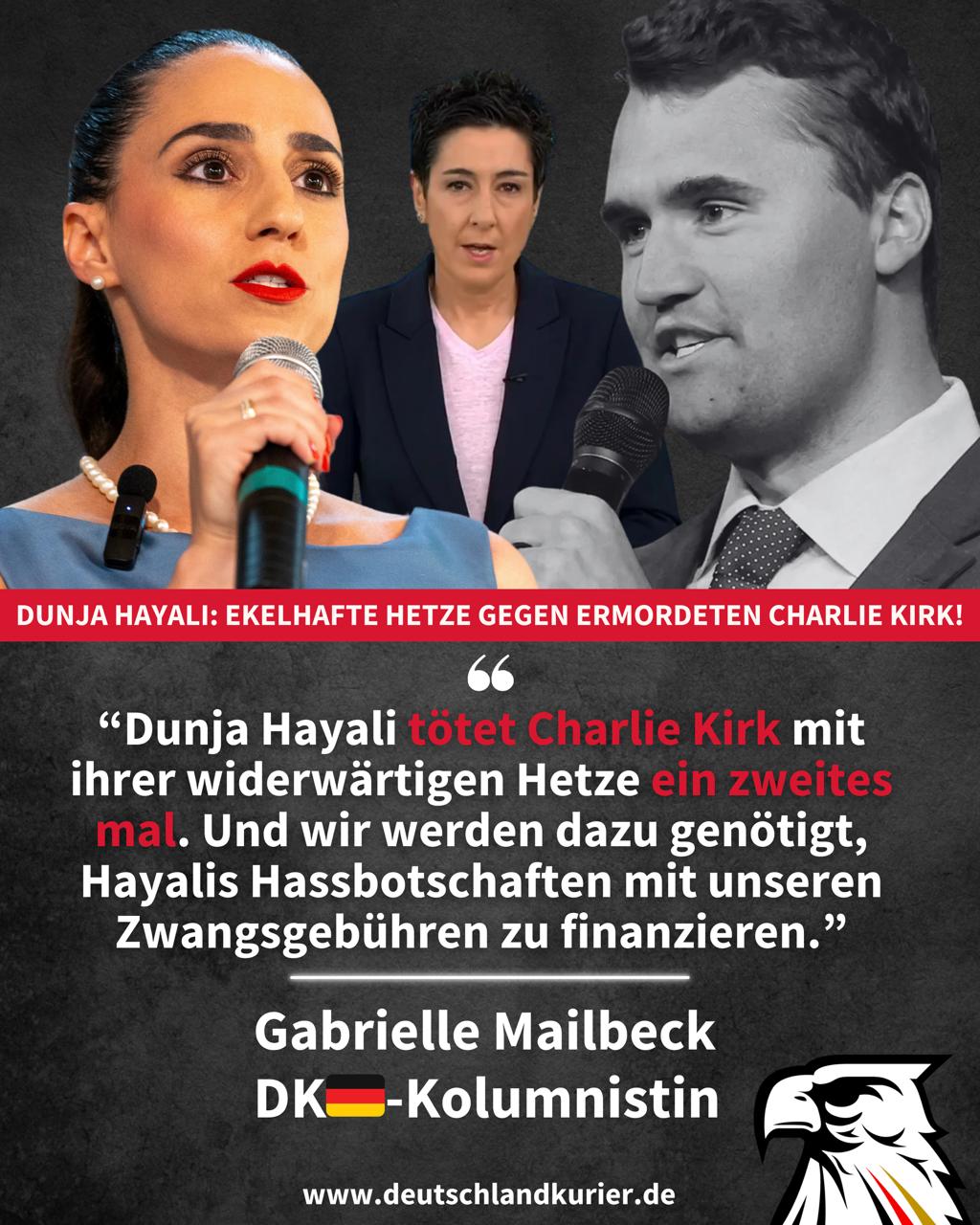




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























