
Die Lebenserfahrung lehrt, dass sich alles irgendwie wiederholt. Alles im Universum fließt – „panta rhei“, wie man die heraklitische Lehre zusammenfasst. Und Charles Darwin war klar, dass sich alles in einem kontinuierlichen Selektionsprozess befindet: „Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.“
Beide Prinzipien ergänzen sich. Während Heraklit den Prozess beschrieb, definierte Darwin die Konsequenzen: Langfristig können nur Dinge überleben, die mit den natürlichen Gesetzen und Prozessen im Einklang stehen.
Dies gilt für biologische und für gesellschaftliche Zusammenhänge. Das gilt aber auch für wirtschaftliche Zusammenhänge, wie beispielsweise für Entwicklungen auf Automobilmärkten bzw. in der Automobilindustrie. Und das seit ihrem knapp 150-jährigen Bestehen. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen von Herstellern und Marken. Alle Automobile, die nicht den Kundenwünschen entsprachen, sich also auf dem Markt nicht bewährten, sind verschwunden oder wurden von Stärkeren übernommen. Dieser Selektionsprozess findet auch heute noch statt.
Darwin ist universal, seine Gesetze der Selektion wirken nicht nur in Mega-Absatzmärkten wie China, sondern auch in Deutschland, sowie in einzelnen Unternehmen. Immer wieder blitzt durch, dass die obersten Entscheidungsträger und Gremien von Auto-Leuchtturm-Unternehmen bei Herstellern und Zulieferern offensichtlich „ihren Darwin“ im Biounterricht geschwänzt haben, oder dessen gnadenlosen Evolutionsgesetze grundsätzlich leugnen. Und partout in ihrer Modellpolitik gegen die Natur gearbeitet haben. In diesem Fall gegen die Wünsche ihrer Kunden.
Als Beispiele können Volkswagen und Daimler und ihre zeitweilig betriebenen Produkt- und Unternehmensstrategien genannt werden. Hier wurde ungeachtet dessen, was die Autokäufer als Endkunden eigentlich wollten, voll und einseitig auf Elektromobilität und Luxus gesetzt. Conti und ZF schlossen sich an. Und haben ganze Marktsegmente und ihre bewährte Verbrennertechnologie ohne Not zum Auslauf freigegeben. Was der Kunde aber partout nicht wollte. Jedenfalls jetzt und heute noch nicht angesichts der bekannten Komfort- und Kaufhemmnisse.
Bei allen Herstellern hat diese Strategie gegen den Markt die Bilanzen in die roten Zahlen gedrückt. Alle erlitten Schiffbruch. Aber anders als in China haben es alle überlebt, weil sie gestählt durch einen jahrzehntelangen Auslesewettbewerb gegangen waren und ihre Verbrenner nach wie vor die Kassen füllten. Und genau das Gleiche spielt sich gegenwärtig auf dem chinesischen Automarkt ab. Nur mit dem Unterschied, dass die Mehrzahl der Newcomer weder Verbrenner noch Finanzreserven haben. Der chinesische Immobilienmarkt hat zum Beispiel mit Evergrande bereits dasselbe Schicksal erlitten.
Die logische Folge nach Darwin: Alle chinesischen Autobauer befinden sich gegenwärtig in einer tödlichen Selektions- und Rabattschlacht. Der berühmt-berüchtigte Darwinsche Auslesewettbewerb ist in vollem Gange, den nach Meinung von Experten nur eine Handvoll Automarken überleben werden.
Die gegenwärtige Entwicklung am Automobilmarkt in China ähnelt verblüffend dem, was sich vor 100 Jahren im Deutschen Reich abgespielt hat.
Mitte der 90er Jahre entwickelte eine Gruppe von zehn führenden deutschen Großkonzernen unter der Führung von BMW, natürlich nicht ganz uneigennützig, für die chinesische Regierung einen General-Verkehrsplan. Die chinesische Regierung folgte dem in groben Zügen, setzte aber in den Folgejahren in Bezug auf den Aufbau einer eigenen Autoindustrie mehr und mehr auf Batterie-Elektromobilität. Weil sie zu der Erkenntnis gekommen war, dass China aus eigener Kraft an die Industrie im Westen mit der monopolartig-hochentwickelten 100-jährigen Verbrenner-Technologie so schnell nicht herankommen könne, da diese konkurrenzlos und damit unerreichbar war.
Die Zeit zum Aufbau einer eigenen Automobilindustrie hatte die chinesische Regierung nach der Öffnung 1989 nicht. Aber Lehrmeister in Sachen Autobau fand die chinesische Administration in westlichen Joint-Venture-Partnern reichlich. Alle namhaften westlichen Autohersteller standen Schlange, um Zugang zu diesem riesigen Markt zu bekommen. Das Resultat waren traumhafte Gewinne, die in der Heimat Wohlleben, soziale Annehmlichkeiten und Benefits erlaubten. Allerdings nur, solange die Geschäfte in China florierten. Bestes Beispiel hierfür ist VW.
China entwickelte sich danach auf staatliche Anordnung zum Eldorado für Speicherbatterien und Elektroautos. Nicht ohne Grund baute Tesla sein größtes Werk mit einer Million produzierten Fahrzeugen pro Jahr in Shanghai.
Die Strategie der chinesischen Regierung ging auf. Know-how im klassischen Autobau lieferten die Partner aus dem Westen. Das Bauen von Elektroautos selber war vergleichsweise einfach, wenn man die Batterietechnologie beherrschte. Das Bauen von Verbrenner-Motoren hingegen erfordert ein sich mühsam zu erarbeitendes Wissen und eine langjährige erfahrungsbasierte Entwicklung der Technologie, für die man Generationen von Ingenieuren gebraucht hätte. Die Designer kamen alle als emeritierte Führungskräfte aus dem Westen.
Von daher überrascht es nicht, dass die größten chinesischen Automobilhersteller als Handy-Hersteller aus dem Elektrik- und Elektronik-Sektor hervorgegangen sind. Jüngstes Beispiel ist Xiaomi. Innerhalb von nur zwei Jahren seit Markteintritt wurde das Unternehmen zum Wettbewerber Nr. 1 von Porsche auf dem Weltmarkt. Auch, weil das Konkurrenzprodukt nur die Hälfte eines Porsches kostet.
Inzwischen machen die sogenannten New Energy Vehicles (NEV) über 50 Prozent aller Neuzulassungen in China aus. In Deutschland sind es 18 Prozent. Insgesamt wurden 2024 rund elf Millionen E-Autos, Plug-in-Hybride, Range-Extended-Fahrzeuge und Brennstoffzellen-Autos verkauft. 2020 waren es noch 1,37 Millionen NEV gewesen.
Da auch Hybrid-Fahrzeuge gefördert wurden, erreichen NEV auch Regionen außerhalb von Großstädten, ohne flächendeckende Ladeinfrastruktur.
China hat allerdings auch stark in die Ladeinfrastruktur investiert und verfügt über 3,6 Millionen öffentliche Ladestationen, 70 Prozent aller weltweit verfügbaren Charger. Die meisten davon werden allerdings mit hochgiftigem Kohlestrom betrieben. Laden ist in China billig. Öffentliches Laden kostet nur etwa 1,50 Euro pro 100 Kilometer, teilweise ist die Kilowattstunde sogar für weniger als fünf Cent erhältlich. In Deutschland müsse man mit rund neun Euro pro 100 Kilometer rechnen, betont VW-China-Vorstand Brandstetter.
Last but not least: Ein E-Auto ist in China dank niedriger Anschaffungs- und Betriebskosten rund viermal günstig, so VW China-Chef Brandstätter.
Was sich am Markt für Elektroautos in den letzten dreißig Jahren in China abgespielt hat, ist vergleichbar mit dem Motorisierungsboom in der Gründerzeit des Deutschen Reiches. Dieser Boom setzte bereits etwa in den 1890er Jahren ein, und dauerte über den Ersten Weltkrieg hinaus bis in die Weimarer Republik hinein an: eine Zeit der Innovation und des Aufbruchs. In dieser Phase entstanden zahlreiche Unternehmen, die sich an der Entwicklung und Produktion von Verbrennungsmotoren und dem Bau von Automobilen versuchten. Im Jahr 1923 waren es über 90 Hersteller von Verbrennungsmotoren, eine Zahl, die in dieser Form später nie wieder erreicht wurde. Allerdings führte die Hyperinflation 1923 zu zahlreichen Konkursen, sodass sich die Branche in den folgenden Jahren konsolidierte.
Das ähnelt den Vorgängen in China: Zuerst vollzog sich hier in geradezu revolutionärer Form der Übergang vom Fahrrad zum Automobil, auch hier setzte ein Boom ein. Doch nun verschwinden die kleinen E-Auto-Anbieter, die Marktmacht der großen Vielmarken-Konzerne nimmt weiter zu.
In China ist die Datenbasis bezüglich der Anzahl von Autobauern aus der Anfangszeit des Automobil-Hypes ebenfalls unsicher. Fakt ist, dass der Gründerboom analog zu den 20er-Jahren in Deutschland rapide zu Ende geht.
Überall gibt es hohe Produktions-Überkapazitäten für Elektroautos, die von Experten für zwei-bis dreimal so hoch wie der aktuelle Jahresabsatz in China eingeschätzt werden. Überbordende Lagerbestände unverkaufter neuer E-Autos, die bei dem weltgrößten Hersteller BYD dem Vernehmen nach fast 400.000 Stück betragen sollen. Täglich neue Insolvenzen von chinesischen Autoherstellern. Deren Zahl ist nach Schätzungen von einstmals über 500 auf inzwischen unter 90 geschrumpft. Nach Meinung von Experten werden am Ende des Ausleseprozesses in China gerade einmal zwischen 5 und 10 große Automobilkonzerne überleben.
Der Rabatt-Wettbewerb in China bleibt noch lange gnadenlos. Der Gewinndruck wird noch eine Reihe von Jahren anhalten. Trotz aller Restrukturierungsbemühungen werden die deutschen Hersteller den alten Glanz nicht mehr erreichen. Überleben werden sie den tödlichen Verdrängungswettbewerb auf dem NEV-Markt nur, wenn sie auf dem Markt für Verbrenner weiter eine starke Stellung behaupten können. Oder sie geben ihre Selbständigkeit auf und schlüpfen mit ihren chinesischen Joint-Venture-Partnern unter den Schirm eines dortigen Großkonzerns.


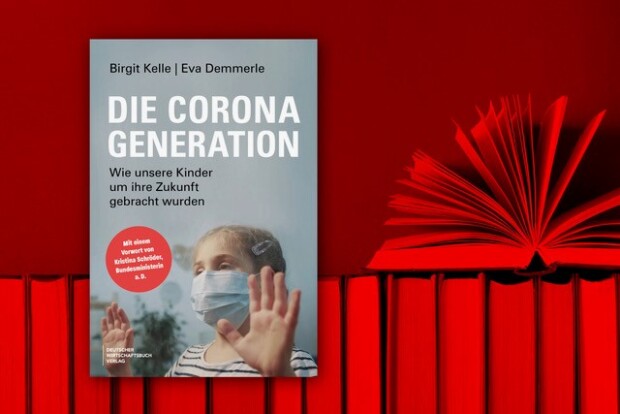





 USA: Donald Trump schickt nach Medewew-Drohung U-boote nach Russland! USA verliert Geduld | LIVE
USA: Donald Trump schickt nach Medewew-Drohung U-boote nach Russland! USA verliert Geduld | LIVE





























