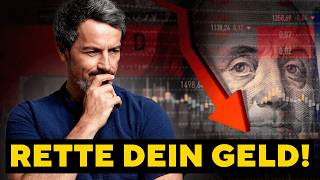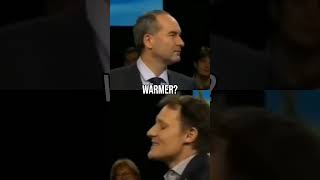Als „Verrat an der Ukraine“ wird aktuell Trumps Drang zu Friedensverhandlungen, gepaart mit so manch wirren Äußerungen in der ihm eigenen Art, bezeichnet. Dass die USA unter seiner Führung bei einer jüngsten Abstimmung über eine UN-Resolution zum Ukraine-Krieg vermeintlich moskaufreundlicher auftraten, gilt als weiterer Beweis.
All das ist aber am Ende nicht entscheidend. Was bei Trumps Ukraine-Deal am Ende herauskommt, ist das, was weitreichende Auswirkungen auf die Geo- und Sicherheitspolitik in Europa hat. Wie der Deal aussieht, kann aktuell aber keiner sagen. Statt Kaffeesatzleserei oder Hysterie wäre es dabei wichtig, ein paar Fakten anzuerkennen:
Punkt Nummer eins ist vor allem: Verhandlungen mit Russland sind keine Kapitulation. Und überhaupt: Jede Debatte rund um Friedensverhandlungen ist seit geraumer Zeit in Deutschland maximal verschoben – und maximal in einem Schwarz-Weiß-Denken gefangen. Die eine Seite, Fraktion Strack-Zimmermann könnte man sie nennen, bügelte die Aussicht auf Verhandlungen mit Russlands Machthaber seit Jahren mit dem stupiden Argument „Putin ist ein Kriegsverbrecher“, „Mit Putin kann man nicht verhandeln“, etc. ab. Dazu kommen dann noch Hitler-Vergleiche bzw. solche zum Münchner Abkommen. Tenor: Alles andere als ein totaler Sieg ist inakzeptabel und Appeasement.
Dabei müsste von Anfang an jedem klar sein, dass es eben nicht zu einem völligen Sieg gegen Russland kommen kann. Man wird nicht nach Moskau marschieren und dort eine bedingungslose Kapitulation der Russen erzwingen. Solche Gedanken sind völlige Traumschlösser. Auch wenn Putins Regime längst nicht so stabil sein mag, wie manch einer denkt – Prigoschins Wagner-Aufstand zeigte das – ist bei weitem nicht gesagt, dass selbst bei einem Regimewechsel in Moskau nicht ein größerer Hardliner an die Macht kommen würde.
Selbst im „Best-Case“-Szenario für die Ukraine – einer völligen Rückeroberung des eigenen Territoriums – müsste es einen „Verhandlungsfrieden“ geben. Selbst wenn mit konventionellen Truppen unterlegen – und auch das ist aktuell schließlich bei weitem nicht der Fall – hat Russland immer die Nuklearoption. Mit der muss man sich nicht erpressen lassen, wenn es um den Ukraine-Krieg selbst geht. Aber wenn es um einen erträumten Einmarsch nach Russland geht, wird sie sehr real – auf einmal ginge es um die Existenz des eigenen Staates und Regimes. Es gibt also kein Szenario einer russischen Kapitulation. Allein deswegen müsste es selbst im Fall eines haushohen ukrainischen Sieges einen verhandelten Waffenstillstand geben.
Viel wahrscheinlicher ist nach aktuellem Kriegsgeschehen aber natürlich ein auch für die Ukraine durchaus schmerzhafter Waffenstillstand. Das sind die Realitäten am Boden. Die russische Eroberung Kiews scheiterte, ebenso die ukrainische Rückeroberung des Donbas.
Nun gibt es die andere Seite, Fraktion Wagenknecht könnte man sie nennen, die pauschal „Diplomatie“ und „Frieden“ fordert. Dass es Frieden und Friedensverhandlungen geben muss, ist klar – das wird es auch im für die Ukraine schlimmsten Fall geben. Im „Worst-Case“-Szenario für Kiew eben in Form einer Kapitulation und Verhandlungen über Kapitulationsbedingungen.
Nur immer inhaltsleer „Frieden“ zu fordern, ist dabei kein konkreter Vorschlag und daher auch nichts weiter als ein plakativer Wahlkampfsprech gegen das Strohmann-Argument „Krieg“: Denn die Ukraine und ihre Verbündeten wollen schließlich auch Frieden. Auch der Invasor Russland will Frieden. Nur eben jeder zu seinen Bedingungen.
Allein Verhandlungen und „Diplomatie“ an sich beenden den Konflikt nicht – man muss nicht nur miteinander reden, man muss sich auch einigen können. Die Frage für den Westen ist also nicht: Mit Putin verhandeln oder nicht? Sondern welche Kompromisse man auf westlicher und ukrainischer Seite bereit ist einzugehen und auf welche Punkte man pocht.
Die Realitäten am Boden sind eigentlich klar: Seit Monaten gibt es keine größeren Verschiebungen der Frontlinien. Nur mehr Soldaten, die auf beiden Seiten sterben. Friedensverhandlungen dürften also auf ein faktisches Einfrieren dieser Linien hinauslaufen. Also territoriale Einbußen für die Ukraine.
Ist das dann ein westliches Einknicken vor Moskau? Nein, nicht zwingend. Dafür muss man sich einmal die Kriegsziele anschauen. Man erinnere sich etwa an 2022: Damals standen russische Truppen vor Kiew, im Westen flehte man Selenskyj an, aus der Hauptstadt zu flüchten, und rechnete mit einem russischen Sieg binnen weniger Tage. Es kam anders: Die Ukrainer konnten die russischen Invasionstruppen zurückschlagen. Nicht nur um Kiew, auch um Charkiw. Das von Russen eingenommene Cherson konnte die Ukraine zurückerobern. Russland schwenkte um, setzte statt einer Invasion des Westteils zunächst vor allem auf eine Konzentration der Truppen im Osten und schuf eine Landverbindung auf ukrainischem Boden zur Krim.
Putins ursprüngliches Kriegsziel, die Einnahme der gesamten Ukraine, scheiterte. Die Ukraine konnte entscheidende Teile der Invasion abwehren, kontrolliert nach wie vor den Großteil des Landes, verfügt weiterhin über einen Schwarzmeer-Zugang und hat die eigene Hauptstadt fest in der Hand, sodass dort inzwischen routinemäßig westliche Politiker zu Besuch kommen können – undenkbar noch zu Beginn des Krieges, als Selenskyj dort im Bunker saß und sich nur vereinzelt auf die Straßen trauen konnte. All das gelang, obwohl man es bei Russland mit einer einstigen Supermacht mit mehr als dreifacher Bevölkerung als Gegner zu tun hatte.
Auch trotz schmerzlicher Territorialverluste im wirtschaftlich starken Osten könnte man dies unterm Strich als Sieg verbuchen. Mit einer entscheidenden Voraussetzung: Dieser Krieg darf sich nicht wiederholen. Ergebnis kann nicht sein, dass Russland sich alle paar Jahre mit „pro-russischen Rebellen“ oder „militärischen Spezialoperationen“ Stück für Stück die Ukraine einverleibt. Es muss also harte Garantien geben, dass ein möglicher Waffenstillstand nicht nur eine Kampfpause ist, sondern ein wirkliches Ende des Konflikts.
Und solche Garantien können nicht nur aus einer Zusage Moskaus bestehen, da es sein Wort schon mehrfach gebrochen hat. Gerade deshalb pocht Selenskyj aktuell so sehr auf westliche Truppen oder eine NATO-Mitgliedschaft für die Zeit nach einem Friedensdeal. Genau hier wird der Krux der Verhandlungen liegen.
Denn Putin hat seine Kriegsziele verschoben: Er hat nicht mehr die gesamte Eroberung des Landes zur Priorität gemacht, sondern eine russische Kontrolle über weite Landstreifen im Osten. Im Fokus seiner öffentlichen Auftritte sind jetzt „berechtigte Sicherheitsinteressen“ Russlands, mit Blick auf eine Bedrohung durch ein weiteres NATO-Mitglied an der russischen Grenze.
Mit den eroberten ukrainischen Territorien schafft er jetzt bereits eine Art Pufferzone zwischen der westlich ausgerichteten Ukraine und Russland selbst. Trotzdem lehnt er eben eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ab – gerade das würde ja gegen die „Sicherheitsinteressen“ Russlands laufen, die er gerade vermeintlich verteidigt. Und solange Russland im Krieg mit der Ukraine ist, wird es auch keine NATO-Mitgliedschaft für das Land geben.
Wie sollen nun also die Sicherheitsgarantien aussehen? Und wie frei und souverän wird die Ukraine nach dem Krieg sein? Dürfte sie Bündnissen wie der NATO beitreten? Oder soll die Demarkationslinie am Ende von einer Art UN-Truppe, so unsäglich das auch sein mag, patrouilliert werden? Das sind die tatsächlich entscheidenden Fragen. Wie auch immer diese Sicherheitsarchitektur strukturiert wird – es dürfte komplex werden. Aber diese Detailfragen werden am Ende entscheiden, wie pro-westlich oder pro-russisch ein Friedensdeal wirklich ist. Es dürfte irgendwo in der Mitte liegen, die ungeklärte Frage ist nur: etwas näher an Moskau oder Kiew? Das hängt vom Verhandlungsgeschick beider Seiten ab und dem Kräfteverhältnis an der Front.










 NAHOST: Israel meldet erneuten iranischen Raketenangriff auf Tel Aviv und Jerusalem | LIVESTREAM
NAHOST: Israel meldet erneuten iranischen Raketenangriff auf Tel Aviv und Jerusalem | LIVESTREAM