
Papst Franziskus ist am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Wochenlang hatte der Argentinier an den Folgen einer schweren Lungenentzündung gelitten. Zum Osterfest konnte Franziskus (bürgerlich: Jorge Mario Bergoglio) ein letztes Mal den berühmten Segen „Urbi et Orbi“ spenden. Ein Nachruf auf das verstorbene Oberhaupt der katholischen Kirche.
Am Ostersonntag segnete Franziskus ein letztes Mal die Gläubigen.
Wer war Papst Franziskus?
Um das Pontifikat von Papst Franziskus zu verstehen, muss man zunächst das Amt des Papstes verstehen. Der Bischof von Rom ist nicht irgendein besonderer Verwaltungschef, sondern „Vicarius Christi“ – Stellvertreter Christi. Erst Papst Franziskus wertete dies im „Annuario Pontificio“, dem Jahrbuch des Heiligen Stuhls, 2020 zum „historischen Titel“ ab. Der Papst ist Nachfolger Petri, dem ersten aller Apostel, dem Jesus Christus persönlich die höchste universale Gewalt über die Kirche verlieh. Päpstliche Aussagen sind unfehlbar, allerdings nur, wenn er sie ex cathedra verkündet. Und die Kirche ist hierarchisch, allerdings sind die an Stelle der Apostel getretenen Bischöfe die wichtigsten Bezugspersonen für einen Katholiken.
Damit wären wir auch schon bei zwei wichtigen Punkten angelangt, die wissen sollte, wer über die katholische Kirche, das Papstamt und den nun im Alter von 88 Jahren verstorbenen Papst Franziskus urteilt. In dem, was der Pontifex in einem Interview äußert und was er als privater Theologe schreibt, ist er eben nicht unfehlbar.
Andererseits hat alles, was der Papst tut – ja selbst wie er sich kleidet und wo er wohnt – eine politische Implikation. So war es denn auch im Jahr 2013 ein bewusster Bruch mit der Kurie, als der soeben zum Papst gewählte Jorge Mario Bergoglio sich auf dem Petersplatz nicht mit päpstlicher Mozetta (bis zum Ellenbogen reichender Schulterkragen) und Stola (verzierter Stoffstreifen) zeigte und später nicht in den Apostolischen Palast einzog, sondern ins vatikanische Gästehaus Santa Marta. Franz-Kritiker deuteten das bereits als klares Zeichen gegen die kirchliche hierarchische Ordnung und eines falschen Gleichheitsbestrebens.
Papst Franziskus trat 2013 mit ungewöhnlicher Kleidung vor die Gläubigen.
Damit war der Ton gesetzt, den das Franziskus-Pontifikat mal gemächlich, mal fanfarenartig zwölf Jahre lang begleiten sollte: der Einsatz für die Armen und Unterdrückten der Welt. Die erste traditionelle Fußwaschung führte er in einer Jugendstrafanstalt unter anderem mit Moslems durch. Ebenfalls 2013 besuchte er die Insel Lampedusa, einem der Ankerplätze der italienischen und später auch deutschen Flüchtlingskrise.
Der Kritik an restriktiver Migrationspolitik blieb sich Franziskus stets treu. Noch vor wenigen Wochen kritisierte er die Abschiebepläne des wiedergewählten US-Präsidenten als „große Krise“ für die Vereinigten Staaten. Zwar müsse man das Recht einer Nation anerkennen, die Bevölkerung vor Kriminellen zu schützen. Menschen abzuschieben, die ihre Herkunftsländer aufgrund von extremer Armut, Unsicherheit oder Ausbeutung verlassen hätten, verletze jedoch deren Würde.
Der Zweck heiligt nicht die Mittel, lautet ein katholischer Grundsatz. Demnach kann das Ziel, Menschen der südlichen Halbkugel aus ihrer wirtschaftlichen Misere zu erretten, nicht damit gelöst werden, sie millionenfach auf andere Kontinente zu verpflanzen und dort die soziale Ordnung zu gefährden.
Armut und Ausbeutung: Zwei Schlagworte, die Papst Franziskus’ Denken und Handeln leiteten. Der in Argentinien geborene Jesuit machte keinen Hehl aus seiner antikapitalistischen Haltung. In seiner Autobiografie lobte der Sohn italienischer Einwanderer die Kommunistin und Atheistin Esther Ballestrino de Careaga. Er bekannte sogar, sie sei eine politische Lehrerin für ihn gewesen.
Politisch hoch unsensibel agierte Franziskus 2018 in China, als der Vatikan ein Geheimabkommen mit der Kommunistischen Partei schloss und die jahrzehntelange Spaltung der chinesischen Katholiken in eine staatlich anerkannte und eine verfolgte Untergrundkirche aufzuheben schien, damit aber in den Worten des ehemaligen Bischofs von Hongkong, Joseph Kardinal Zen, einen „Ausverkauf“ der katholischen Kirche in China vollzog.
Franziskus entstammte dem als papsttreu geltenden Jesuitenorden, dem er 1958 beigetreten war. Er war nicht nur der erste Lateinamerikaner, sondern auch der erste Jesuit im Papstamt. Doch schon als Kardinal vermied er es tunlichst, nach Rom zu reisen. Prunk und Pomp, das war seine Sache nicht, ließ sich lieber im Fiat herumkutschieren statt im Mercedes. Freilich brachte das selten finanzielle Ersparnisse, da ja die Sicherheitsvorkehrungen erhöht werden mussten, sondern waren symbolischer Natur, Imagepflege in den Medien.
Einfacher Fiat statt protziger Mercedes
Die Gesellschaft Jesu, wie der apostolische Orden eigentlich heißt, war einst die schnelle Eingreiftruppe der Kirche, eine geistliche Elite, bekannt für ihre Missions- und Bildungsarbeit. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erwehrten sich jedoch auch die Jesuiten nicht der Befreiungstheologie – in Argentinien gewann die leicht davon variierende „Theologie des Volkes“ an Bedeutung –, die in den lateinamerikanischen Ländern teils sozialistische Gedanken in die Kirche trugen.
Während Franziskus es in politischen und ökonomischen Fragen an Klarheit nie missen ließ, war das bei seinen Lehrschreiben, Dekreten und anderen Dokumenten anders. Immer wieder irritierte der Papst – bewusst oder unbewusst – mit unpräzisen, mithin ambiguen Äußerungen. So etwa beim Umgang mit Transgender-Personen, der Erklärung „Fiducia supplicans“ hinsichtlich der Segnung homosexueller Paare, oder wenn er in „Laudato si’“ schrieb, man müsse „in einigen Teilen der Welt eine gewisse Rezession akzeptieren“, um andernorts einen Aufschwung zu ermöglichen – dem Klima und der Umwelt zuliebe.
Auch, dass Franziskus in den Augen seiner konservativen oder traditionalistischen Kritiker den Menschen überhöhte und die Bedeutung von Gott, Glaube und Erlösung in den Hintergrund rückte, etwa bei der Erklärung „Dignitas Infinita“ oder der Unterwerfung unter das Corona-Regime durch die „Green Pass“-Regelung, sorgte für Fragezeichen und Unmut.
Der oft großväterlich-gutmütig lächelnde Papst hatte unzweifelhaft ein gewisses Charisma, doch eine glückliche Hand in der administrativen Führung der Kirche hatte er nicht. Bei der Bewältigung der Missbrauchsskandale fabrizierte er kurzerhand neue Skandale. Noch zu Lebzeiten seines Vorgängers Benedikt XVI. riss Franziskus dessen Herzensprojekt einer Aussöhnung mit der „alten“ Messe mit der Motu proprio „Traditiones custodes“ nieder. Er entließ Kurienmitarbeiter fristlos, vermutete innerkirchliche Widersacher, was auch ein Grund dafür war, dass ihm die linken, oft geradezu verzückten Medien seine Umbaupläne für die Kurie nie ganz abkauften. Es brachte ihm sogar die Zuschreibung als „Diktator-Papst“ ein.
Und doch, bei aller gebotener Kritik, bewies auch dieser Papst, dass es Schwarz und Weiß beim Menschen nicht gibt. Denn so sehr ihn die linken Medien und Kulturleute ob seiner progressiven Linie in publizistische Höhen hoben, so unverhohlen fühlten sie sich vor den Kopf gestoßen, als der Papst katholisch blieb bei einem der drängendsten Themen unserer Zeit: der millionenfachen Abtreibung.
In gebotener Regelmäßigkeit verglich Franz Abtreibungen mit Auftragsmord. Seinen progressiven Anhängern rief er entgegen: „Es ist nicht fortschrittlich, sich einzubilden, die Probleme zu lösen, indem man ein menschliches Leben vernichtet.“ Er betonte, und das ist für das säkularisierte 21. Jahrhundert vielleicht besonders relevant, dass Abtreibung kein allein religiöses Problem sei, sondern ein menschliches.
Obwohl ein Kritiker der Einwanderungspolitik von Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni trat Franziskus 2023 zusammen mit der rechten Politikerin auf einer Konferenz über die sinkenden Geburtenraten auf. Mitten auf der Bühne segnete das Kirchenoberhaupt hochschwangere Frauen, ehe er von einer fröhlichen Kinderschar umringt wurde. Auch das war Papst Franziskus.
Sein letzter öffentlicher Auftritt am Ostersonntag
Was bleibt von ihm? War er ein Lehrer? War er ein Versöhner? War er ein Frommer? Es gibt gute Gründe, ihn wie Kardinal George Pell als Schwächer der Lehre zu bezeichnen. Es gibt gute Gründe, ihn dank seiner Synoden als Spalter einzustufen. Es gibt auch gute Gründe, die Ernsthaftigkeit seiner Glaubensüberzeugung zu bezweifeln, wenn man an seine Äußerungen während der Asienreise vergangenes Jahr denkt. Vor Jugendlichen in Singapur hatte er behauptet: „Alle Religionen sind ein Weg zu Gott. Sie sind wie verschiedene Sprachen, verschiedene Idiome, um dorthin zu gelangen. Aber Gott ist Gott für alle.“
Vielleicht wird Franziskus schlicht als Papst der Armen, als den er sich gern gesehen hat, als Papst der Medien und als Papst der Verwirrung in einer Zeit der Verwirrung in die Geschichte eingehen. Einer Zeit, die sich durch weitere Säkularisierung und Ersatzreligiosität noch zuspitzen wird. Wie ein Fels soll ragen, kantig und fest, das Haupt der Kirche bis ans Ende der Zeit.
Wie Papst Leo der Große schon vor 1.600 Jahren schrieb: „Wie für immer besteht, was in Christus Petrus geglaubt hat, so besteht für immer, was in Petrus Christus eingesetzt hat.“
***Lukas Steinwandter ist Chefredakteur des christlichen Onlinemagazins „Corrigenda“









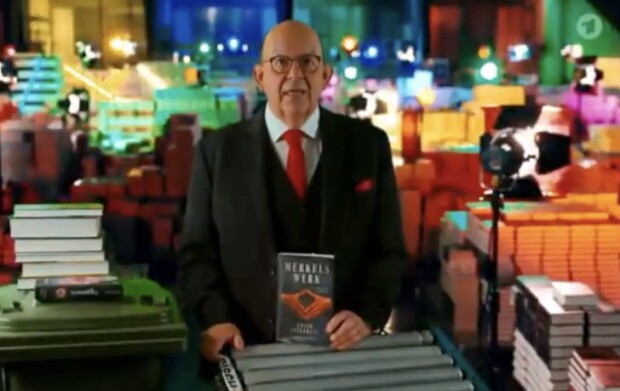
 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























