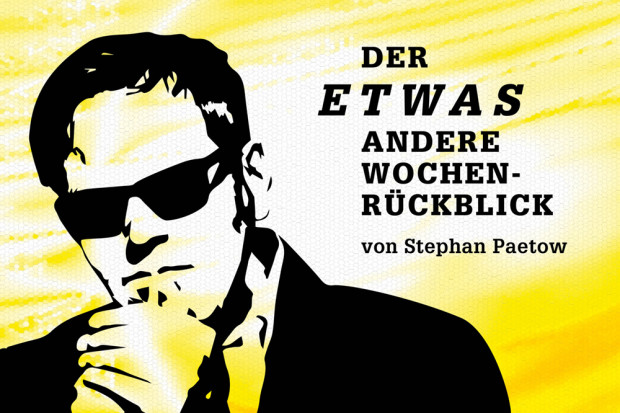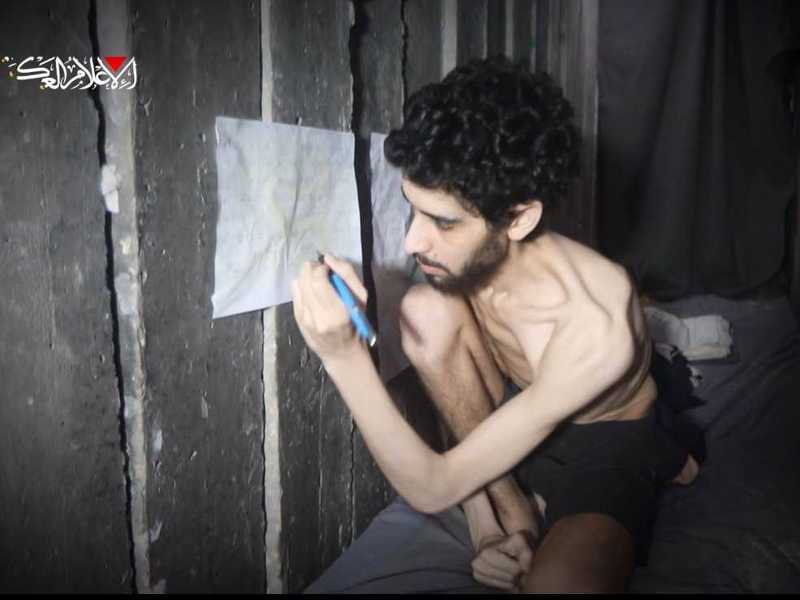„In einer Stadt ist der gesamte Erdkreis zugrunde gegangen“ schreibt Hieronymus in einem Brief im Jahr 410; beim Diktieren würde sich Schluchzen in seine Stimme mischen. Das „strahlendste Licht aller Länder“ sei ausgelöscht. Alarichs Goten hatten Rom geplündert. In der zeitgenössischen Rezeption ist diese Nachricht gleichzeitig unvorstellbar und der Vorbote einer Dunkelheit, die die Welt umspannen wird. Roms merkwürdiger Tod ist bis heute eines der vielleicht größten Rätsel der Geschichte. Auch für Zeitgenossen war der Tod des eigentlich ja gottgegebenen, unsterblichen, unfehlbaren Imperiums nicht weniger rätselhaft; sie verstanden ihn vermutlich noch weniger als wir heute.
Seit im Jahr 146 v. Chr. Karthago im dritten punischen Krieg zerstört wurde, war das römische Reich unangefochtenes Imperium seiner Welt. Bis zum Ende Westroms sind das immerhin 588 Jahre. Das ist eine längere Zeitspanne, als seit dem Untergang Ostroms mit dem Fall von Konstantinopel von heute aus gerechnet vergangen ist. Und doch fiel Rom – warum?
Es gibt unzählige Theorien: die allgemeine Dekadenz ist sprichwörtlich geworden, aber auch Korruption, Klassengegensätze, Zerstrittenheit und Inflation sollen herhalten. Während ältere Forschung vor allem die inneren Schwächen als ursächlich betrachtet, will die neuere Forschung die allgemeine Bedeutung Roms und des Bruchs danach eher relativieren und kleinreden.
Schon die Plünderung der Stadt Rom zeigt uns drei interessante Punkte: Nicht nur Alarich, Führer der Goten, war germanischer Abstammung, sondern auch sein römischer langjähriger Widersacher Stilicho. Zweitens war es eine der zivilisiertesten Plünderungen, die eine Stadt gesehen hat. Die christlichen Westgoten verschonten christliche Tempel, ihr Anführer Alarich marschierte bereits zum vierten Mal auf Rom, dreimal verzichtete er darauf, die Stadt einzunehmen, und forderte stattdessen lediglich Rechte für sein Volk und Privilegien für sich.
Erst als ihm das verwehrt wurde, ordnete er zögerlich die Plünderung an. Und drittens: Der Fall der Stadt kam für römische Verhältnisse sehr plötzlich. Im Jahr 376 – 34 Jahre vor der Plünderung – schien das Reich fast noch auf dem Höhepunkt seiner Macht. Vom Hadrianswall an der Grenze zu Schottland bis ins heutige Syrien, von der Atlantikküste Afrikas bis ans Schwarze Meer beherrschte ein mächtiger bürokratischer und militärischer Apparat für diese Zeiten unvorstellbare 70 Millionen Menschen.
Der britische Historiker Peter Heather zeigt, dass die innere Verfassung des römischen Reichs im Jahr 376 nach Christus jedenfalls besser war, als vielfach angenommen. Trotz der aufwändigen Perserkriege und der deutlichen Erhöhung der Steuern florierte im 4. Jahrhundert die Landwirtschaft. Auch die Romanitas, das römische Selbstverständnis in Kultur und Bildung, war ungebrochen. Immer noch galt es als höchste Form der Moral, die klassische Erziehung zu genießen, bei der man jahrelang komplexes Latein lediglich auf Basis von vier Autoren lernt. Auch das römische Heer war nicht geschrumpft, und seine Kampfkraft schien weiterhin hoch.
Das Imperium hatte sich in vielfacher Hinsicht transformiert – von der Republik zum Kaiserreich; man hatte sich von den alten Göttern ab- und dem Christentum zugewandt; schließlich wurde die Macht unter verschiedenen Herrschern aufgeteilt und das Reich damit in eine Ost- und Westhälfte geteilt. Das eigentliche Zentrum ist längst nicht mehr Rom – die Kaiser sitzen in Konstantinopel oder Trier, Mailand oder Ravenna. Vom nach Außen gekrempelten Imperium ist die Rede – das Imperium hat derart unvorstellbare Ausmaße, dass sich die Kaiser einen Sitz in der Nähe der Grenzgebiete zulegen mussten, weil diese kritischen Bereiche aus Rom nicht hätten koordiniert werden können.
Doch keiner dieser Faktoren scheint das Reich wirklich stark beeinträchtigt zu haben – das Christentum ersetzte die alten Götter fast reibungslos und wurde ohnehin stark romanisiert, das heißt an die Erzählung und Ideologie des Reiches angepasst. Die Teilung war eine bürokratische Notwendigkeit – es bedurfte monatelanger Reisen, um überhaupt nur Informationen von einem Teil in einen anderen des Reiches zu bringen. Genauso erklären sich die neuen Hauptstädte – dieses Reich war mit damaligen Mitteln nicht mehr aus Rom heraus regierbar. Oft werden die Varusschlacht oder der Brand Roms unter Nero bereits als Vorboten des Untergangs gedeutet – dafür gibt es allerdings wenige faktische Anhaltspunkte.
Insofern ist zu Beginn der Frage nach dem Untergang Roms zunächst festzuhalten: Das eigentlich Bemerkenswerte ist, wie lange und wie konstant Rom in der Lage war, sein Reich auf einem konstanten Niveau zu erhalten und verschiedene Transformationen unbeschadet zu bewältigen. Der blitzartige Untergang wird dadurch allerdings umso rätselhafter.
Die unmittelbare Abfolge ist brachial. Im Jahr 376 tauchten die Terwingen und Greutungen (später nennt man sie Westgoten) an der Donau auf, etwa 200.000 Menschen mit Frauen und Kindern schätzt man – sie bitten um Einlass ins Reich. Es ist ein Schock. Der östliche Kaiser Valens bereitet sich gerade auf einen Feldzug in Persien vor und hat sich bereits zu eindeutig nach Osten orientiert. Vermutlich äußerst widerwillig stimmt er zu, die Terwingen ins Reich zu lassen – die Greutungen allerdings sollen nördlich der Donau bleiben, er will die Gruppen spalten.
Valens allerdings verzichtet auf die totale Unterwerfung der Terwingen, was sonst üblich gewesen wäre. Es endet schnell in einem Desaster: Von Anfang an agieren Terwingen und Greutungen gemeinsam, die Terwingen verlangsamen ihren Marsch, sodass sie den Greutungen ihrerseits den Gang über die Donau ermöglichen. Die lokale Elite arrangiert sich nicht mit den Migranten und schnell entsteht Versorgungsknappheit bei diesem ganzen Volk auf Wanderschaft. Es kommt zum Krieg zur ungünstigsten Zeit.
Valens muss einen überhasteten Frieden mit Persien aushandeln, um seine Truppen auf den Balkan zu richten, eine Verstärkung aus Westrom wird aufgehalten, weil es auch am Rhein brodelt. Schließlich kommt es bei Adrianopel zum historischen Desaster: Ein römisches Heer wird vernichtend geschlagen. Schon das ist seit Jahrhunderten undenkbar – der Sieg Roms ist nach damaliger Ideologie Gottes Wille. Schließlich gerät der Balkan unter Kontrolle der Goten, alle darauffolgenden Entwicklungen werden durch das ungelöste Gotenproblem verursacht oder zumindest dramatisch verschärft.
Die Ursache dieses Desasters ist das plötzliche Auftauchen der Hunnen auf dem europäischen Schauplatz – jenes analphabetische Reitervolk, über das wir aus diesem Grund bis heute kaum etwas wissen, weder zur inneren Beschaffenheit noch zur Herkunft. Fakt ist, dass sie im vierten Jahrhundert aus der eurasischen Steppe nach Osteuropa kommen. Ihre überlegene Kampfkraft – unter anderem durch einen übergroßen Bogen – löst die Völkerwanderung aus und treibt ganze germanische Stämme ins Römische Reich.
Nach dem Festsetzen der Goten auf dem Balkan gibt es kein Halten mehr: Auch die Westgrenze wird überschritten. Immer weitere germanische Völker fliehen vor den Hunnen und dringen mit der Macht der Verzweiflung auf römisches Staatsgebiet. Die Vandalen ziehen durch Gallien, nehmen sich Spanien. Angeheizt durch weitere interne Machtkämpfe und Usurpationsversuche kollabiert das Westreich in rasender Geschwindigkeit.
Doch die eigentliche Katastrophe ist noch nicht die manierliche Plünderung Roms durch Alarichs Goten im Jahr 410, die das Reich noch einigermaßen übersteht. Es ist die Eroberung Nordafrikas durch die Vandalen 429. Die nordafrikanischen Provinzen waren die reichsten des Westreichs und versorgten insbesondere die Stadt Rom mit Getreide; als das verloren ging, war der westliche Teil des Reiches kaum mehr handlungsfähig. Ab dann konnte das Reich die Armee nicht mehr voll unterhalten, die notwendig gewesen wäre, um die multiplen Krisenherde dauerhaft zu befrieden.
Ab dem Eintritt der Goten ins Reich musste die römische Führung einen Paradigmenwechsel vornehmen – war zuvor die einmalige Stärke des Reiches, alle Völker und Einwanderer vollständig zu romanisieren und in die Kultur und Lebensweise des Reiches zu integrieren, sie vollkommen zu unterwerfen, so agierte das Reich jetzt vielmehr mit einer Strategie der Eindämmung. Dabei war die römische Führung nicht unbedingt ungeschickt.
In der Spätphase des Reiches brachte allein das Westreich mit Stilicho, Constantius III. und Flavius Aëtius drei Heerführer hervor, deren Handeln als relativ fähig und strategisch klug angesehen werden kann und denen es jeweils gelang, eine Gemengelage an der Grenze der Anarchie in ein kurzfristiges Gleichgewicht zu bringen. Rom hatte seine innere Kraft auch hier noch nicht verloren – immer wieder gelang es, die eingewanderten Völker einzudämmen und unterzuordnen und auch zahlreiche Bürgerkriege und Usurpationsversuche beizulegen. Als um das Jahr 450 die Hunnen unter Attila selbst mit einer gewaltigen Horde, auch aus unterworfenen Germanen, ins Reich einfielen und Gallien und Norditalien plünderten, gelingt Heerführer Aëtius ein letzter Triumph, der scheinbar unbesiegbare Hunnenkönig – die „Geißel Gottes“ – wird vom römischen Heer geschlagen.
Attila stirbt, sein Reich zerfällt – es ist eine Ironie der Geschichte, dass das geschwächte, sterbende Westrom das Reich der Hunnen (dessen Aufstieg Rom letztlich zu Fall brachte) überlebt hat. Dreimal versucht Westrom dann, die strategisch entscheidenden Provinzen Nordafrikas, die Kornkammern des Reiches, zurückzuerobern. Und auch Konstantinopel ist bereit, mit enormen Mitteln zu unterstützen.
Schließlich investiert Konstantinopel noch im Jahr 468 fast die gesamte Staatskasse für die Aufstellung einer Armee, die auf über 1.000 Schiffen nach Nordafrika segeln soll. Ein Sieg dieser Flotte in Afrika hätte durchaus eine Stabilisierung des weströmischen Reiches zur Folge haben können. Stattdessen folgt die endgültige Niederlage auf See gegen die Vandalen. Acht Jahre später wird der letzte Kaiser Romulus Augustulus abgesetzt, der oströmische Kaiser Leon erkennt die Herrschaft Odoakers als König von Italien an. Im Jahr 476 ist alles aus.
Im Ergebnis lassen sich vor allem zwei innere Schwächen Roms aufzeigen, die unzweifelhaft sind. Der erste ist die Schwäche des politischen Systems: Die Kaiserwürde und insbesondere der Machtwechsel war nicht klar geregelt und nach fast jedem Machtwechsel, auch in der Spätphase, folgte ein jahrelanger Machtkampf mit jeweils blutigen Auswirkungen. Nur in kleinen dynastischen Episoden war der friedliche Machtwechsel möglich.
Auf der anderen Seite ist die unter anderem von Max Weber gezeigte wirtschaftliche Schwäche des Reiches entscheidend. Während man in den Spitzen zwar zu unglaublichen Leistungen imstande war – vom Straßenbau, über Aquädukte zu Zentralheizungen – gelang es nicht, die Landwirtschaft in schwerem Boden zu intensivieren.
Die Landbevölkerung lebte nahe der Subsistenz in relativer Stagnation, weswegen das Aufrechterhalten der urbanen Spitzen und des gewaltigen Heeres eine Kraftanstrengung war, die das Reich immer schon latent überforderte. Allein um die Stadt Rom zu versorgen, war ein riesiges, anfälliges logistisches System über das gesamte Mittelmeer notwendig. Gerade in Krisenzeiten waren die Regierungen stark eingeschränkt: Die Mobilisierung neuer Truppen gegen die Perser im dritten Jahrhundert brachte das ganze Reich durch starke Steuern und Inflation stark unter Druck; als die Völkerwanderung begann, fehlten Westrom schlichtweg die Mittel, eine Armee von ausreichender Größe zu mobilisieren.
Hintergrund dieser systematischen Schwäche des Reiches war die Wirtschaftsstruktur – obwohl Rom durch unter anderem das Bankwesen als Ursprung des Kapitalismus gilt, war das Reich insgesamt eine Kommandowirtschaft, bei der der Staat willkürlich eingriff, Preise festsetzte und Privilegien verteilte. Reichtum entwickelte sich weniger durch unternehmerischen Erfolg als durch politische Macht oder militärische Leistungen. Die Gesamtproduktivität war nicht hoch genug, um die erforderliche Kraft aufzubringen, dieses riesige Reich in derartigen Krisen zu stabilisieren.
Und militärisch war Roms Überlegenheit allein auf Basis von guter Ausbildung und besserer Logistik begründet, technisch war der Vorsprung gering und glich sich durch zunehmende Adaption durch Germanen immer weiter aus.
Diese Schwächen sind neben den offenkundigen Begrenzungen durch die Zeit (keine Kommunikation, extrem lange Wege) entscheidende innere Faktoren. Sie sind allerdings nicht unbedingt aus sich heraus stärker geworden – diese Schwächen konnte man bis zu einem gewissen Grad über die Jahrhunderte wegstecken, als das System allerdings unter zu großen äußeren Stress gesetzt wurde, fehlten die Ressourcen, diese Krisen zu überwinden.
Im Ergebnis bringt die Frage nach dem Römischen Reich allerdings eher etwas, wenn man sie umdreht: Nicht die Frage, warum Rom nach Jahrhunderten in einer epochalen Situation wie der Völkerwanderung unterging, bedarf einer Erklärung, sondern wie sich dieses unwirkliche Gebilde so lange halten konnte. Die Vormachtstellung war seit jeher weitaus geringer als etwa der militärische Vorsprung Europas gegenüber seinen Kolonien. Der Erhalt des Reiches war eine permanente gigantische Kraftanstrengung, die lediglich darauf basierte, dass der Erhalt Roms und der Zivilisation der zentrale gesellschaftliche Wert seiner Zeit war.
Die römische Gesellschaft hat eine bis heute eigentlich unerreichte Fähigkeit zur kulturellen Durchsetzung und Konsistenz erreicht. Über Jahrhunderte gelang es, Generationen mit römischer Kultur und Bildung und einem spezifischen Wertegerüst gleichbleibend zu formieren und dieses ganz spezifische Lebensmodell über ganz Europa auszuweiten. Selbst als Rom gefallen war, versuchten viele Provinzen und selbst barbarische Staaten die römische Lebensweise weiter nachzuahmen, was allerdings nicht gelang.
Andererseits wirkt der Untergang Roms weitaus weniger determiniert und als historisch unabwendbarer Zyklus, als es uns oft von Konservativen wie von Sozialisten dargestellt wird. Der Fall Roms erscheint vielmehr wie eine Verkettung von historischen Ereignissen, die auch anders hätten kommen können – von Zufällen und wenigen Entscheidungen einzelner Personen. Die Urkatastrophe nach dem Übertritt der Goten über die Donau 476 hätte anders verlaufen können: Kaiser Valens wartete in der Schlacht von Adrianopel nicht auf die bereits heranrückende Verstärkung aus dem Westreich, weil er die Stärke des Gegners falsch einschätzte und weil er – eifersüchtig auf seinen Kollegen im Westen – selbst den Ruhm alleine einheimsen wollte. Eine andere Entscheidung hätte die Goten-Krise hier durchaus anders entscheiden können – stattdessen war die Goten-Gefahr ein Virus in der Struktur des Reiches, die letztlich alle weiteren Krisen hervorrief.
Wäre der relativ fähige faktische Herrscher des Westreichs Aëtius nicht vom de jure Kaiser Valentinian III. ermordet worden, weil er dachte, dass er den Führer nicht mehr bräuchte, nachdem das Hunnenreich zerfallen war, hätte es keinen zermürbenden Machtkampf gegeben, während sich die Germanen weiter über das Reich hermachten. Bei anders stehendem Wind wäre die Flotte, die Nordafrika den Vandalen entreißen sollte, angelandet, und das Unterfangen hätte das wirtschaftliche Rückgrat des Westreiches wiederhergestellt. Lediglich gut 50 Jahre nach dem Fall Westroms gelang es dem oströmischen Kaiser Justinian, alle Feinde wieder niederzuwerfen, Nordafrika von den Vandalen zu befreien und schließlich Rom selbst – allerdings schien die Substanz da schon zerstört. Immer wieder also waren die römischen Streitkräfte prinzipiell in der Lage, das Schlachtfeld zu dominieren.
Marx meint, die Geschichte reimt sich. Aber der permanente Versuch, Wiederholungen und Muster in der Geschichte zu erkennen, ist oft übertrieben. Für jeden alternativen Verlauf der Geschichte lässt sich immer ein Muster finden – im Rückspiegel ist alles eingebettet in einen größeren Sinnzusammenhang, lässt sich alles in ein Schema pressen. Im Falle von Rom haben dieses Bild Zeitgenossen schon selbst produziert: Weil in der römischen Ideologie das Reich und Gott quasi wesensgleich sind, ist eine Niederlage nicht zu erklären, außer in der moralischen Unvollkommenheit eines Anführers oder des ganzen Volkes und der Strafe des Himmels. Das muss nicht stimmen. Geschichte passiert eben doch – und die Rolle des Individuums und einzelner Entscheidungen sind ausschlaggebend.
Man könnte sagen: Der Firnis der Zivilisation ist weitaus dünner und die Macht von Imperien ist weitaus geringer, als oft angenommen. Lediglich aufgrund einer langen Geschichte hielten die Römer sich (und halten auch wir sie) für unter normalen Bedingungen unbesiegbar. Das waren sie aber nie. Die Zivilisation wurde immer wieder aufs Neue vor existenzielle Bedrohungen gestellt, die man immer wieder mit gewaltigen Kraftanstrengungen bestreiten musste. Die Gefahr des Untergangs lag dabei immer in der Luft und wenige Fehler und Umstände reichten aus, um das Reich zu stürzen. Und dann konnte es plötzlich sehr schnell gehen. Denkt man darüber nach wird die kulturelle und gesellschaftliche Stärke Roms eigentlich nur umso bemerkenswerter.
Die postmodernen Versuche, die historische und zivilisatorische Kraft und Bedeutung Roms kleinzureden, scheitern vollkommen. Auch neuere Forschung muss den dramatischen Abfall von Bildung und Zivilisation nach Roms Fall anerkennen.
Man könnte allerdings auch sagen: Römische Ideen und Ideale waren derart kraftvoll, dass sie über viele Wege – der Kirche, der Renaissance, der Aufklärung – irgendwie doch überlebten. Bedenkt man, dass sich der Patriotismus und das Selbstverständnis der Römer niemals in erster Linie auf den Staat, sondern auf die Idee des Römertums bezog, könnte man auch sagen, dass ihre Zivilisation im modernen Westen überlebt hat und eigentlich nie ganz untergegangen ist.
Die Grundlage vernünftiger Politik ist ein realistisches Verständnis der Geschichte. Apollo Chronik erscheint jeden Samstag – und bietet statt post-kolonialer Mythen die Fakten zur Geschichte des Westens.