
Kaum ein Dokument wird so häufig zitiert – und so wenig gelesen – wie das Pariser Klimaabkommen von 2015. Regierungen, NGOs und Gerichte berufen sich darauf, als sei es ein völkerrechtlich bindendes Diktat zur Dekarbonisierung. Doch wer das Abkommen genau liest, stellt fest: Es ist eher ein diplomatischer Minimalkonsens als ein gesetzlich verpflichtendes Programm.
Kaum ein Dokument hatte weltweit so weitreichende politische Folgen. Es gilt vielen als rechtliche Grundlage für das sogenannte „Netto-Null bis 2050“, für das Verbot von Verbrennungsmotoren, für den Rückbau von Kohlekraftwerken und für die sogenannte Transformation der Industrie.
Doch was steht tatsächlich im Vertrag – und was nicht?
Das Pariser Abkommen wurde bei der UN-Klimakonferenz COP21 beschlossen und trat 2016 in Kraft. Es ist kein „Klimagesetz“, aber völkerrechtlich bindend – allerdings nicht im Sinne konkreter Emissionsziele oder verbindlicher Zeitvorgaben.
Die Umsetzung beruht nicht auf Zwang, sondern auf Transparenz und politischem Druck: ein sogenannter „Name-and-Shame“-Mechanismus. Staaten müssen regelmäßig berichten, was sie tun – aber nicht, was sie erreichen.
Das Abkommen formuliert ein langfristiges Ziel: Die Erderwärmung soll auf „deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad“ begrenzt werden. Wie dies geschehen soll, bleibt den Staaten überlassen. Jeder Staat reicht sogenannte „national festgelegte Beiträge“ (NDCs) ein – freiwillige Selbstverpflichtungen, die alle fünf Jahre aktualisiert werden sollen. Es gibt aber keine Sanktionen bei Zielverfehlung.
Vom Ziel „Netto-Null bis 2050“ ist dort nirgends die Rede. Artikel 4 des Vertrags spricht von dem Ziel, „in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen anthropogenen Emissionen und deren Aufnahme durch Senken“ zu erreichen – etwa durch Wälder und Böden. Ohne konkretes Datum, ohne Verbindlichkeit. Auch das oft zitierte „100-Milliarden-Versprechen“ zur Finanzierung von Klimaschutz in Entwicklungsländern ist rechtlich nicht einklagbar.
Trotzdem wurde das Abkommen in Europa zum Hebel einer umfassenden Transformation: CO₂-Bepreisung, Verbote, Industriewende. In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht 2021 sogar aus Artikel 4 eine rechtliche Pflicht Deutschlands zu „Netto-Null bis 2050“ abgeleitet – ein weltweit einmaliger Vorgang.
Wissenschaftler wie Fritz Vahrenholt werfen insbesondere Deutschland und der EU vor, das Abkommen politisch überdehnt zu haben. Der ursprüngliche Charakter des Abkommens sei in ein Korsett aus politischen Dogmen gezwängt worden. Der diplomatische Minimalkonsens, flexibel, ergebnisoffen, wurde umgesetzt in eine Flut von Gesetzen und Verboten, die Marktverzerrungen und wirtschaftlichen Schaden nach sich ziehen.
Während die USA das Abkommen nie als Zwang verstanden – und es unter Donald Trump sogar verließen –, hat Europa auf dieser Basis eine gesamte industriepolitische Agenda errichtet. Das sei, so Vahrenholt gegenüber TE, nicht nur rechtlich fragwürdig, sondern auch ökonomisch gefährlich: „Wir verarmen im Namen eines Ziels, das in dieser Form nie vereinbart wurde.“
Wer aus dem Pariser Klimaabkommen Verbots- und Subventionspolitik ableitet, handelt politisch – nicht juristisch.





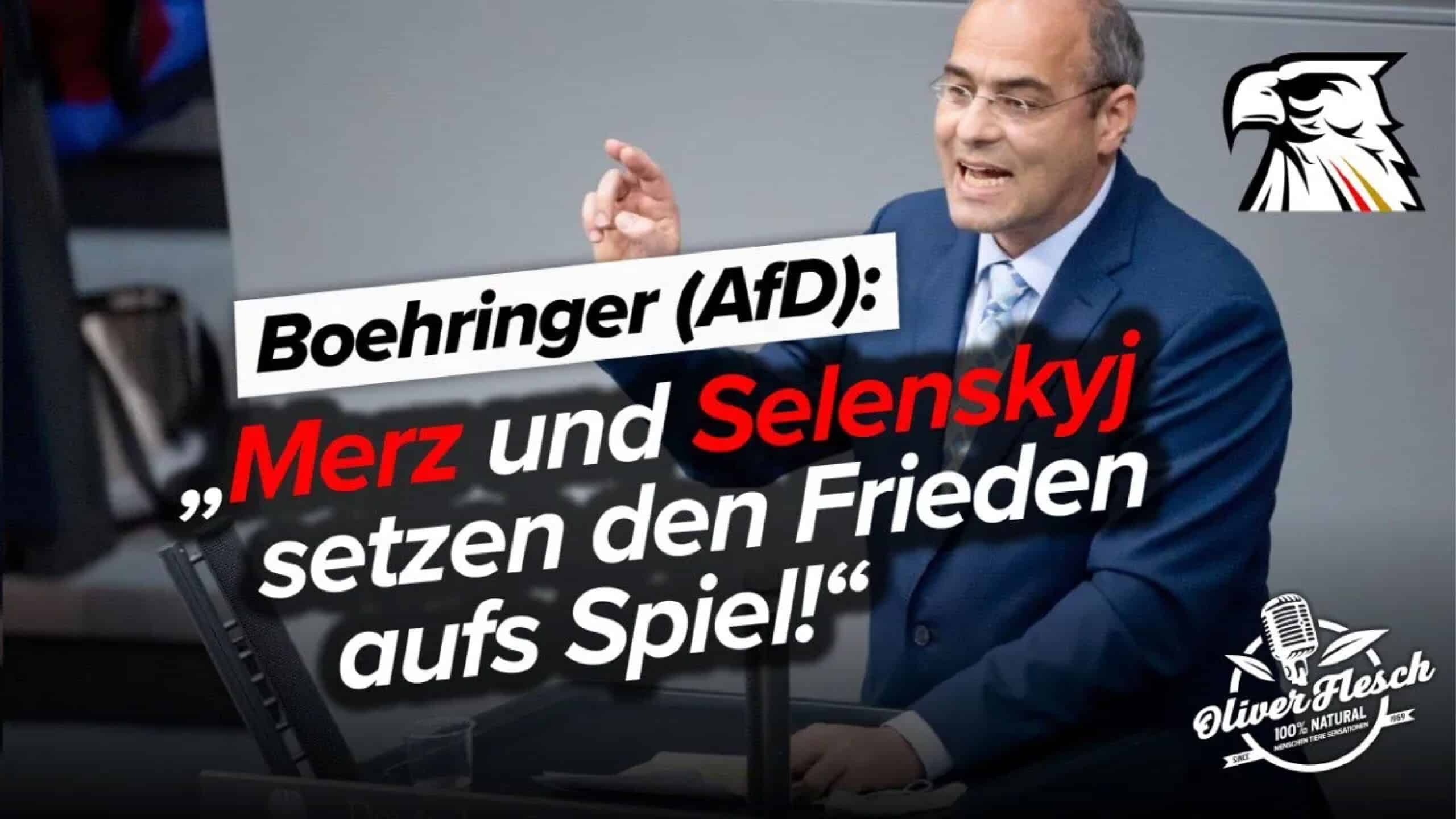



 ALASKA-COUNTDOWN: Trump trifft auf Putin – Kann das Treffen Frieden in der Ukraine bringen?
ALASKA-COUNTDOWN: Trump trifft auf Putin – Kann das Treffen Frieden in der Ukraine bringen?






























