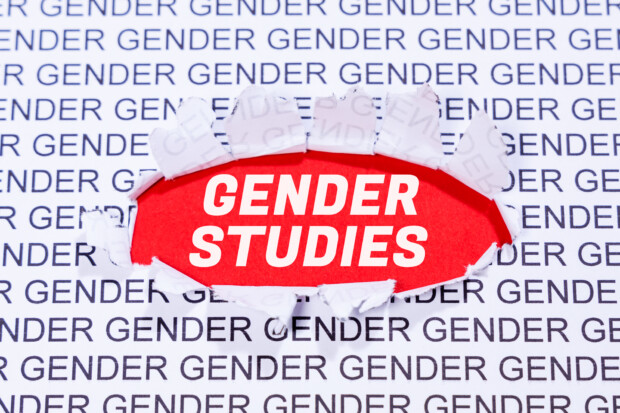
Nach Teil 1 über die absurden Auswüchse des Gender-Aktivismus und Teil 2 zur ideologischen Unterwanderung von Wissenschaft und Gesellschaft folgt nun der dritte und abschließende Teil der Serie. Im Fokus steht die Frage: Wie kann der postmoderne Irrsinn an den Wurzeln gepackt und die Wissenschaft vor weiterer politischer Vereinnahmung geschützt werden?
Wie kann man dem Treiben des postmodernen Genderstudies-Aktivismus dauerhaft Einhalt gebieten? Schließlich sind die postmodernen Gender Studies eine der wesentlichen Quellen des Unsinns, der in den letzten Jahrzehnten in den Journalismus, in Kultureinrichtungen, in das NGO-Unwesen, in politische Parteien hineingesickert ist. Ich beschränke meinen Versuch einer Antwort auf Deutschland, aber sie wäre gewiss analog auch in anderen Ländern umzusetzen. Von etwaigen rechtlichen Umsetzungsschwierigkeiten sehe ich zunächst ab, um die Richtung aufzuzeigen, in die es aus meiner Sicht gehen müsste.
Besser wäre das folgende Vorgehen: Den primär von den postmodernen Gender Studies infizierten Wissenschaftsbereichen wie der Soziologie, den Kultur- und Literaturwissenschaften, der Sozialpädagogik etc. müssten von der Deutschen Forschungsgemeinschaft fünf Jahre der universitären Selbstaufklärung und ein neuer Werturteilsstreit verordnet werden. Universitäre Selbstaufklärung bedeutet, dass – ausschließlich durch Wissenschaftler – in den betroffenen Fachbereichen all jene wissenschaftsfremde Elemente identifiziert werden, die sich in den letzten Jahrzehnten in die wissenschaftliche Arbeit eingeschlichen haben. An allen Professuren würden dann Nachweis- und Berichtspflichten eingeführt werden, die die Ausarbeitung einer Position in einem neuen Werturteilsstreit zu einer Aufgabe der jeweiligen Professur machen. Kernpunkt dieses neuen Werturteilsstreits ist die Frage: „Was wurde an Ihrer Professur, an Ihrem Forschungsbereich im letzten Semester dafür getan, Erklären und Bewerten noch besser voneinander zu trennen?“ Diese Frage zielt darauf ab, die Sensibilität für die Unterscheidung von Wissenschaft und Politik zu erhöhen: Wissenschaft ist die systematische Generierung von Erkenntnis, demokratische Politik hingegen die auf Wertentscheidungen basierende Gestaltung der Gesellschaft unter einander gleichgestellten Bürgern. Auch wissenschaftliche Mitarbeiter und Studenten hätten zu dieser Frage regelmäßig Stellung zu nehmen. Die aggregierten Berichte würden auf verpflichtenden hochschulöffentlichen Versammlungen vorgetragen und erörtert. Gemeinsam wird dann diskutiert, wie im nächsten Semester eine noch schärfere Trennung zwischen Erklären und Bewerten erreicht werden kann. Verschiedene Beschlüsse werden jeweils abgestimmt und zur Norm für das jeweils folgende Semester erklärt.
Befördert wird diese Schärfung von Maßstäben durch das zweite Kernelement der universitären Selbstaufklärung, nämlich den Einsatz eines finanziellen Anreizsystems. Die Umsetzung der jeweiligen professoralen Beschlüsse zur Trennung von Erklären und Bewerten wird zur Schleuse für Leistungszulagen. Nur wer an seiner Professur sicherstellt, dass hinreichend zwischen Erklären und Bewerten getrennt wird, kann Leistungszulagen erhalten. Das heißt: Wer besonders eifrig publiziert und viele Drittmittel einwirbt, aber dabei aktivistischen Unsinn erzählt, erhält dasselbe Gehalt wie jemand, der wenig publiziert und wenig Drittmittel einwirbt. Eine solche Kombination aus kollektiver Selbstaufklärung innerhalb der Wissenschaft und einem Anreizmechanismus, der ohne inhaltliche Vorgaben arbeitet, scheint ein gangbarer Weg zu sein, um die postmodernen Gender Studies in eine weitgehend seriöse Wissenschaft zu transformieren. Mit einer solchen dringend notwendigen Gender-Studies-Wende sollte sich dieser Wissenschaftsbereich dann freilich in „Gender- und Sex-Studies“ umbenennen. Denn neben Geschlechtsrollen und der Geschlechtsidentität hat nun auch der echte Körper aus Fleisch und Blut wieder seinen Platz. Auch eine verstärkte Forschungskooperation mit Biologen und Ökonomen würde das Potential der „Gender- und Sex-Studies“ sicherlich erhöhen.
Es würde danach freilich noch einige Jahre dauern, bis die von den postmodernen Gender Studies infizierten außerwissenschaftlichen Gesellschaftsbereiche von den Verrücktheiten, die sich jahrzehntelang in ihnen – unter anderem dank Demokratie leben! – akkumuliert haben, wieder einigermaßen befreit sind. Umso wichtiger ist es, so schnell wie möglich die intellektuellen Nachschubwege für postmodernen Unsinn abzuschneiden. Die Alternative dazu ist wenig erfreulich: Die Realität würde noch stärker zu einer Satire ihrer selbst. Im Lichte des bereits erreichten Ausmaßes an Irrsinn – „heteronormative Legosteine“, „gebärende Elternteile“, „menstruierende Personen“ – könnte dies nur noch in einer Gesellschaft münden, die die Realitätsvernichtung auch mit repressiven Maßnahmen gegenüber Widerstand absichert. Erste Vorboten sehen wir bereits, siehe die von einer ehemaligen Stasi-Mitarbeiterin geleitete Meldestelle Antifeminismus sowie das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz.
Um sich nicht vollends in eine Rutschbahn hin zum Totalitarismus zu verwandeln, werden sich auch die postmodernen Gender Studies weiterhin bohrende Fragen gefallen lassen müssen. Es gibt keine bessere Bestätigung dafür, weiterhin vehement diese geradezu kindlich naive Form der Gesellschaftskritik zu betreiben, als wenn Journalisten von angeblich investigativen Recherchenetzwerken, wie der Fakenews-Schleuder „Correctiv“, das Stellen von Fragen irritierend finden. „Ja“, lautet die Antwort: „Die Gender-Kaiser*in ist nackt.“
Schaffen wir sie aber nicht einfach ab, die Gender-Kaiser*in, sondern kleiden sie wissenschaftsüblich ein. Auf dass ihr Anblick nicht mehr länger ihre Betrachter spalte. Dafür ist allerdings eine wache, kritische Zivilgesellschaft gefragt. Dann kann die liberale, plurale, rechtsstaatliche Demokratie nicht nur die 68er, sondern auch die Woke Culture überleben.
Christian Zeller ist Soziologe.








 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























