
Ein Gastbeitrag von Corina Martinas
Der Engel hat den Zweiten Weltkrieg überlebt. Über Berlin, Paris und New York hat er es schließlich nach Jerusalem geschafft, wo er nun im Israel Museum einen Platz hat. Die Rede ist von dem Bild „Angelus Novus“ von Paul Klee. Sein Besitzer, der deutsch-jüdische Philosoph Walter Benjamin, hat die Verfolgung durch die Nazis nicht überlebt. Er hatte aber testamentarisch verfügt, dass der Engel an dem Ort aufbewahrt werden soll, den die Juden auf Hebräisch einfach „das Land“ nennen: in Israel.
Dieses Bild wurde in den letzten Wochen das zentrale Objekt einer Ausstellung im Berliner Bode-Museum. Mit einer Ausstellungseröffnung am 8. Mai – dem 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus – wurde der Besuch des Engels in der ehemaligen Hauptstadt des Dritten Reiches zu einer Geste der Vergangenheitsbewältigung. Dem Gast wurde auch viel Respekt gezollt, nicht zuletzt durch die Masse an Besuchern, die an manchen Tagen bereitwillig sogar bis zu zwei Stunden Schlange standen, um im tageslichtfreien Museumskabinett einen Blick auf die DIN-A4-kleine aquarellierte Zeichnung zu erhaschen.
Blick auf das Bode-Museum, in dem die Paul Klee Zeichnung seit dem 8. Mai zu sehen ist.
In seiner Existenz von nun 105 Jahren wurde der Engel zur Projektionsfläche vieler Deutungen, vor allem dadurch, dass er das Denken und Leben Walter Benjamins über zwei Jahrzehnte geprägt hat. Vom Meditationsbild bis zum „Engel der Geschichte“ und zum Schluss gar zum persönlichen Todesboten, das Aquarell war für den Philosophen ein ständiger Begleiter. Und doch gehen wir heute davon aus, dass bei der Betrachtung des Bildes ein Detail übersehen wurde, das erst 2015 von der amerikanischen Künstlerin R. H. Quaytman entdeckt wurde: Unter dem Engel befindet sich ein Luther-Porträt.
Mit seinem Aquarell hat Paul Klee tatsächlich ein anderes Bild überklebt: eine 1838 von Christian Friedrich Müller angefertigte Radierung, die wiederum als Kopie eines Martin Luther-Gemäldes von Lucas Cranach d. Ä. zu erkennen ist. Schwer zu glauben, dass der Künstler kein anderes Blatt als Bildträger zur Hand hatte. Auch schwer zu glauben, dass ihm die Bedeutung Luthers für die Nationalsozialisten verborgen blieb. Denn viele Theologen am Anfang des 20. Jahrhunderts waren stets damit beschäftigt, Jesus als Arier darzustellen, der gegen die Juden kämpfte. So fanden die Anfeindungen gegen Juden innerhalb der evangelischen Kirche meist unter Berufung auf die späten antisemitischen Schriften Luthers statt, der in der Epoche, wie die Recherche des Historikers Günther B. Ginzel belegt, zum „Kronzeugen des Antisemitismus“ wurde. Auch wurde der Aufruf des Kirchenlehrers, die Juden „wie die tollen Hunde zu verjagen“ von Ideologen der NS-Zeit mit Genugtuung übernommen.
Paul Klee mit seiner Katze im Jahr 1921. Vermutungen legen nahe, daß er um die Kontroversen, die sein Bild „Angelus Novus“ auslöste, wußte.
Die Vermutung liegt also nah, dass Paul Klee diese Strömungen wahrnahm. So könnten wir seine Entscheidung, Luther mit einem „neuen Engel“ zu überkleben, als stillen, verschlüsselten Protest deuten. Still, weil er es anscheinend keinem gesagt hat. Verschlüsselt, weil er Cranachs Signatur direkt neben dem Titel seines Aquarells doch stehen ließ. Mit bloßem Auge wäre dieses Detail, das Monogramm LC an der linken, unteren Ecke des Bildes, die ganze Zeit erkennbar. Und doch wurde es fast hundert Jahre übersehen.
Vielleicht passt sogar zu der Geschichte dieses Bildes, dass die Berliner Kuratoren seine Entstehung nicht thematisiert haben. Wenn die dunkle Seite der Geschichte überdeckt wird, wollen wir sie auch nicht mehr sehen. Walter Benjamins Deutung, zentral und namensgebend für die Berliner Ausstellung, zeigt dennoch, dass die Bildoberfläche nicht alles überklebte: Der neue Engel wurde für den Denker zum „Engel der Geschichte“, der die schwere Last der Zeiten nicht abschütteln kann: „Ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann“, schreibt er in seiner Abhandlung „Über den Begriff der Geschichte“. Auch interessant ist seine Intention, eine Zeitschrift für christlich-jüdischen Dialog zu gründen, die eben den Namen „Angelus Novus“ tragen sollte. Dazu kam es nicht mehr. Und dennoch klingt dieser Gedanke wie ein Versuch, die zwei Schichten des Bildes miteinander zu versöhnen.
Unsere aktuelle gesellschaftliche Realität zeigt aber, dass uns die dunklen Seiten der Geschichte noch überschatten. Denn gerade kurz vor dem Ende dieser Ausstellung tagte der Weltkirchenrat in Südafrika und veröffentlichte danach eine offizielle Erklärung. Darin wird dem Staat Israel Apartheid vorgeworfen. Unerwähnt bleibt der Terror der Hamas. Inzwischen ist diese Haltung auch in der Kirche nicht mehr neu. Denn gleich nach den Ereignissen vom 7. Oktober ist auch hierzulande die gut gebügelte, glanzvolle Oberfläche deutscher Staatsräson gerissen. Und seitdem blättert dieser Glanz weiter ab. Wir erinnern uns, wie am 8. Oktober, als die Schreie vergewaltigter israelischer Frauen aus Live-Aufnahmen noch zu uns durchhallten und die verstümmelten und geschändeten Körper der Toten in den Kibbuzim noch warm waren, in deutschen Medien schon Stimmen gegen Israel laut wurden. Dass die Solidarität mit den Tätern weder ein deutsches noch ein evangelisches Alleinstellungsmerkmal ist, wurde uns letztes Jahr am Heiligabend wieder klar, als wir das Jesuskind in der Krippe des Vatikans sahen: umhüllt in einer Keffiyeh.
Der Besuch des Engels in Berlin macht uns darauf aufmerksam, dass dunklere Bildträger unserer Geschichte noch sichtbar sind. Aber womöglich bringt er auch, wie alle überirdischen Wesen, eine Hoffnung: dass Meinungen von Theologen oder Beschlüsse von Kirchenräten von der Hand eines höheren Schöpfers überschrieben werden können. Und dass die dunkle Gesinnung irgendwann vollständig überklebt und bewältigt werden kann. Zurückbleiben wird dann nur der Engel der Geschichte. Ein etwas verschreckter, kleiner, aber immerhin ein heller Engel. Mit Flügeln, die ihn, wie bisher, weitertragen werden.
***Corina Martinas ist Philologin und katholische Seelsorgerin. 2017 hat sie als Freiwillige in Jerusalem gearbeitet. Seitdem hat sie eine große Liebe für Israel. Sie lebt in Berlin.
Corina Martinas




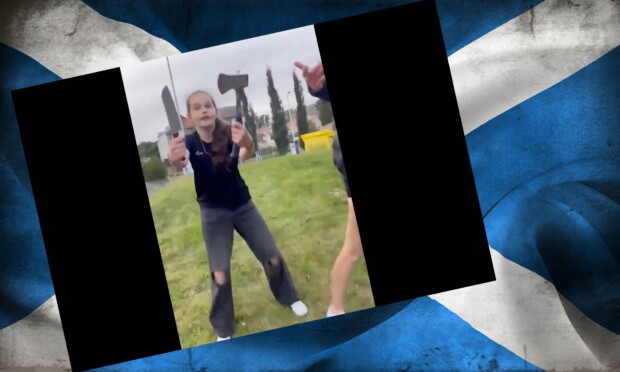

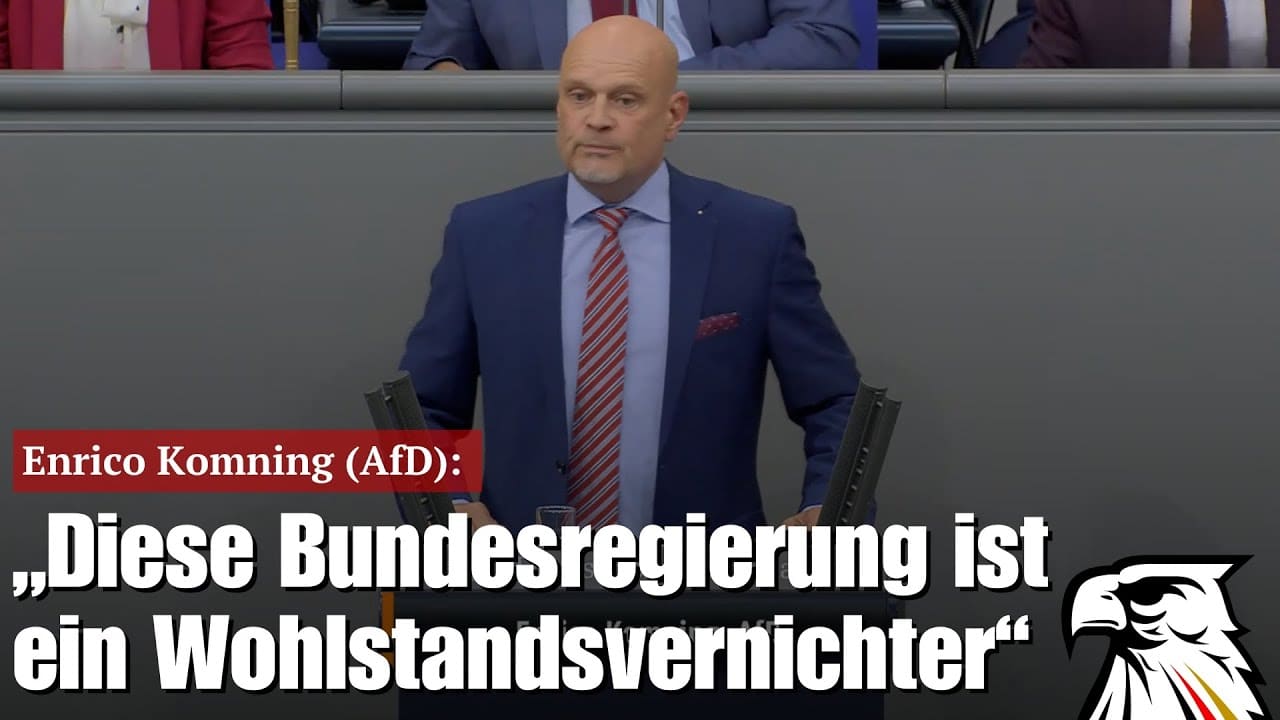


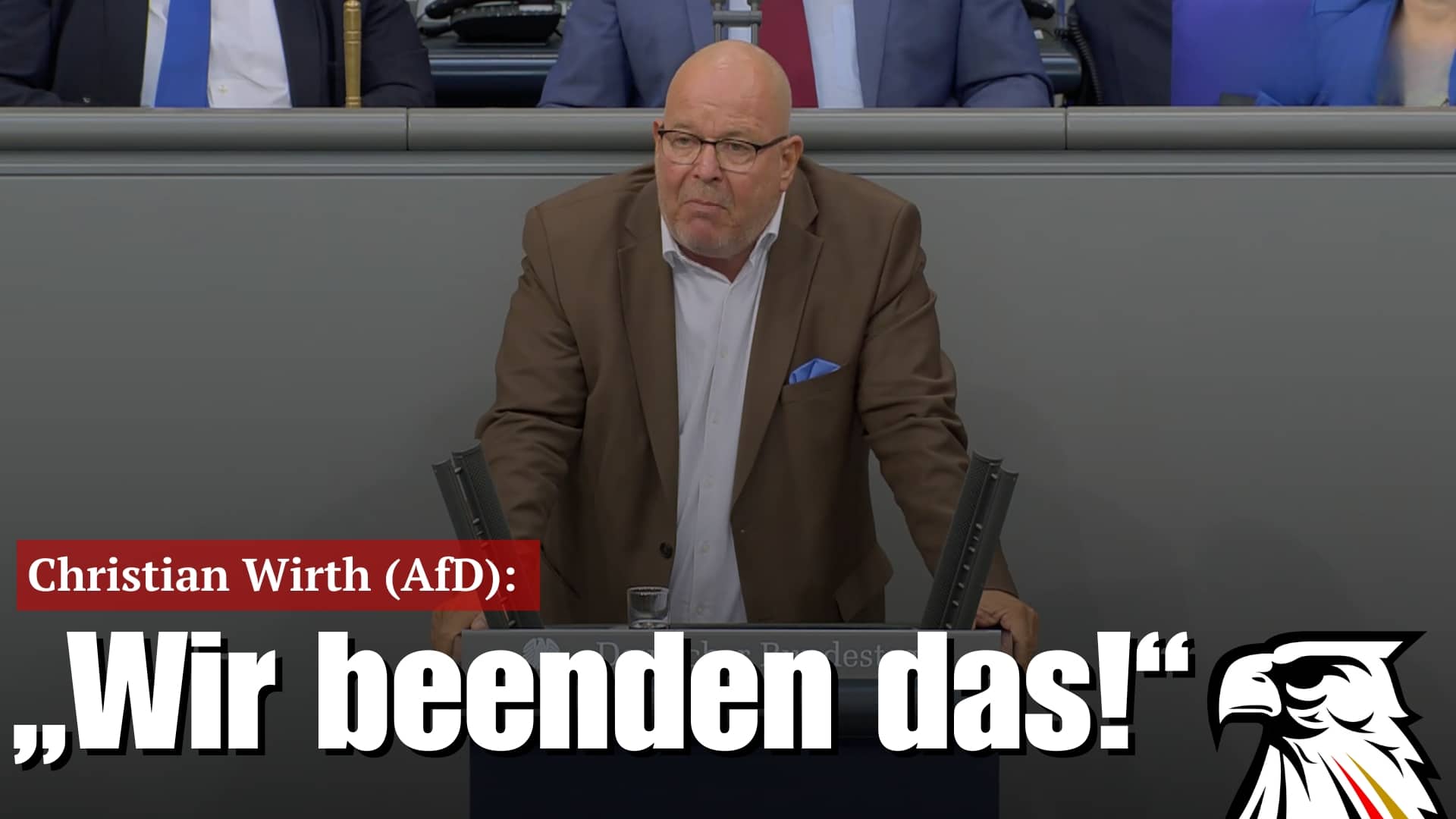
 Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025
Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025






























