
Marine Le Pen galt bis vor wenigen Tagen noch als die nächste Präsidentin Frankreichs. In Umfragen lag die Ikone der französischen Rechten teilweise bei 40 Prozent in der ersten Runde, allen ihren Konkurrenten praktisch uneinholbar voraus. Doch die Oppositionspolitikerin verlässt die politische Bühne fürs Erste abrupt: Le Pen, das ist durch ein Pariser Gericht zumindest auch rechtlich bestätigt, soll EU-Gelder in Höhe von 474.000 Euro veruntreut haben.
So soll die Politikerin des Rassemblement National (RN) während ihrer Zeit als Europaabgeordnete von 2004 an, bis 2016, vier Mitarbeiter im Abgeordnetenbüro auch für parteipolitische Zwecke eingesetzt haben, obwohl deren Gehälter durch die EU bezahlt wurden. Freilich sind die Vorwürfe nicht vollkommen substanzlos – das gab auch Le Pen selbst zu: Sie habe die Mitarbeiter auch für die Parteiarbeit eingesetzt, diese sei jedoch nicht zu trennen von der Parlamentsarbeit.
Auch wenn man nach Deutschland schaut, ist das Vorgehen bekannt: Die Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten übernehmen oft auch seine Außendarstellung, etwa in den sozialen Medien. Oft sind die Mitarbeiter sogar selbst angehende Parteipolitiker. Bestes Beispiel für den Einsatz von Parlamentsmitarbeitern für Parteiarbeit erbringt ausgerechnet die grüne Parteichefin Franziska Brantner. Sie soll im Jahr 2011 als Europaabgeordnete gemeinsam mit Bundestagsabgeordneten ihrer Partei, vom Parlament bezahlte Mitarbeiter für den Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz eingesetzt haben (Apollo News berichtete). Le Pens Vorgehen ist eben kein Einzel-, sondern eher der absolute Regelfall.
Selbst in Frankreich gibt es genug solcher öffentlich gewordener Vorfälle: Ausgerechnet der von Macron ernannte aktuell amtierende Ministerpräsident François Bayrou war in einen ähnlichen Skandal verwickelt. Zwischen 2005 und 2017 soll seine Partei, das Mouvement Démocrate (MoDem), im EU-Parlament, ähnlich wie Le Pens RN, 1,4 Millionen Euro an EU-Geldern für Mitarbeiter zweckentfremdet haben, die eigentlich mit Parteiarbeit beschäftigt waren. Mehrere Politiker des MoDem wurden Anfang 2024 aufgrund der Sache verurteilt. Bayrou selbst soll, als Parteivorsitzender, laut Staatsanwaltschaft der Drahtzieher hinter dem Vorgehen sein – der Prozess gegen ihn endete im Februar vergangenen Jahres jedoch mit einem Freispruch, wegen Mangels an Beweisen.
Es gab solche Skandale immer wieder, ausgerechnet an Le Pen und ihre Parteifreunde soll nun jedoch ein Exempel statuiert werden. Die wichtigste Oppositionspolitikerin Frankreichs wird von der kommenden Präsidentschaftswahl und auch den anderen Wahlen in Frankreich ausgeschlossen und soll sogar für mehrere Jahre ins Gefängnis. Die Strafe ist außergewöhnlich hart – und nicht vergleichbar mit vergangenen Fällen, etwa dem Prozess gegen die MoDem-Politiker.
Der Wahlausschluss für Le Pen gilt ab sofort und unabhängig davon, ob sie Einspruch gegen die Entscheidung einlegt. Durch ein Berufungsverfahren hätte Le Pen den Wahlausschluss vielleicht noch bis nach der kommenden Präsidentschaftswahl hinauszögern können. Doch an der Wahl soll sie nicht mehr teilnehmen. Das wäre eine „größere Störung der öffentlichen Ordnung“, so die Präsidentin des Gerichts Bénédicte de Perthuis bei der Urteilsverkündung.
Le Pen wird offenbar als Risiko betrachtet. Die dreifache Präsidentschaftskandidatin kam bei der letzten Wahl im Jahr 2022, Präsident Emmanuel Macron gefährlich nahe: 41 Prozent holte sie in der zweiten Runde der Wahlen. Heute würde die Wahl – das zeigen Umfragen – anders ausgehen. Le Pen ist das Gesicht der Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der etablierten Politik: Sie kritisiert die EU, die derzeitige Migrationspolitik – stellt sich jedoch auch gegen wirtschaftsliberale Vorhaben der Macron-Regierung, etwa eine Reform des Sozialstaats. Sie spricht die Probleme an, die von Politik und Medien erst totgeschwiegen und dann geleugnet wurden.
Nun wird sie durch das Urteil ihrer politischen Macht beraubt – statt den Wählern hat eine Richterin über ihre politische Zukunft entschieden. Die Reaktionen darauf sind über das politische Spektrum hinweg blankes Entsetzen. Andere Rechte, etwa der Vorsitzende der Reconquête-Partei (Rec) und ehemalige Präsidentschaftskandidat, Éric Zemmour, verurteilten die Entscheidung des Gerichts: „Es ist nicht die Aufgabe der Richter, zu entscheiden, wen das Volk wählen soll. Ungeachtet unserer Meinungsverschiedenheiten ist Marine Le Pen berechtigt, sich der Wahl zu stellen“, so Zemmour auf X.
Selbst von den erbittertsten Gegnern Le Pens kam Kritik. Der Vorsitzende der größten linken Partei Frankreichs, La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, warnte etwa: „In einem Rechtsstaat muss jeder das Recht haben, Berufung einzulegen. Wenn man das Marine Le Pen verweigert, dann wird dieses Recht allen verweigert, und das wäre ein Fehler.“ Auf X schrieb der von französischen Medien weithin als „linksradikal“ bezeichnete Politiker: „Die Entscheidung, einen gewählten Vertreter abzusetzen, sollte dem Volk überlassen werden.“
Doch die Entscheidung, Le Pen von den Wahlen auszuschließen, könnte das Establishment des Landes, das das Urteil zu großen Teilen begrüßt hat, noch teuer zu stehen bekommen. Le Pens RN war ohnehin schon im Aufwind – es holte bei der vergangenen Parlamentswahl im Juli mit Abstand die meisten Stimmen. Dieser Trend könnte sich nun noch verstärken, insbesondere weil Le Pen mit Jordan Bardella bereits einen kompetenten und vor allem, Umfragen zufolge, beliebten Nachfolger hat.
Der Europaabgeordnete und Parteivorsitzende führte die Partei bereits bei der Europawahl im vergangenen Juni zu einem deutlichen Wahlsieg. Bei der Präsidentschaftswahl 2027 könnte er Le Pen würdig vertreten. Der 29-Jährige ist wohl das frischeste Gesicht in der französischen Politik – galt vor der Parlamentswahl 2024 gar als möglicher Kandidat für den Posten des Premierministers (lesen Sie hier ein Porträt über Bardella).
Das Umfrageinstitut Ifop hatte bereits im vergangenen April eine Umfrage mit Bardella als möglichen Kandidaten des RN veröffentlicht, damals waren seine Werte nur ein bis zwei Prozentpunkte schwächer als in einer Ifop-Umfrage mit Le Pen als RN-Kandidatin.
Le Pen könnte eine Art Märtyrerin für ihre Partei werden. Sie ist nicht mehr nur die, die das ausspricht, was viele nicht aussprechen wollen, sondern die, die für ihre politische Überzeugung auch praktisch ins Gefängnis gehen muss. Das Unverständnis über das Gerichtsurteil konnte viele bisher unentschlossene, aber mit der etablierten Politik unzufriedene Wähler in die Arme von Le Pens RN treiben.
Das Potenzial für ein Wachstum der RN ist jedenfalls noch da: Die Rechte in Frankreich ist bis jetzt höchst zersplittert. Gleich mehrere rechte Parteien konkurrieren mehr oder weniger erfolgreich mit Le Pens RN um Wählerstimmen: Éric Zemmours Reconquête steht in Umfragen immerhin bei rund drei Prozent, Nicolas Dupont-Aignan Debout la France bei einem Prozent, ebenso wie die rechten Republikaner um Éric Ciotti, weitere rechte Kleinparteien liegen bei zusammengerechnet zwei Prozent. Zusammen kommt das rechte Lager ohne Le Pens RN also bereits auf neun Prozent.
Auch viele dieser Wähler könnten nun, aufgrund des Märtyrerstatus Le Pens, auf ihre Partei umschwingen. Dass der umgekehrte Fall eintritt und die RN aufgrund des Wegfalls ihrer Galionsfigur Le Pen an die kleinen rechten Parteien verlieren wird, ist angesichts der persönlichen Beliebtheit Bardellas und der mittlerweile robusten Parteistruktur und auch kommunalen Verankerung der Partei eher unwahrscheinlich.
Es zeigt sich: Die Staatsanwaltschaft und das Gericht, die mit der vorzeitigen Vollstreckung die politische Färbung des Prozesses gegen Le Pen offensichtlich gemacht haben, könnten sich durchaus verkalkuliert haben. Ihre politische Karriere mag zwar vorerst beendet und eine Präsidentin Le Pen künstlich verhindert sein – einem womöglich zukünftigen Präsidenten Bardella hat man jedoch erheblichen Vorschub geleistet.
Das wird mittlerweile sogar durch die Regierung anerkannt: Premierminister Bayrou hat am Dienstag in einer Fragestunde in der Nationalversammlung die Parlamentarier gar dazu aufgefordert, das derzeitige Gesetz, das eine vorzeitige Vollstreckung von Urteilen erlaubt, zu überdenken.
Wie es für Le Pen persönlich weitergeht, ist derweil unklar. Sie bleibt für den Rest der Legislatur Abgeordnete in der Nationalversammlung. Am Abend des Urteils hat sie in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender TF1 bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Dass das Verfahren noch vor der Präsidentschaftswahl 2027 beendet sein wird, gilt eher als unwahrscheinlich. Le Pens politische Karriere ist, auch wenn sie das Berufungsverfahren verlieren sollte, noch nicht endgültig am Ende – 2030 könnte sie wieder für politische Ämter kandidieren.





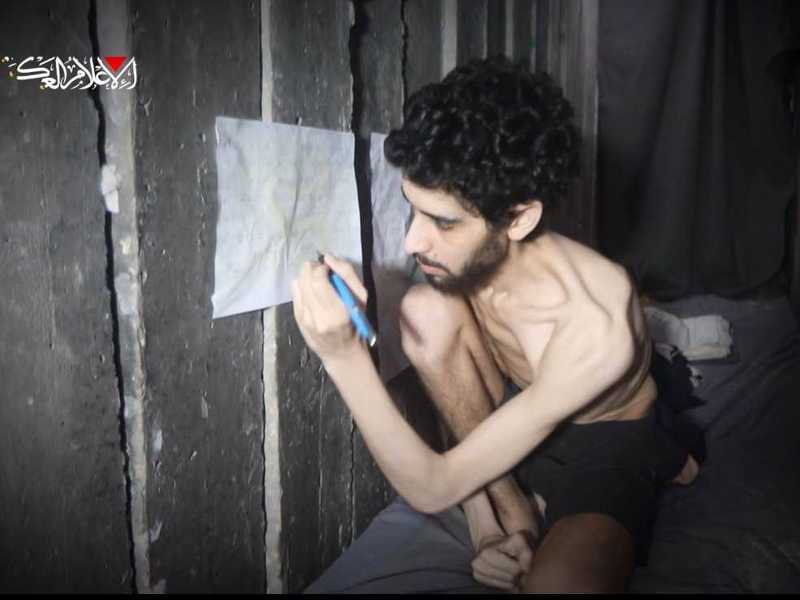

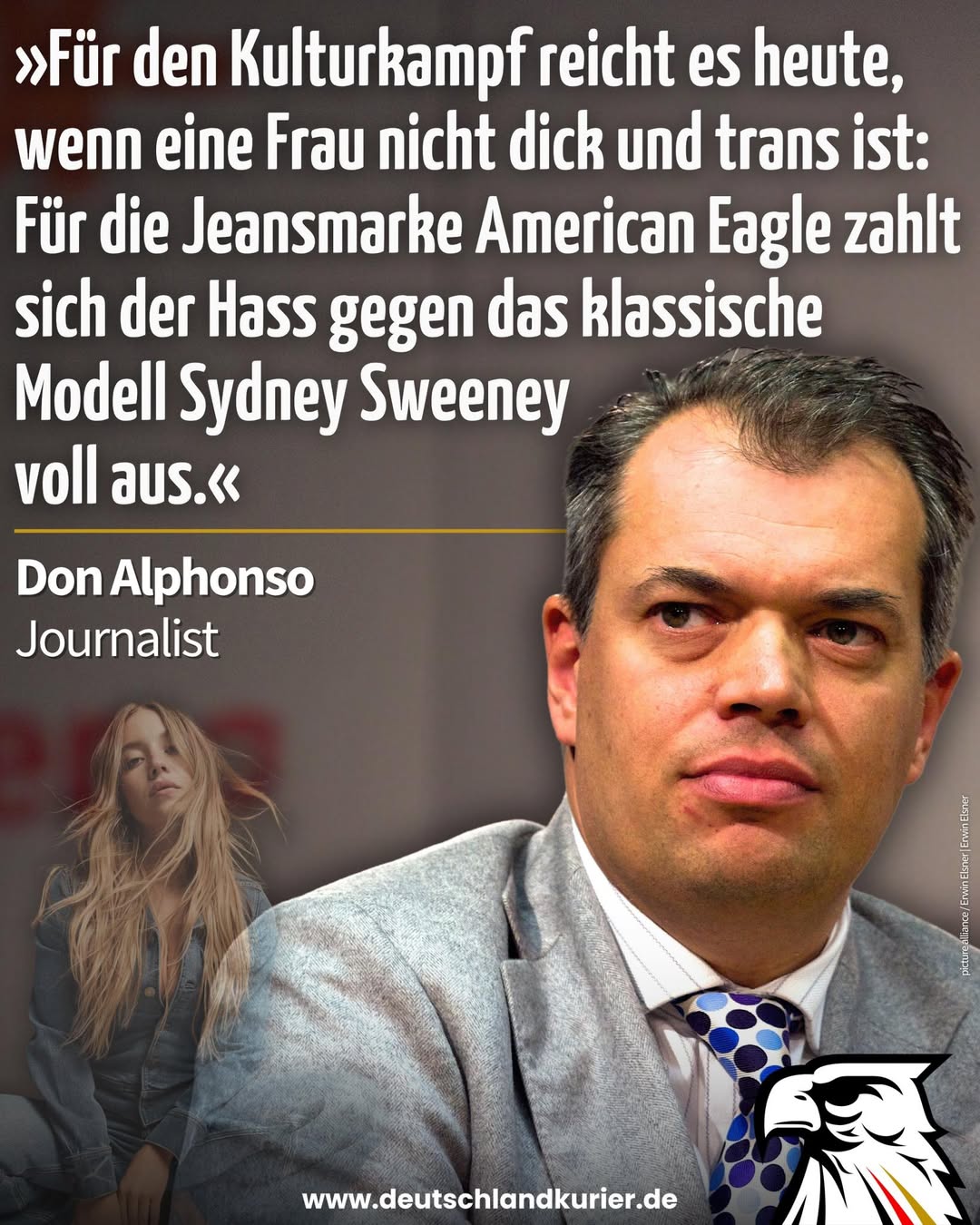


 PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM
PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM





























