
Haushaltspolitik der Marke „Ursula von der Leyen“ funktioniert im Wesentlichen folgendermaßen: Eine Funktionärskommission in Brüssel fantasiert sich ein nahezu unbegrenztes Budget herbei, präsentiert es der Öffentlichkeit, sitzt den Sturm der Empörung aus und beginnt dann mit den Vorbereitungen des fiskalischen Raubzugs.
Auch der vehemente Einspruch von Bundeskanzler Friedrich Merzgegen die Budgetpläne Brüssels zählt zur wohltemperierten, szenischen Gestaltung und folgt einem bekannten Drehbuch, dessen Schlusskapitel eine drastische Ausweitung des Aktionsraums der EU-Kommission vorsieht. Merz‘ gespielter Widerstand dient der innenpolitischen Befriedung und ist eine der zahlreichen politischen Nebelkerzen dieser Tage. Wir kennen diese Kommunikationstaktik aus dem Feld der Migrationspolitik.
In regelmäßigen Abständen wird eine professionell ausgeführte Operation zur Grenzkontrolle medienwirksam in Szene gesetzt. Denken Sie an die Grenzkontrollen an der französischen Grenze. In Wahrheit zielt diese Beruhigungspille inmitten des Migrationschaos darauf ab, die etablierte Politik der offenen Grenzen störungsfrei fortsetzen zu können. Es handelt sich um substanzlose Schaukämpfe.
Zurück nach Brüssel: Rund zwei Billionen Euro will der Brüsseler Bürokratie- und Umverteilungsapparat im Rahmen seines mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) im Zeitraum 2028 bis 2034 für seine zahlreichen Programme veranschlagen. Das entspräche einer Steigerung von etwa 750 Milliarden Euro oder über 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Siebenjahresbudget.
Den größten Ausgabenblock beansprucht erwartungsgemäß der Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel. Mehr als ein Drittel des Gesamtvolumens – rund 700 Milliarden Euro – soll in dieser Zeit der Klimawirtschaft und ihren Profiteuren zufließen. Die von der EU-Kommission geschaffene artifizielle Klima-Ökonomie verschlingt immer größere Teile des schrumpfenden Privatsektors und wird damit zur ökonomischen Falle, die die Zentralplaner in Brüssel nolens volens konstruiert haben.
Das EU-Budget setzt erneut einen Schwerpunkt in der Ukraine-Politik. Hier sind 100 Milliarden Euro an Mitteln für die Unterstützung des Landes und seiner militärischen Aktivitäten vorgesehen. Der Betrag verdoppelt das aktuell laufende Ukraine-Fazilitätsbudget von 50 Milliarden Euro und umfasst sowohl Darlehen als auch Zuschüsse zur Stabilisierung der kollabierenden ukrainischen Ökonomie.
Jetzt, da der Budgetplan einmal in der Welt ist, stellt sich die Frage der Finanzierung der ehrgeizigen Pläne. Hier fehlt es naturgemäß nicht an Ideen, die EU-Bürger weiter zur Kasse zu bitten. Der europäische Steuerzahler ist das einzige kreditwürdige Kollateral des rohstoffarmen Kontinents Europa. Und man wird ihn entsprechend zur Rechenschaft ziehen, wenn es um die Finanzierung der vielfältigen Tätigkeiten der Kommission geht.
Im Herzen des neuen EU-Haushaltsvorschlags versteckt sich ein fiskalischer Sprengsatz: das Eigenmittelpaket. Neben den etablierten Einnahmequellen aus Zöllen und dem Anteil an der Mehrwertsteuer (sie macht etwa 14 Prozent des EU-Budgets aus) will Brüssel künftig fünf neue Finanzquellen anzapfen. Dazu zählen 30 Prozent der Erlöse aus dem Emissionshandel, 75 Prozent der Einnahmen aus dem CO2-Grenzausgleich (CBAM), eine Plastiksteuer sowie 15 Prozent aus der Tabak- und Nikotinersatzbesteuerung.
Die Krönung des fiskalischen Feuerwerks wäre aber die Einführung eines pauschalen Jahresbeitrags für umsatzstarke Unternehmen ab 100 Millionen Euro, das sogenannte „Corporate Resource for Europe“ (Core) – eine Art Clubmitgliedschaft, wenn Sie so wollen. Diese Zahlung wäre umsatzbezogen und damit unabhängig von der Finanzlage des jeweiligen Unternehmens zu leisten – eine Art Strafsteuer für produktive Wertschöpfung. Wir erleben den versuchten Einstieg in einen zentralisierten EU-Steuerstaat – ohne demokratische Kontrolle und ohne externe Audits.
Die Planungen in Brüssel zeigen eines deutlich: Man wähnt sich auf dem Weg zur fiskalischen Souveränität. Gelingt der Behörde die haushaltspolitische Emanzipation von den Mitgliedstaaten, haben wir es mit einer Regierung der Regierungen zu tun. Es wäre eine brandgefährliche Entwicklung. Im Hintergrund der Aktivitäten der EU-Kommission droht die Gewährträgerhaftung der Mitgliedstaaten jede Haushaltsdisziplin zu unterminieren – entgrenzte Ausgabenpolitik trifft auf Brüsseler Allmachtsphantasien.
Brüssel musste sich in der Vergangenheit zu keiner Zeit marktwirtschaftlichen Regeln unterwerfen. Zur Not sprangen Mitgliedsstaaten ein oder man überließ es der Europäischen Zentralbank, über Anleihenkäufe die Haushaltslücken zu schließen.
Gelingt es der national-konservativen Opposition in der EU nicht, diese expansiven Umtriebe zügig einzuhegen, stehen wir am Beginn einer haushaltspolitischen Schuldenspirale. Es ist verständlich, dass Brüssel in diesem Umfeld auf die Einführung des digitalen Euro drängt. Das programmierbare Geld wäre die ideale Kapitalschranke, um die fortschreitende Flucht aus der Eurozone unter Kontrolle zu bringen.
Die Ohnmacht der Opposition angesichts der Zentralisierung politischer Macht und des wachsenden Interventionismus Brüssels zeigt, dass der Funktionärsapparat die Kontrolle übernommen hat. Schärfster Kritiker dieser Politik bleibt nach wie vor Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Dieser wies den geplanten EU-Haushalt unmittelbar zurück und bezeichnete ihn als „Haushalt der Hoffnungslosigkeit“, der die EU ruinieren werde.
Sollte sich keine Mehrheit im Ministerrat ergeben und beispielsweise Ungarn sein Vetorecht in der Haushaltsfrage geltend machen, wäre der vorgeschlagene Haushaltsentwurf zunächst einmal perdu. Dann gilt, bis es eine Regelung gibt, der alte Finanzrahmen als Obergrenze. Doch ist dies kein Grund zur Entwarnung.
Die EU-Kommission ist in der Vergangenheit äußerst kreativ gewesen, bestehendes Regelwerk auszuhebeln. So hat man neben den SURE-Anleihen zur unerlaubten Schuldenfinanzierung der EU auch die Maastricht-Kriterien, das Schuldenregelwerk der Nationalstaaten, still und heimlich zu Grabe getragen. Die Debatte um das Ende des Vetorechts im Rahmen des EU-Haushalts dürfte daher in Kürze wieder hochkochen.




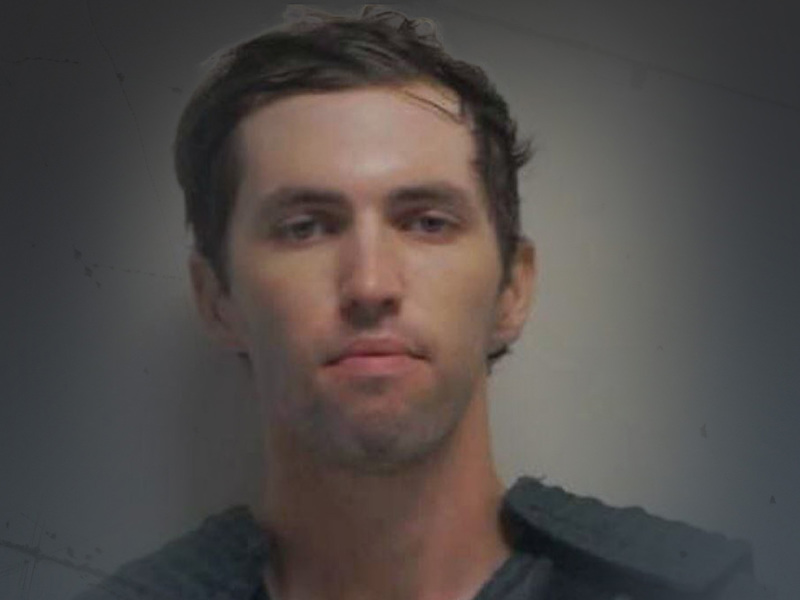




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























