
Es geht bergab mit der deutschen Automobilindustrie. Das zeigen die täglichen Meldungen über die Branche als Ganzes, über einzelne Autohersteller und fast alle Schwergewichte aus der Zulieferindustrie. Schon spotten Insider über den „Club der Dreißiger“, weil alle Hersteller, gleich ob VW, Porsche, Daimler oder BMW Ergebniseinbrüche von jeweils rund 30 Prozent in 2024 ausweisen mussten. Wobei bei allen betroffenen Unternehmen Absatzeinbrüche auf dem chinesischen Markt mit die Hauptursache waren, gepaart mit einer deutlichen Verfehlung der Verkaufsziele bei reinen Elektroautos (BEV).
Letzteres galt als Ausnahme nicht für den Nobel-Hersteller aus München, dafür verhagelten bei BMW Sonderaufwendungen das Betriebsergebnis. Mit zwei Milliarden Euro schlug eine globale Rückrufaktion wegen fehlerhafter Conti-Bremssysteme zu Buche. Was die Süddeutsche Zeitung mit der Headline kommentierte: „Auch der Streber hat Probleme“. (SZ, Nr. 62, 15/16.März 2025).
Als letzter komplettierte Audi das aktuelle Schreckenstableau der Autobranche: Auch die Ingolstädter mussten wegen Absatz- und Gewinneinbrüchen in 2024 zu scharfen Kotensenkungsmaßnehmen greifen – laut Betriebsrat die „Liste des Grauens“ genannt. Audi möchte sich bis Ende des Jahrzehnts nochmals von 7500 der insgesamt 54.000 in Deutschland beschäftigten Mitarbeiter trennen, diesmal im sogenannten “indirekten“ Bereich, also nicht in der wertschöpfenden Produktion. Der Produktionsbereich war bereits 2019 – als noch vor Corona und mitten im Auto-, aber eben nicht Audi-Boom – an der Reihe. Audi strich damals im Rahmen eines Sparprogramms 9.500 Stellen, die Jahreskapazitäten in den Werken wurden um 225.000 Autos eingedampft.
Zusammengefasst vermittelt die Autobranche im Frühjahr 2025 den Eindruck: Der bisherige Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft ist in der Krise: China bricht weg, der Verbrenner ist verpönt, das Elektroautos wird vom Publikum nicht wertgeschätzt. Ist die Autoindustrie am Ende?
Analysiert man die sogenannte Krise der deutschen Automobilindustrie unter ökonomischen Kriterien und nicht unter dem Aspekt des medialen Wettlaufs um die beste Schlagzeile, kommt man zu einem anderen Ergebnis. Die zentrale Frage lautet: Wann ist eine Branche in der Krise?
Grundsätzlich gilt: Eine so stark exportorientierte Branche wie die Autoindustrie, die zum Überleben den Weltmarkt braucht, ist nur bei nachhaltigen strukturellen Veränderungen ihrer Geschäftsgrundlagen bzw. Rahmenbedingungen existenziell getroffen, nicht bei konjunkturellen, nur vorrübergehenden „Schlechtwetter-Perioden.“
Strukturkrisen können zwei Ursachen haben. Da wären zum einen exogene Ursachen: In diesem Fall wird die Krise abrupt ausgelöst durch eine unvorhersehbare und irreversible Veränderung in den geschäftlichen Rahmenbedingungen, sei es bei den Angebotsbedingungen, z.B. bezüglich der Verfügbarkeit von Roh- oder Betriebsstoffen (z.B. Erdöl, Seltene Erden etc.) oder produktnotwenigen Zulieferteilen (z.B. Speicherchips), oder sei es aufgrund grundlegender Innovationen, die die bisherige Technologie obsolet machen. Oder sei es bei den Nachfrage- und Absatzbedingungen, z.b. Verlust von wesentlichen Auslandsmärkten durch aufkommenden Wettbewerb (z.B. durch die chinesische Autoindustrie) oder administrative Schutz- und Lenkungsmaßnahmen ( z.B. Zölle, politische Vorschriften etc.).
Die Veränderung der Geschäftsgrundlagen und damit die Krise ist in solchen Fällen häufig dauerhaft, eine Rückkehr zu alten Angebots- und Nachfragebedingen etwa ist in der Regel ausgeschlossen. Die Branche schrumpft, Unternehmen scheiden aus.
Zum anderen gibt es endogene Ursachen: Dann geht die Strukturkrise von den beteiligten Unternehmen aus, weil sie grundlegende Entwicklungen falsch eingeschätzt und falsche Entscheidungen getroffen haben. Oder weil das Management handwerkliche Fehler gemacht, d.h. Missmanagement betrieben hat.
Der wesentliche Unterschied gegenüber den exogenen Krisenursachen liegt darin, dass die betroffenen Unternehmen Handlungsspielräume haben, die Krise aus eigener Kraft zu beheben.
Im Fall der deutschen Automobilindustrie – Hersteller wie Zulieferer – neigt sich die Waage hin zu den endogenen, d.h. selbstverschuldeten Ursachen. Allerdings gibt es auch exogene Störungen, für deren Wirkung die Branche nur begrenzt „haftbar“ zu machen ist.
Dazu zählt an erster Stelle der Verlust von großen Teilen des chinesischen Marktes an die dortige Elektro-Konkurrenz. In China hat der VW-Konzern in guten Zeiten jährlich fast die Hälfte seiner Automobile verkauft, bei BMW, Mercedes und Porsche waren es zuletzt gut ein Drittel – fast alles Verbrenner Bei allen ist der Absatz 2024 um circa 30 Prozent eingebrochen, bei Porsche sogar um rund 40 Prozent. Die chinesischen Anbieter punkteten mit billigen, kleinen Elektroautos, gegen die die deutschen Verbrennner-Koryphäen mangels Angebot und Masse keine Chance hatten. Und auch in Zukunft absehbar kaum Chancen haben werden.
Dieser Verlust ist trotz aller Aufholanstrengungen der deutschen Autobauer weitgehend als dauerhaft anzusehen, da die Chinesen ihre Kompetenzen im Hinblick auf Elektromobilität weiter ausbauen. BYD etwa arbeitet an einem 1000 Volt-Schnelllade-System, das den Ladevorgang auf Verbrenner-Niveau verkürzen soll.
Die von allen Herstellern, vor allem von VW, unternommenen Versuche, die alte Marktposition wieder annährend zu erreichen, kosten Geld und Rendite, und vor allem Geduld und Zeit, und haben trotzdem nur eingeschränkte Erfolgschancen.
Die Autobranche ebenso wie die Anleger müssen sich auf ein strukturell geschrumpftes Niveau der automobilen Schlüsselzahlen einstellen. Das ist ein Niveau-Schnitt, aber keine Existenzkrise.
Mehr Handlungsspielraum haben die deutschen Autohersteller, bei den endogenen Krisenursachen. Dazu zählen das fahrlässige Vertrauen in ideologische politische Transformationswünsche und stattliche staatliche Kaufprämien ad Infinitum, grundfalsche Markteinschätzungen bezüglich der tatsächlichen Nachfrage nach Elektroautos, und daraus abgeleitet strategische Fehlinvestitionen in hohe E-Auto-Überkapazitäten bei gleichzeitiger Vernachlässigung einer klimafreundlichen Weiterentwicklung des traditionellen Standbeines Verbrennertechnologie. Einzige Ausnahme bei dieser krassen strategischen Fehlentwicklung war und ist BMW. Dort blieb man von Beginn an technologieoffen und setzte weiterhin auch auf die Verbrennertechnik, trotz des Umbaus des Stammwerkes München auf die Produktion von Elektroautos. Nach dem Motto: Das Eine tun, das andere aber nicht lassen.
Alle Hersteller haben hohe Investitionen zur Entwicklung der Elektrotechnologie getätigt, alle haben inzwischen internationale konkurrenzfähige Elektroautos im Programm, sind also bei der Aufholjagd gegenüber Tesla im Produkt sehr erfolgreich. Beim Absatz schlägt sich das aber nicht nieder. Alle haben hohe Verluste „produziert“. Die von allen – an der Spitze VW und Mercedes, zuletzt auch Porsche – propagierte Strategie, ab 2030 fast nur noch Elektroautos zu produzieren, wurde inzwischen stillschweigend kassiert. Der Markt machte nicht mit. Übrig blieben hohe Kosten und geringe Kapitalrückflüsse.
Die hausgemachten Krisensymptome bieten also nicht wirklich Anlass zu Sorgen um die Existenz der Branche, da diese Fehler erkannt sind und inzwischen korrigiert wurden – offen oder verdeckt. Auf der Strecke bleiben indessen viele kleine und mittlere Zulieferer, die ihren Abnehmern zwangsläufig gefolgt waren und ihre Verluste nun, anders als die Branchenriesen, nicht kompensieren können.
Auch dort dauert es allerdings seine Zeit, bis die vorgenommenen Korrekturen auch nach außen hin ihre Wirkung entfalten. Bis dahin muss die deutsche Autoindustrie selbstverschuldet durch eine Dürreperiode gehen.






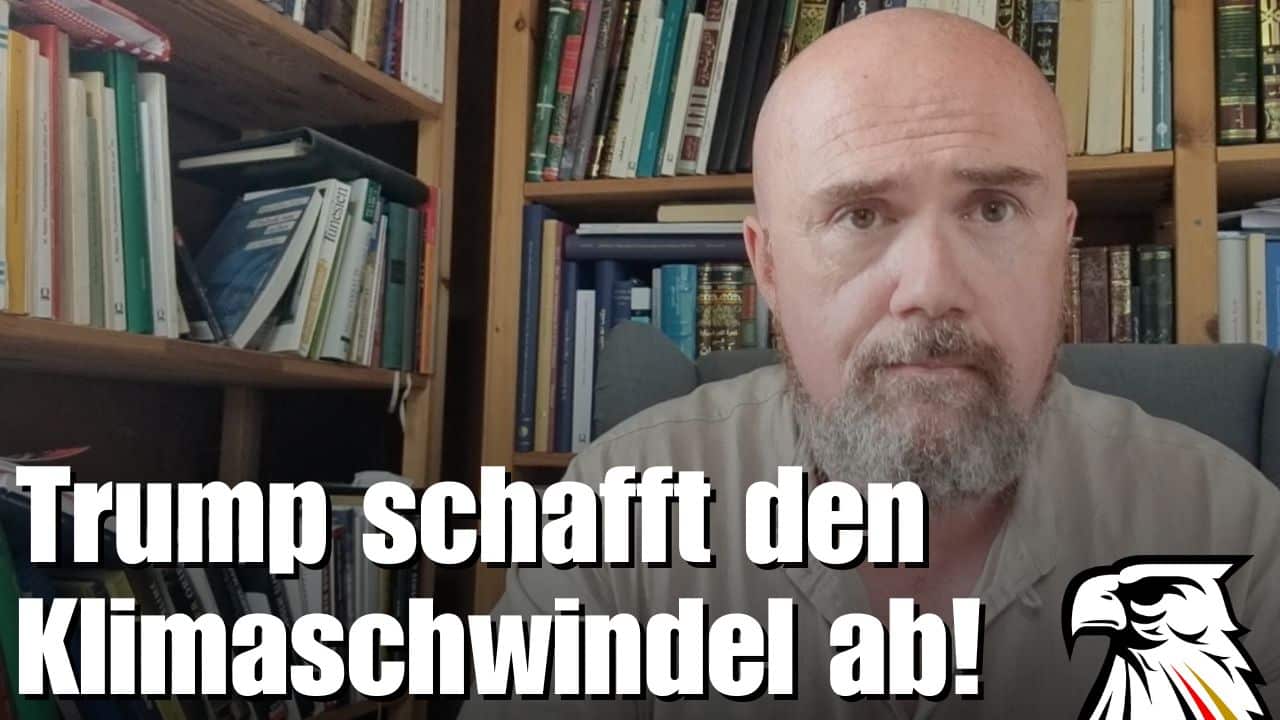
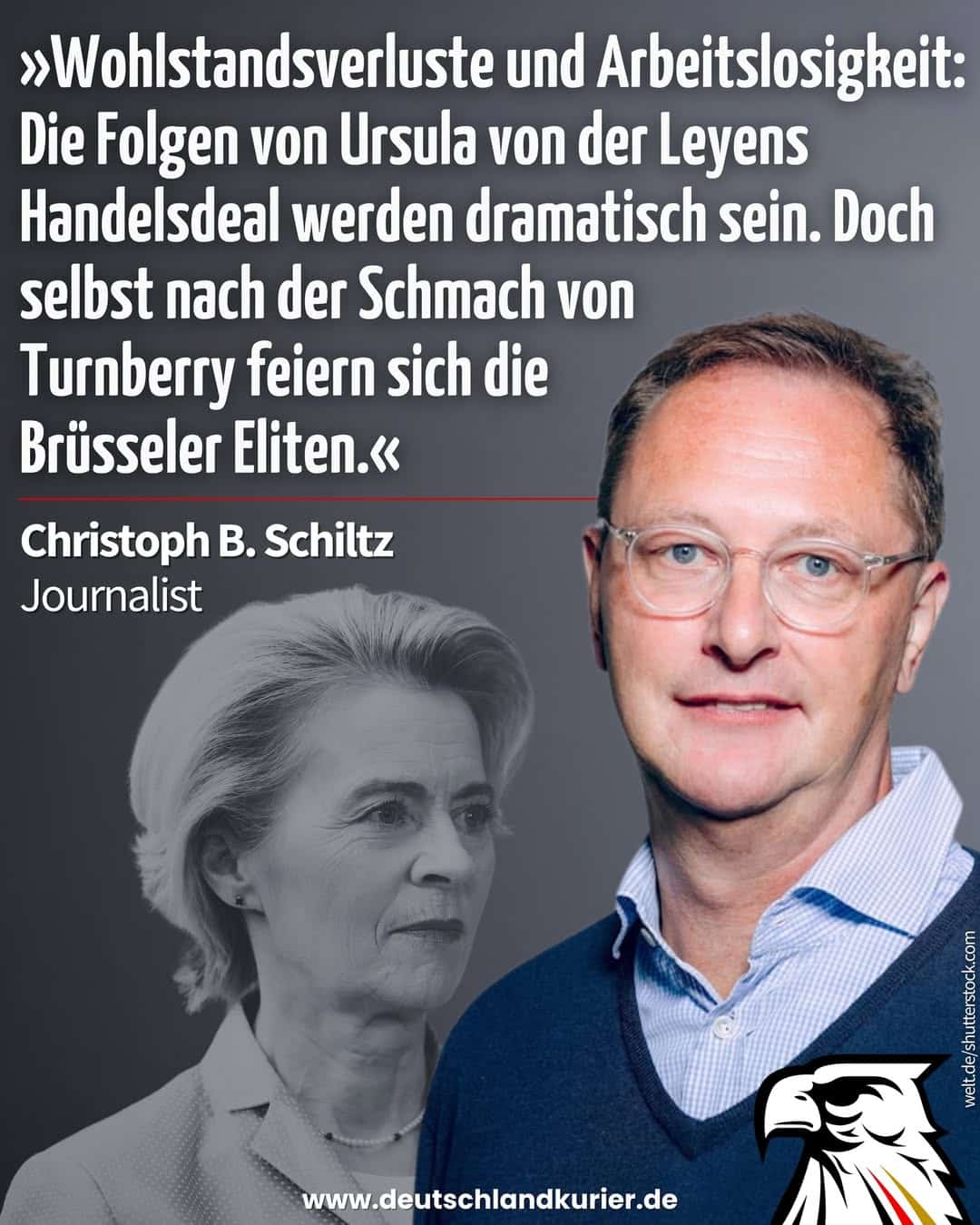

 NAHOST: WADEPHULS SCHWIERIGE MISSION - Außenminister besucht Israel und Palästinensergebiete |STREAM
NAHOST: WADEPHULS SCHWIERIGE MISSION - Außenminister besucht Israel und Palästinensergebiete |STREAM





























