
Der öffentlich-rechtliche Deutschlandfunk erklärt der Bevölkerung die Verschlechterung der Welt – allerdings auf eine Weise, bei der Regierungspolitik stets als klug und richtig erscheint, während oppositionelle Kritik als gefährlich, dumm oder populistisch diskreditiert wird. Besonders deutlich zeigt sich dieses Muster in der Art und Weise, wie der Podcast „Crashkurs – Wirtschaft trifft Geschichte“ die Deindustrialisierung nicht nur gelassen hinnimmt, sondern regelrecht beschönigt – als Chance zur Veränderung.
Seit Anfang 2024 sendet der Deutschlandfunk dieses neue Format. In halbstündigen Episoden sollen aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen mit Blick auf die Geschichte eingeordnet und lösungsorientiert aufbereitet werden. Was mit dem Anspruch startet, informativ und objektiv zu sein, mündet in ein ideologisch geglättetes Narrativ – so regierungsnah, als handle es sich um das Staatsfernsehen der DDR.
Das Muster: Die eigentlichen, politisch verursachten Krisen des Landes – etwa die evident staatlich mitverursachte Deindustrialisierung oder die strukturellen Probleme der Migrationspolitik („Wie Zuwanderung unseren Wohlstand sichert“) – werden nicht benannt. Stattdessen wird geschwiegen, relativiert oder umgedeutet. Jene Kräfte, die für einen grundsätzlich oppositionellen Kurs stehen, werden als Gefahr dämonisiert, während Regierungspolitik ins rechte Licht gerückt wird – als folgten Redaktion und Moderation einer unsichtbaren staatlichen Regieanweisung – von der die Redaktion aber in authentischer Weise überzeugt zu sein scheint.
Deutschlandfunk-Moderatorin Sandra Pfister, hier auf der Messe Re-Publica
Was lange als rechte Panikmache oder Verschwörungstheorie abgetan wurde, ist nun in der Realität angekommen – und sogar beim Deutschlandfunk. In einer aktuellen Folge heißt es nüchtern zur Deindustrialiesierung: „Wir stecken mittendrin. Punkt“, so Moderatorin Sandra Pfister. Ihr Kronzeuge: Prof. Dr. Moritz Schularick vom Kiel Institut für Weltwirtschaft, dessen Grundfinanzierung durch den Bund und das Land Schleswig-Holstein gewährleistet wird. Dass diese Finanzierung eine politisch-konformistische Ausrichtung empfiehlt, bleibt unerwähnt. Die Deindustrialisierung vollziehe sich seit „vielen Jahren“, so Schularick, „und daran wird sich auch nichts ändern“ – eine dogmatische Behauptung, welche die Folgen deutscher Politik zum Schicksal erklärt.
Moritz Schularick am 17.01.25 bei der „Innovationskonferenz“ Digital-Life-Design (DLD) im „House of Communication“ in München
Aber die sei ohnehin nicht tragisch: Denn „wir haben viel Erfahrung mit sterbenden Industrien“, so der Deutschlandfunk. Deshalb schaut er der Deindustrialisierung in engelsgleicher Unschuld mit einer rhetorischen Frage entgegen: „Wäre das so schlimm?“
Die Deindustrialisierung wird also faktisch anerkannt, doch bleiben ihre Ursachen weiterhin ein Tabu. Die Energiewende – finanziert durch hohe Steuern und Umlagen – hat die Strompreise in Deutschland massiv ansteigen lassen. Dass dies maßgeblich dazu führt, dass energieintensive Industriebetriebe schließen oder ins Ausland abwandern, wird im Podcast nicht einmal erwähnt. Stattdessen wird Deindustrialisierung als globaler, fast naturgesetzlicher Wandel dargestellt, den es mit „progressiver Politik“ zu gestalten gelte. „Wollen wir das aufholen“ – was genau, bleibt unklar – „oder im Wohlstandsmuseum leben und unseren langsamen Niedergang verwalten?“, fragt Schularick.
Als historisches Vorbild bemüht der Deutschlandfunk die deutsche Politik der 1970er-Jahre: Die Stahlkrise und das Ende des Kohlebergbaus hatten insbesondere das Ruhrgebiet getroffen – auf diese Herausforderungen habe die damalige Sozialpolitik aber vorbildlich reagiert. In Großbritannien dagegen, so die Sendung, habe Margaret Thatcher die Industrie „eiskalt“ sterben lassen – der Niedergang des „Rust Belt“ sei dort sogar politisch forciert worden.
Protest-Marsch der Stahlarbeiter nach Bonn – 24.03.1993
Englische Arbeiter im Jahr 1949 beim Bau der Silver Jubilee Bridge in Nordwestengland.
Es ist eine Form der „Analyse“, die ohne die Konstruktion von Feindbildern nicht auskommt: Anstatt hausgemachte Probleme zu thematisieren, wird Donald Trump als abschreckendes Beispiel inszeniert. Denn Trump gehört zu den wenigen westlichen Regierungschefs, die der Deindustrialisierung ihres Landes aktiv etwas entgegensetzen wollen, mit dem Ziel, amerikanische Industriearbeit zurückzuholen.
Trump war bereits erfolgreich: Allein zwischen seinem Amtsantritt und Februar 2020 wurden in den USA rund 510.000 neue Industriearbeitsplätze geschaffen – ein Erfolg, der im Podcast unerwähnt bleibt. Denn entscheidend ist das Framing: hier die dunkle Versuchung des Populismus – dort die lichte Vernunft der Transformation.
Ein Satz gegen Ende der Episode spricht Bände über die Denkweise der Redaktion: „Wir müssen dorthin gehen, wo die Wertschöpfung wieder aus der gedanklichen, intellektuellen Arbeit unserer Mitarbeitenden kommt“, so die gegenderte Prognose eines Experten.
Dass diese „intellektuelle Arbeit“ einer akademischen Funktionärsschicht, die aus ideologischen Gründen bereit ist, grammatikalisch falsch zu sprechen, keine Maschinen baut und keinen Stahl produziert, also ernsthaft für Wertschöpfung sorgt, das scheint ihren Vertretern nicht im Ansatz zu dämmern. Der Eindruck, man könne den industriellen Sektor weitestgehend durch Kopfarbeit ersetzen, ist nicht nur elitär, sondern auch ökonomisch illusionär. Der Deutschlandfunk demonstriert unfreiwillig jene Realitätsferne, die sich nur leisten kann, wer am Markt nicht produzieren muss.
Lesen Sie auch: Kissler Kompakt: Die Deindustrialisierung ist das schlimmste Erbe der Ampel




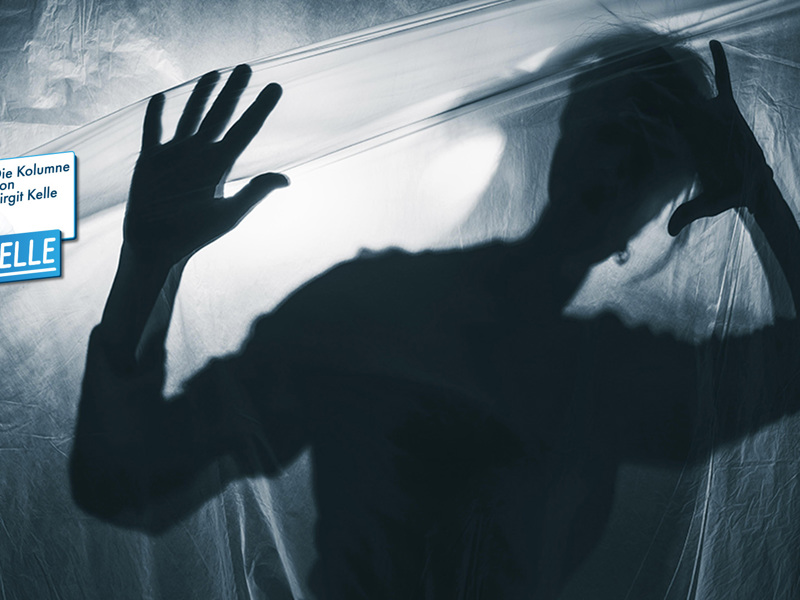



 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























