
Bis 2038 soll Schluss sein mit der Kohleverstromung in Deutschland. Nach dem Aus der Kernenergie verabschiedet sich die Bundesrepublik aus der Nutzung eines weiteren grundlastfähigen Energieträgers. Sollte jedoch die Versorgungssicherheit gewährleistet sein, wäre ein Ausstieg aus der Kohleenergie auch bereits im Jahr 2030 denkbar, so der Wunsch der Bundesregierung. Für das Rheinische Kohlerevier wurde dieses Ziel bereits durch die nordrhein-westfälische Landesregierung fixiert. Im strukturschwächeren Osten hingegen will man bis 2038 an der Nutzung der Kohle festhalten. Angesichts schleppenden Netzausbaus und fehlender Speicher erscheint eine bundesweite Fristverkürzung vollkommen unrealistisch und energiewirtschaftlich riskant.
Um dem politischen Willen zum Kohleausstieg weiteren Nachdruck zu verleihen, hat die Bundesregierung nun 514.000 Emissionszertifikate aus dem Europäischen Emissionshandel gelöscht. Der Druck auf emissionsintensive Betriebe und Sektoren soll, trotz der Energiekrise im Land, weiter angehoben werden. Allerdings entsprechen die gelöschten Zertifikate lediglich rund 0,53 Prozent der deutschen Auktionsmenge im laufenden Jahr, die bei 96,76 Millionen Zertifikaten liegen soll.
Setzt man diese Löschung in Relation zum Gesamtvolumen des EU-ETS, handelt es sich bei diesem Schritt lediglich um eine symbolpolitische Maßnahme. Derzeit werden zwischen 1,1 und 1,3 Milliarden Zertifikate im europäischen Markt gehandelt. Zur Verteuerung der Nutzung von CO2-Kapazitäten wird das Zertifikatevolumen jährlich kontrolliert um 2,2 Prozent gesenkt. Die Verteuerung soll wirtschaftliche Anreize schaffen, in emissionsfreie oder effizientere Produktionstechnologien und Energieträger zu investieren.
Der Druck auf die Wirtschaft baut sich weiter auf: Bereits vor drei Jahren setzte die Regierung mit der Abschaltung der Kraftwerksblöcke Neurath A und Frechen ehrgeizige Einsparziele um und reduzierte die emittierte Menge CO2 um rund 890.000 Tonnen. Der Großteil dieser Einsparung wurde bereits über die Marktstabilitätsreserve (MSR) aus dem Markt genommen – ein europäischer Mechanismus, der bei einem politisch definierten Überschuss an umlaufenden Zertifikaten die Auktionsmengen automatisch reduziert.
Dennoch bleibt die Kohle ein fundamentaler Energieträger im deutschen Energiesektor: Ihr Anteil am Strommix lag zuletzt bei rund 27 Prozent, im gesamten Primärenergieverbrauch pendelt sie bei etwa 19 Prozent.
Die nun vollzogene Löschung von 514.000 Emissionszertifikaten – jedes einzelne Zertifikat steht für eine Tonne CO2 – soll sicherstellen, dass die durch den Kohleausstieg in Deutschland vermiedenen Emissionen nicht an anderer Stelle innerhalb des EU-Handelssystems durch Verlagerungsinvestitionen einfach wieder aufleben. Damit steigt zugleich der Druck auf jene europäischen Standorte, die weiterhin überwiegend auf konventionelle Energieträger setzen – wie es in Teilen Osteuropas nach wie vor gängige Praxis ist. Die deutsche Löschung wirkt damit nicht nur innenpolitisch, sondern entfaltet Signalwirkung im europäischen Kontext.
Während die Politik ihre Emissionserfolge feiert, stellt sich die Lage im realen Leben in der energieintensiven Ökonomie wie auch bei den privaten Haushalten angesichts steigender Energiekosten ganz anders dar. Und es geht nicht nur um die Effekte der Wackelenergie erneuerbarer Energieträger bei der Stabilisierung der Netze, die unter dem Wegfall grundlastfähiger Energieträger wie der Kohle leiden. Der Blackout auf der iberischen Halbinsel gibt uns eine Idee von den Folgen dieser Politik.
Was am grünen Tisch als geradliniger Transformationspfad geplant wurde, entpuppt sich in der Realität aufgrund völlig unterschätzter Komplexität von Energiesystemen als ökonomisches Fiasko. Die grüne Wende hat die Industrieproduktion in Deutschland zum Luxusgut gemacht und der Herzkammer der deutschen Wirtschaft, der Automobilindustrie, einen schweren Schlag versetzt. Der Industriestrompreis liegt am Standort Deutschland zum Teil über 150 Prozent höher als an Referenzstandorten wie den USA, was die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft erodiert, während steigende Stromkosten – von denen der Staat rund ein Drittel als Steuern abschöpft – die finanzielle Lage der Haushalte empfindlich belasten.
Dass sich die Politik in diesem Kräftefeld passiv verhält, ist kaum überraschend. Zum einen verdient der Fiskus an steigenden Strompreisen, zum anderen lautet das erklärte Ziel der Politik, den Energiekonsum allgemein zu senken. Dazu bedarf es steigender Preise, auch wenn man das nicht offen zugeben will, um den Wähler nicht zu verschrecken. Das gebrochene Versprechen der Bundesregierung, die Stromsteuer senken zu wollen, folgt dieser Linie ebenso wie die Ablehnung eines subventionierten Industriestrompreises für die gebeutelte Industrie. Immerhin kann sie in diesem Falle den Schwarzen Peter auf die EU-Kommission als verantwortliche Entscheidungsinstanz schieben.
Deutschland steckt in einer energiepolitischen Sackgasse. Den grünen Industriestaat, wie ihn sich die Politik erträumt, wird es in dieser Form nicht geben. Das Land steigt aus grundlastfähigen Energieträgern aus, löscht CO2-Zertifikate – und zahlt gleichzeitig Rekordpreise für Stromimporte aus dem Ausland. Mit ihrer inkonsistenten Klimastrategie untergräbt die Politik die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und trifft die finanzielle Substanz der Haushalte ins Mark.




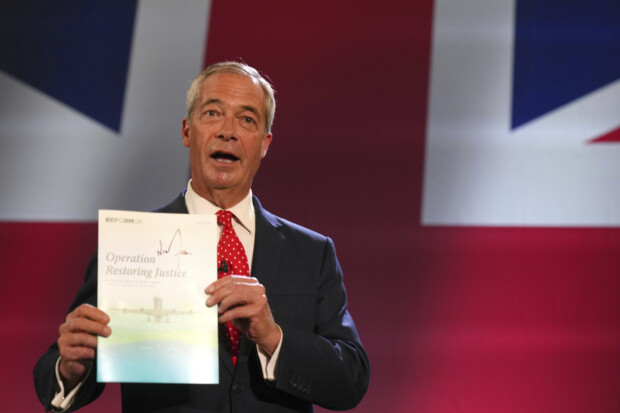





 PUTINS KRIEG: Russland will Angriffe auf Ukraine verstärken! Selenskyj will Sanktionen | WELT STREAM
PUTINS KRIEG: Russland will Angriffe auf Ukraine verstärken! Selenskyj will Sanktionen | WELT STREAM






























