
Die ersten 100 Tage im Amt gelten seit jeher als wichtiger Gradmesser für einen neuen Präsidenten. Ob man seine Arbeit nun gut oder schlecht findet, Trump hat in etwas mehr als drei Monaten mehr unternommen als viele Präsidenten vor ihm in vier oder gar acht Jahren. Trump führt ein revolutionäres Projekt an, das Wirtschaft, Bürokratie, Kultur, Außenpolitik und sogar die Idee Amerikas neu gestalten will.
Der US-Präsident setzt auf die uneingeschränkte Macht der Exekutive. In Anlehnung an Richard Nixon ist alles, was der Präsident tut, legal. Mit Hunderten Dekreten hat Trump nicht nur wichtige Akzente gesetzt. Er hat zugleich einen Paradigmenwechsel in der US-amerikanischen Außenpolitik eingeleitet, der seit Jahrzehnten geltende Grundsätze infrage stellt: Dazu gehören das Bekenntnis zur Nordatlantischen Allianz (NATO), zu freiem Welthandel und zu der sogenannten regelbasierten Weltordnung.
Spätestens seit der spektakulären Konfrontation zwischen Selenskyj und Trump im Weißen Haus ist klar, dass Trump neue Maßstäbe in der Weltpolitik setzt. Trump ist ein Unternehmer, der seine Außenpolitik an einem Geschäftsmodell ausrichtet, das sich von den Werten des sogenannten „kollektiven Westens“ löst. Er bewertet Außenbeziehungen nach der Gewinn- und Verlustrechnung für Washington. Dabei lässt Trump sich von der Überzeugung leiten, dass die Welt von einer Gruppe von Akteuren beherrscht wird, getrieben von nationalen Interessen und Machtpolitik.
Trump sieht Geopolitik gern als Kartenspiel: China, Mexiko, Nordkorea, sogar die TikTok-App – er bezeichnete sie alle als Spieler in einem Kartenspiel. Die USA hätten dabei „selbstverständlich“ immer die besseren Karten. Seine militärische und wirtschaftliche Macht, so glaubt Trump, sollte ihm den Sieg in jedem diplomatischen Konflikt garantieren. Nur der Schwäche und Dummheit seiner Vorgänger sei es zu verdanken, dass andere Länder US-amerikanische Verbraucher ausbeuten oder sich kostenlos unter dem amerikanischen Sicherheitsschirm verstecken konnten.
Die Demokratieförderung und der Internationalismus als außenpolitische Leitlinien der USA seit Ende der Blockkonfrontation scheinen in Trumps Ära zu Ende zu gehen. Die Größe des Territoriums als Maßstab für nationalen Erfolg und eine merkantilistische Weltanschauung kehren zurück. Auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, Chinas Drohgebärden gegenüber Taiwan folgten in den vergangenen Monaten Donald Trumps Drohungen, Grönland und Kanada zu annektieren und Gaza zu besitzen. Ökonomie und Militär werden nun zu den Mitteln einer unaufhörlichen Expansion.
All dies deutet darauf hin, dass die Welt vor einem neuen Kampf um Einflusssphären steht, wie im 19. Jahrhundert. Mit Trump redet man nun auf einmal von der Rückkehr des Imperialismus. Das´ gehört aber dazu, dass das Projekt des sogenannten „Wertewestens“ auch imperialen, hegemonialen Charakter hatte und hat. Denn sie richtete sich bis 1990 gegen die Sowjetunion und ihre Vasallen. Es hieß damals Freiheit statt Sozialismus, und heißt heute Freiheit gegen Autokratie.
Trump ist aber nicht der Auslöser des neuen Imperialismus, sondern er verkörpert den neuen Zeitgeist, während die alte Weltordnung an ihre Grenzen stößt. Dies manifestiert sich in aktuellen Krisen, wie beispielsweise der Massenmigration und neuen Konfliktherden, denen die vom Westen geförderte „regelbasierte“ Weltordnung nicht mehr gewachsen ist.
In der Zwischenzeit begann weltweit der Aufstieg von Staatsmännern, die sich wieder auf knallharte Realpolitik besannen und die schwindende geopolitische Dominanz des Westens zu ihrem Vorteil nutzen wollten. Putin will Russland wieder zur imperialen Großmacht machen. Der saudische Kronprinz Muhammad bin Salman will den Nahen Osten modernisieren, und der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu beschleunigt seine schleichende Annexionspolitik und strebt regionale Hegemonie in Nahost an. Xi Jinping will China zur Weltmacht Nummer eins machen und die US-Hegemonie beenden. Die Türkei unter Recep Tayyip Erdoğan träumt von der Wiedererrichtung des Osmanischen Reiches im Nahen Osten und in Osteuropa. Der Iran strebt den Bau einer Atombombe an. An weiterer Stelle stehen die Verbündeten der USA in Westeuropa, deren Abhängigkeit und Loyalität als Schwächen angesehen werden, die es auszunutzen gilt. Mit Donald Trump im Weißen Haus gibt es nun einen weiteren „Strongman“, der die Führungsmacht des alten Westens vertritt.
USA setzten nach 1948 darauf, die im Osten und Westen jeweils gegenüberliegende Küste in ein amerikanisch dominiertes Bündnissystem zu integrieren. Die Voraussetzung für das Funktionieren dieser Allianzen war, dass die USA in höherem Maße als die Verbündeten selbst für deren Sicherheit sorgten. Die Kosten und Lasten dieser Sicherung der Gegenküste konnten sie sich über Jahrzehnte leisten. Das hat sich aber geändert, seitdem der Anteil des US-amerikanischen Bruttoinlandsprodukts an der globalen Wertschöpfung prozentual gesunken ist und USA sich mit dem Nahen und Mittleren Osten auf politische Herausforderungen eingelassen hat.
Bislang hat Trump seine außenpolitischen Ambitionen nicht durchsetzen können. Trumps Plan für einen Waffenstillstand in der Ukraine wackelt, Hamas und Israel haben die Kämpfe wieder aufgenommen. Die arabischen Länder wollen von einer amerikanischen Übernahme des Gaza-Streifens nichts wissen. Die Hoffnungen auf eine Einigung zwischen den USA und China zur Beilegung der Handelskonflikte haben sich in den letzten Tagen zerschlagen, da sich Peking im Handelskrieg mit den USA plötzlich unnachgiebig zeigt.
Der aktuelle Handelskonflikt mit China hat auch gezeigt, dass Trumps Schwachpunkt in der internationalen Politik die Wirtschaftslage in den USA ist. Die Mehrheit der US-Bürger will keine Revolution. Die Idee, die Produktion ins Land zurückzuholen, gefällt vielen, aber nur ein Viertel gibt in aktuellen Umfragen an, in den neuen Fabriken arbeiten zu wollen. Die Idee des fairen Handels gefällt ihnen, aber sie wollen kein Chaos. Niemand will Inflation. Das heißt, in einer rein transaktionalen Welt, in der die USA ihre supranationalen Prinzipien aufgeben und nationalistisch agieren, dürfte Trump das Spiel nicht so einfach finden und seine Karten nicht immer so stark. Denn es wird immer Akteure geben, die bessere Karten haben als Trump.





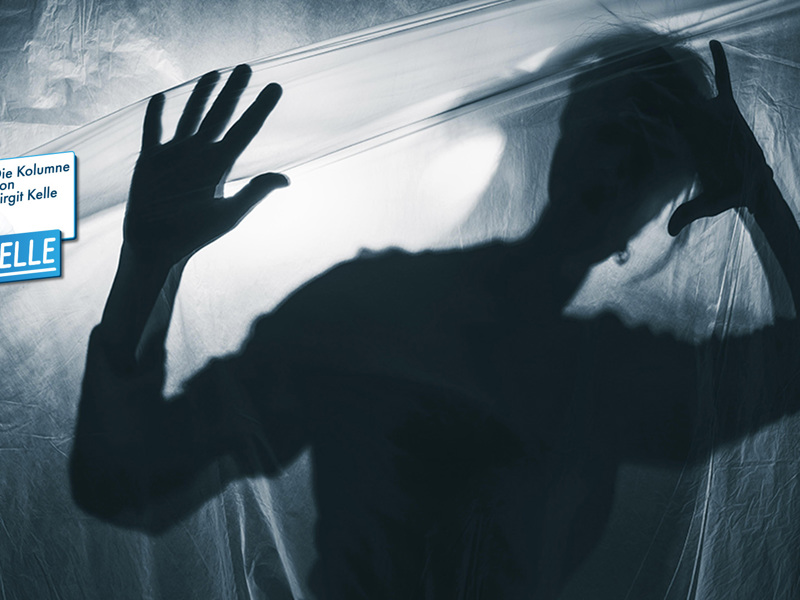


 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























