
Hannah Arendts Bericht über „Eichmann in Jerusalem“ zählt zu den größten journalistischen Texten überhaupt. Sie berichtet über den Prozess gegen Adolf Eichmann so nüchtern und detailliert und als verfolgte Jüdin mit fast unerhörtem Verständnis für den Architekten des Holocausts, dass es ihr gelingt, Unglaubliches über die Moral und den Menschen an sich zu Tage zu fördern. Zentral ist die Feststellung über Eichmann, „dass ein durchschnittlicher, ‚normaler‘ Mensch, der weder schwachsinnig noch eigentlich verhetzt, noch zynisch ist, ganz außerstande sein soll, Recht von Unrecht zu scheiden.“ Sie erkennt in Eichmann nichts Diabolisches, nichts Dämonisches, sondern nur einen „Hanswurst“, der „erschreckend normal“ war.
Der Mann, der die Wannseekonferenz vorbereitete, organisierte die Logistik des Massenmords, ohne überhaupt nur ein glühender Antisemit zu sein. Das Gefährliche Eichmanns erkennt Arendt stattdessen in seiner „Gedankenlosigkeit“ – es reichte der unbedingte Wille, Befehle auszuführen, und die Verweigerung, sich die Konsequenzen seiner Taten auch nur vorzustellen. Im Prozess gegen Eichmann wurde der Anspruch an den Menschen entwickelt, dass er das Richtige vom Falschen auch dann noch unterscheiden können muss, wenn das Falsche legal ist und wenn er „wirklich auf nichts anderes zurückgreifen kann als auf das eigene Urteil“. Dieser Maßstab sollte auch heute noch jeden nachdenklich stimmen.
Nun sind wir weit entfernt vom Massenmord und ein Vergleich würde sich verbieten, dennoch leitet uns Arendts Betrachtung zu einer Erkenntnis darüber, was überhaupt richtig und falsch, Recht und Unrecht ist und was von den Menschen verlangt werden muss, um einen Rechtsstaat zu erhalten. Wir können von ihr lernen, dass im Mittelpunkt einer solchen Moral die Pflicht jedes Menschen zur unbedingten Urteilsfähigkeit steht. Bei Kant habe niemand das „Recht zu gehorchen“, formuliert sie.
Auch heute müssen wir uns auf eine fundamentale Ablehnung von moralischem Legalismus besinnen, auf eine Skepsis gegenüber den technokratischen Dynamiken bürokratischer Strukturen und ein prinzipielles Zurückweisen von Herrschaftsargumenten in der Politik. Genau das aber fehlt mittlerweile immer stärker, das ist spätestens seit den Corona-Jahren klar, und auch in der Debatte um die Nominierung der Verfassungsrichter zeigt sich diese Problematik erneut.
Wir erleben auch hier wieder einen fast kitschigen Glauben an das Expertentum, verbunden mit dem linken Anspruch, die Laien (die Bürger) dürften eigentlich gar nicht mehr mitsprechen – das eigene Nachdenken gilt eher als peinlich. Gleichzeitig wird das Ergebnis bürokratischer Prozesse als unumstößliche Wahrheit hingenommen. Immer mehr politische Beobachter sind beispielsweise der Meinung, Gerichtsurteile dürfe man erst gar nicht mehr hinterfragen oder kritisieren – und auch die Kritik an einer Richterkandidatin gilt schon als „Beschädigung“ des Rechtsstaats.
In der Debatte um die Menschenwürde des ungeborenen Lebens wird aktuell oftmals rein legalistisch argumentiert – für Kritiker, die sich auf tiefere Werte wie das christliche Menschenbild berufen wollen und von einer Gewissensentscheidung sprechen, findet sich medial wenig Verständnis. Gleichzeitig erklärt man bei Frauke Brosius-Gersdorf den Expertenstatus für fast schon unkritisierbar. Sie als Professorin, als Wissenschaftlerin sage dies und jenes – und die meisten Medien wiederholen es einfach. Diese Debatte ist vor allem deshalb so frustrierend, weil sich die meisten Journalisten schlichtweg weigern, die Gutachten und Texte von ihr zu lesen und einen eigenen Schluss daraus zu ziehen – und lieber auf Brosius-Gersdorf bei Lanz vertrauen, die (als Wissenschaftlerin) erklärt, alles sei in bester Ordnung.
Das öffentlich-rechtliche Magazin ZAPP attackiert jetzt über 17 Minuten vermeintlich rechte Medien wie Apollo News in der Debatte – kein einziges Mal wird dabei allerdings ein konkreter Fehler gefunden oder überhaupt inhaltlich in die Debatte eingestiegen. Dafür garniert man die Rezitierung von Brosius-Gersdorf bei Lanz mit zwei braven Experten und fordert schließlich von uns eine Distanzierung von unserer eigenen Berichterstattung, ohne aber überhaupt nur konkret zu sagen, warum. Dann meint der Moderator auch noch vorwurfsvoll, die Abstimmung über Brosius-Gersdorf hätte doch eigentlich eine Abstimmung sein sollen, „die der Bundestag mal eben auf einer Arschbacke runterreißt“. Selten hat sich die Hilflosigkeit des „expertengetriebenen Journalismus“, der jede eigene Analyse des Inhalts einer Sache vermeidet, offener gezeigt.
Das linke Totschlagargument ist ja häufig, dass wir erst 80 Millionen Fußballtrainer in diesem Land gehabt hätten, dann 80 Millionen Virologen, jetzt 80 Millionen Rechtswissenschaftler. Es zeigt die Arroganz und das Misstrauen gegenüber einem mündigen Volk – außerdem wäre es auch vollkommen sinnlos, Fußball zu schauen, ohne eine Meinung zu haben.
Der alte linke Glaube an den allmächtigen, alles bestimmenden Staat mit absolutem Wahrheitsanspruch ist nicht neu – die Staaten des Ostblocks beriefen sich stets auf den wissenschaftlichen Marxismus. Dem totalen Machtanspruch linker Ideologien ist immer der Glaube an die Ausrechenbarkeit der Gesellschaft vorgelagert. Dass das aber eben auch mit den besten Computern niemals möglich sein wird, ist ja gerade der Grund für das Scheitern des Sozialismus.
Es liegt im Wesen organischer Systeme, dass die Welle einer Pandemie genauso wenig prognostizierbar ist wie die Klimaentwicklung, die Konjunktur oder ein Aktienkurs. Ein wesentliches Argument für die Freiheit ist ja gerade die Erkenntnis über die Begrenztheit des Wissens und der Gegenstände, über die überhaupt eine Erkenntnis möglich ist – folglich haben wir gar keine Alternative zum Pluralismus. Genau diese Einsicht in diegrundsätzliche Begrenztheit des Wissens wird von der Expertokratie bestritten – und zwar egal, wie oft sich die wissenschaftlichen Prognosen in Serie als falsch erweisen. Das ideologisch getriebene radikale Überschätzen der Experten hat immer dramatischere Auswirkungen.
Die Expertokratie muss heute ganz grundsätzlich zurückgewiesen werden. Es braucht im Gegenteil regelrecht eine emotionale Befreiungsbewegung in der Bevölkerung – ein neues Selbstbewusstsein zur eigenen Meinung. Denn die Bürger dieses Landes haben nicht nur ein Recht auf eine dezidierte Meinung zu Fragen wie der Richterbesetzung – sie haben in gewissem Sinne die unbedingte Pflicht dazu.





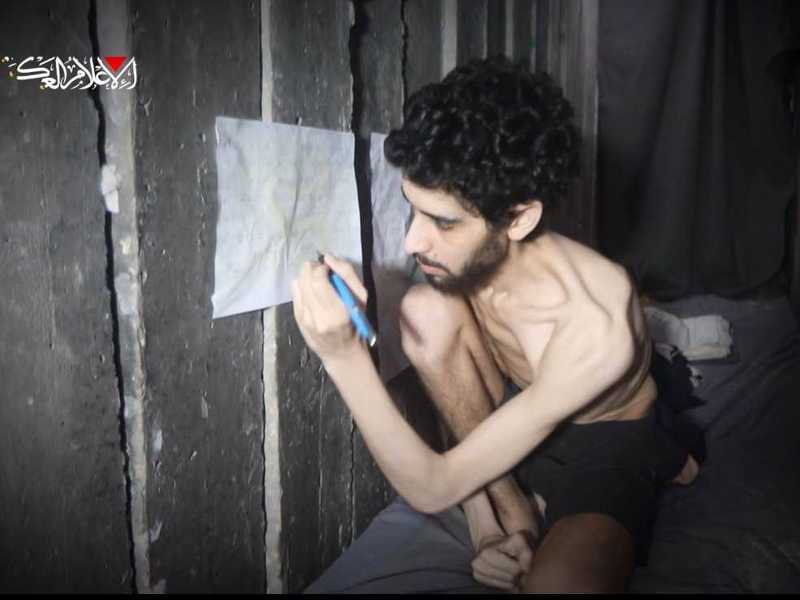

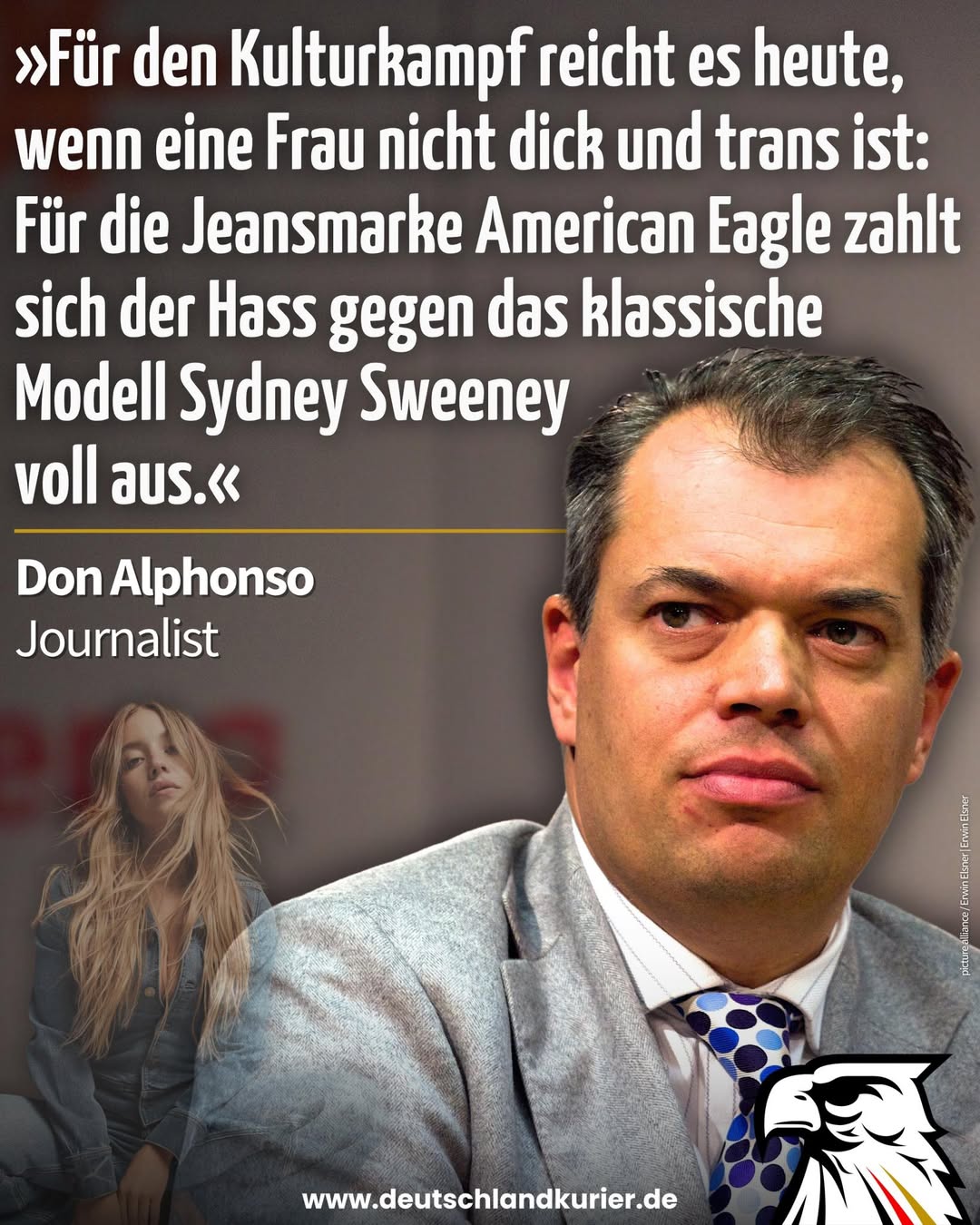


 PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM
PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM





























