
Es ist nur ein paar Monate her, dass der in jeder Hinsicht schillernde Österreicher René Benko eine der spektakulärsten Pleiten Europas hinlegte. Zum Zeitpunkt ihrer Insolvenz bestand seine Signa-Gruppe aus über 1000 Unternehmen. Die Strukturen waren undurchsichtig, viele Gesellschaften waren untereinander verschachtelt.
Benko hatte die Signa, die deutsche Fluchthelferbranche hat Pro Asyl. Dieses Imperium zur Förderung der Zuwanderung nach Deutschland gliedert sich in formal unabhängige, tatsächlich aber eng miteinander verzahnte Körperschaften. Es sind keine Tochtergesellschaften im wirtschaftlichen Sinn, sondern juristisch selbstständige Organisationsteile.
Die BAG Pro Asyl ist ein im Jahr 1986 gegründeter Zusammenschluss von Mitarbeitern der Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrts- und Menschenrechtsorganisationen sowie sogenannter „Flüchtlingsräte“. Die BAG stößt nach eigenen Angaben „Kampagnen und öffentliche Diskussionen“ zu asylrechtlichen und flüchtlingspolitischen Themen an. Übersetzt: Hier werden Strategien festgelegt.
Der Förderverein Pro Asyl ist das operative Zentrum und sozusagen auch die Kasse von Pro Asyl. Der Förderverein finanziert die konkrete Unterstützung von Asylbewerbern, die Rechtshilfe und die sonstigen Projekte. Letztere setzen sich zusammen aus politischen Kampagnen, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Vernetzung mit anderen als Menschenrechtsorganisation firmierenden Vereinigungen. Im Lobbyregister des Deutschen Bundestages ist der Förderverein seit 2022 unter der Nummer R001885 registriert.
Die Stiftung Pro Asyl wurde im Jahr 2002 gegründet und ist so etwas wie die Vermögens- und Anlageverwaltung des Asyl-Konzerns. Im eigenen, typischen Jargon klingt das so: „Ziel ist die Finanzierung der Flüchtlings- und Menschenrechtsarbeit auf lange Sicht.“ Die Stiftung bezahlt mittel- und langfristige Projekte, vergibt Auszeichnungen und auch Stipendien. So geht auch der Nachwuchs nicht aus.
Das Netzwerk Pro Asyl ist so etwas wie die Abteilung für interne Kommunikation der deutschen Asylindustrie. Das Netzwerk ist zwar keine rechtlich eigenständige Körperschaft, aber die informell wohl wichtigste Einrichtung für den Informationsaustausch und die Verbindung zu Gleichgesinnten in der Gesellschaft.
Zum Netzwerk gehören nicht nur die „Flüchtlingsbeiräte“ in allen 16 Bundesländern, sondern auch fünf andere Organisationen: das „Forum Menschenrechte“, das „Netz gegen Rassismus“, der „Informationsverbund Asyl“, die „National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention“ und die „Interkulturelle Woche“.
Das sieht oberflächlich nicht nach übermäßig viel aus. Doch hinter jeder einzelnen dieser fünf Organisationen stehen wiederum jeweils zahlreiche andere – und große.
Die folgende Aufstellung zeigt einen Ausschnitt der wichtigsten und bekanntesten, tatsächlich jedoch sind es viel mehr.
Zahlreiche Organisationen wie der Berufsverband Deutscher Psychologen oder die Deutsche Wanderjugend tauchen hier gar nicht auf. Erst diese Liste hinter der Liste gibt den Blick darauf frei, wie weit die Strippen reichen, mit denen Pro Asyl verbunden ist.
Durch die personellen Überschneidungen wird eine weitgehend einheitliche Ausrichtung des „Konzerns“ erreicht. Gleichzeitig bleiben die ideellen Profitcenter formaljuristisch getrennt. So werden Schwierigkeiten bezüglich der Zweckbindung von Mitteln umgangen, die zu steuerrechtlichen Problemen bei der Gemeinnützigkeit führen könnten.
Praktisch alle Funktionäre bei Pro Asyl kommen aus demselben Milieu: eine Politologin, ein Soziologe, eine Theologin, eine Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte, ein Fachanwalt für Migrationsrecht, ein Referent für Migrationsfragen. Viele haben einen kirchlichen Hintergrund, viele verdienen mit dem Thema ihren Lebensunterhalt.
Pro Asyl selbst finanziert sich nach eigenen Angaben über Mitgliedsbeiträge, Spenden und Erträge aus dem Stiftungskapital. Im Geschäftsjahr 2023 wurden keine direkten öffentlichen Zuschüsse von mehr als 10.000 Euro ausgewiesen.
Indirekt sieht das allerdings anders aus. Die Stiftung Pro Asyl ist als gemeinnützig anerkannt. Gemeinnützigkeit bedeutet, dass Erträge aus dem Stiftungskapital nicht versteuert werden müssen. Die „Frankfurter Allgemeine“ schrieb einmal: „Im Grunde sind Stiftungsmittel Steuergelder, die der Staat einer Stiftung anvertraut.“ Allein schon die weitgehende Steuerbefreiung stellt eine indirekte, aber relevante öffentliche Förderung dar.
Die Stiftung Pro Asyl unterhält seit 2010 ein Stipendienprogramm für junge Flüchtlinge. Das wird von der START-Stiftung finanziell unterstützt. Die wiederum wird von der Hertie-Stiftung getragen. An einem einzigen Stipendienprogramm sind also mindestens drei steuerbegünstigte Stiftungen mittelbar beteiligt.
Ein weiterer bevorzugter Partner der Stiftung Pro Asyl ist ein guter Bekannter aus der Welt der staatlich alimentierten linken NGOs: die Amadeu-Antonio-Stiftung von Ex-Stasi-Mitarbeiterin Anetta Kahane, deren nebulös formulierter Zweck die „Stärkung einer demokratischen Zivilgesellschaft“ ist. Mit ihr arbeitet Pro Asyl regelmäßig zusammen – zum Beispiel bei einer Dokumentation flüchtlingsfeindlicher Vorfälle und bei der gemeinsamen Kampagne „Pro Menschenrechte. Contra Vorurteile“. Zu Letzterer haben beide ebenfalls gemeinsam eine Broschüre herausgegeben, die auch von den „Landesflüchtlingsräten“ unterstützt wurde.
Die Amadeu-Antonio-Stiftung ist nicht rechtlich, aber de facto eine vom Staat abhängige Einrichtung: Im Kalenderjahr 2022 nahm sie 1,9 Millionen Euro an Spenden ein, erhielt aber – vor allem über das Programm „Demokratie leben!“ – vom Bundesfamilienministerium 6,2 Millionen Euro an öffentlichen Zuschüssen. Besser hätte es auch René Benko kaum machen können.
Der Förderverein Pro Asyl lebt zum Teil von den Beiträgen und Spenden seiner etwa 25.000 Mitglieder. Eine reguläre Fördermitgliedschaft kostet 40 Euro pro Jahr, das macht eine Million jährlich (ohne Ermäßigungen). Wohl durch freiwillige Aufstockungen sind es tatsächlich zwei Millionen. Im Lobbyregister des Bundestags hat der Förderverein für das Jahr 2023 Gesamteinnahmen in Höhe von 4.528.531 Euro angegeben. Die mindestens 2,5 Millionen Euro Differenz zu den Beiträgen der Fördermitglieder erklären sich womöglich durch Einzelspenden oder auch hier durch Zuwendungen privater Stiftungen.
Der Förderverein stützt sich also maßgeblich auf Sonderzuwendungen und nur zu etwa zwei Fünfteln auf die Beiträge der Fördermitglieder. Die BAG Pro Asyl wiederum lebt von Spenden und Beiträgen aus dem Förderverein sowie von zusätzlicher finanzieller Unterstützung über die Mitgliedsorganisationen. Und hier wird es interessant – denn diese Mitgliedsorganisationen erhalten teilweise ganz erhebliche direkte staatliche Zahlungen.
Grundsätzlich werden von den Landesregierungen, der deutschen Bundesregierung und von der EU zahlreiche Organisationen gefüttert, die massiv auch illegale Migranten unterstützen – teilweise dadurch, dass sie Prozesse von abgelehnten Asylbewerbern finanzieren. Auf diesbezügliche Parlamentarische Anfragen der AfD hat die Bundesregierung zwei Antworten mit insgesamt 423 Seiten geliefert. Zahlreiche Organisationen erhielten zwischen 2020 und 2024 staatliche Mittel, die sie unter anderem für die Arbeit mit Asylbewerbern einsetzten.
Summen zwischen 38.000 Euro und 55.7000 Euro haben zum Beispiel das „Bildungswerk in der Migrationsgesellschaft“, die „Kinder- und Jugendhilfe Migrationsarbeit“, der Verein „Migrationsarbeit“ und der „Rat für Migration“ erhalten – vor allem im Rahmen der sogenannten Projektförderung aus dem Bundesfamilienministerium (BMFSFJ). Die Zahlen sind im Internet abrufbar.
Der deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband erhielt in dieser Zeit jährlich zwischen 175.000 Euro und 231.000 Euro. „Paritätische“ Organisationen werden insgesamt 67-mal genannt.
Großempfänger sind auch die sogenannten Flüchtlingsräte: Im Jahr 2023 erhielt allein der Kölner Rat 64.000 Euro. Der „Freundeskreis Asyl Karlsruhe“ bekam 38.000 Euro (2022). die „Bundesweite AG der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge“ (BAfF) durfte sich allein im Jahr 2023 über satte 150 Millionen Euro freuen.
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist zwischen 2020 und 2024 mit ihren Gliederungen in Bund, in Ländern und Kommunen 163-mal aufgeführt und erhielt Fördergelder zwischen 2000 Euro und drei Millionen Euro – pro Jahr, wohlgemerkt. Der „Rat für Migration“ bekam 228.000 Euro (2024), die „Asylbegleitung Hessen“ 2000 Euro (2023). Örtliche Arbeits-, Helfer- und Freundeskreise sowie Bürgerinitiativen und der „Campus Asyl“ bezogen jedes Jahr zwischen 1000 Euro und 62.000 Euro.
Der „Bayerische Flüchtlingsrat“ erhielt in den Jahren 2016, 2018 und 2019 insgesamt knapp 327.666 Euro vom Bundesministerium für Arbeit aus dem sogenannten europäischen Sozialfonds (eSF). Außerdem bekam er 2023 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 362.000 Euro aus dessen Förderprogramm „behördenunabhängige Asylverfahrensberatung“ sowie 79.000 Euro vom Bundesfamilienministerium für Integrationsprojekte.
Den Vogel in der Flüchtlingshilfe – die in Wahrheit nicht selten eine Fluchthilfe ist – schießen die kirchlichen Einrichtungen ab. Die Diakonie wird 53-mal genannt, jeweils mit Summen ab 1000 Euro pro Jahr. Meist ist es mehr. Viel mehr. Allein 2023 flossen der Diakonie Deutschland aus dem Einzelplan 06 des Bundesinnenministeriums gut 13 Millionen Euro zu.
Die Caritas mit ihren Orts- und Regionalgruppen kommt auf 106 Nennungen. Allein der Caritas Bundesverband erhielt 2023 – wiederum aus dem Einzelplan 06 des Bundesinnenministeriums – über 20,5 Millionen Euro. Weitere Millionen kamen vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Nachzulesen ist das in der Bundestagsdrucksache 20/10952 vom 9. April 2024 mit dem hübschen Titel „Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen“.
Unzählige Organisationen sind im Asylgeschäft tätig. Staatliche Mittel finanzieren also die „Landesflüchtlingsräte“, die wiederum Mitglieder in der BAG Pro Asyl sind.
Wie zuvor dargestellt, erhalten auch Kirchen und Wohlfahrtsverbände erhebliche staatliche Zuwendungen, ihre Vertreter wirken dann in der BAG Pro Asyl mit.
Die Gewerkschaften erhalten für ihre migrationspolitische Arbeit selbst zwar keine direkte staatliche Förderung, wohl aber über Kooperationsprojekte (zum Beispiel mit der Bundeszentrale für politische Bildung oder mit EU-Stellen).
Gewerkschaftssekretärin Sükran Budak vom Bundesvorstand der IG Metall im Ressort für Migration und Teilhabe ist deshalb nicht zufällig gleichzeitig Schatzmeisterin der BAG Pro Asyl. Formal erhalten der Förderverein Pro Asyl und die Stiftung selbst zwar keine staatlichen Mittel, doch über ihre Netzwerke von öffentlich bezuschussten Flüchtlingsräten, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden sowie durch deren inhaltliche Beiträge innerhalb der BAG Pro Asyl profitieren alle Bereiche von Pro Asyl insgesamt von deren Kompetenzen und Infrastruktur. Öffentliche Gelder landen somit – über die Kanäle dritter – in Initiativen, an denen Pro Asyl beteiligt ist – und damit in dem ideellen Gesamtkonzern.
Da ein unvoreingenommener Beobachter dem „Konzern“ Pro Asyl aus den genannten Gründen nun eine gewisse Staatsnähe unterstellen könnte, verwundert es doch sehr, dass der Verein regelmäßig zu Sachverständigenanhörungen in den Bundestag und in dessen Ausschüsse eingeladen wird und auf Internetseiten von Ministerien Stellungnahmen abgeben kann. Faktisch ist der Verein damit in den legislativen Willensbildungsprozess eingebunden.
Studien, Handreichungen und Stellungnahmen aus dem Pro-Asyl-Komplex werden von Ministerien zitiert und als Grundlage für politische Entscheidungen genutzt. damit übernimmt Pro Asyl teilweise Aufgaben einer öffentlichen Verwaltung, ohne Behörde zu sein. Viele Mitglieder im Netzwerk von Pro Asyl, vor allem die „Landesflüchtlingsräte“, werden mit Bundes-, Landes- oder EU-Mitteln gefördert. In gemeinsamen Kampagnen und durch personelle Verflechtungen erlangt Pro Asyl daher staatlich geförderte, organisatorische und kommunikative Vorteile, ohne selbst einen Förderbescheid unterzeichnen zu müssen.
Pro Asyl ist Vollmitglied im European Council on Refugees and Exiles (ECRE). Dieser Dachverband finanziert seine Brüsseler Interessenvertretung nach eigenen Angaben auch aus sogenannten „Operating Grants“ der EU sowie aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der EU. Dadurch fließen Steuergelder mittelbar in gemeinsame Lobbyaktivitäten.
Projekte wie das Refugee Support Program Aegean (RSA) werden von „Brot für die Welt“ mitfinanziert. Dieses Hilfswerk wiederum refinanziert sich aus Kirchensteuern und Mitteln des Bundes.
So ist ein riesiger Asylmarkt entstanden. Obwohl der Verein selbst keine direkte staatliche Förderung erhält, ist Pro Asyl in dieser Branche einer der wichtigsten und einflussreichsten Akteure – vor allem über die BAG und, mehr noch, über das Netzwerk.
Diese Industrie kämpft nun um ihr Geschäftsmodell. Denn viele Akteure verdienen direkt oder indirekt an der Migration und beschäftigen Heerscharen von bezahlten Mitarbeitern: „Seenotretter“ im Mittelmeer, Anwälte, Vermieter von Sammelunterkünften, Dolmetscher und Sprachlehrer, Sozialarbeiter, Traumabetreuer, private Arbeitsvermittler – die Liste ist schier endlos; sehr viele Menschen leben davon, dass der Zustrom an Flüchtlingen nicht abreißt. Wenn nun jemand – wie der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) – auch nur halbwegs ernsthafte Versuche unternimmt, den Nachschub an Asylbewerbern zu reduzieren, dann reagiert die Branche sofort panisch, wenn nicht gar aggressiv.
Und Pro Asyl ist stets ganz vorn mit dabei. Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Medien hat die Schlüsselorganisation der deutschen Asylindustrie die jüngste Aktion mit drei Somaliern in Berlin zumindest medial begleitet, möglicherweise aber auch gesteuert.
In der Tat zieht Pro Asyl gern vor Gericht. Dank der Steuerprivilegien als „gemeinnützige Organisation“ können offenbar teure Anwälte finanziert werden.
Auch gegen Tichys Einblick geht Pro Asyl vor. In einem Eilverfahren setzte der Verein ein Publikationsverbot mit einer Begründung durch, die nach Einschätzung von Tichys Einblick vor Fehlern nur so strotzt. Was in einem Zivilprozess eigentlich überhaupt nicht geht: Die Richter änderten den Antrag von Pro Asyl freihändig und entschieden dann im Sinne von Pro Asyl.
Ein unvoreingenommener Beobachter könnte sich übrigens auch die Frage stellen, was genau eigentlich gemeinnützig daran sein soll, wenn eine Organisation nicht nur professionell Wege aufzeigt, wie noch mehr Asylbewerber nach Deutschland kommen oder hierbleiben können, sondern diese Wege möglicherweise sogar aktiv ebnet – zum Beispiel durch die Begleitung oder auch Steuerung von Klageverfahren. Doch irgendwie traut sich niemand, das zu fragen.
Pro Asyl stellt sich selbst als hundertprozentig spendenfinanziert und damit unabhängig dar. Vieles weist aber auf eine strukturelle Staatsnähe hin, und die indirekte Förderung wird wohlweislich verschwiegen. Pro Asyl operiert innerhalb eines Netzwerks aus anderen Organisationen, von denen viele ihrerseits Millionen aus öffentlichen Töpfen der Landesregierungen, der Bundesregierung oder der EU erhalten. Auch Projektpartner steuern Mittel bei, die anteilig aus öffentlichen Quellen stammen. Dazu kommt das Gemeinnützigkeitsprivileg.
So fließen staatliche Ressourcen, Daten und Deutungsmacht in die Arbeit von Pro Asyl – auf Umwegen zwar, aber sie fließen und erreichen ihr Ziel. Das macht Pro Asyl zu einem quasi öffentlichen Akteur, der de facto wesentlich weniger unabhängig ist, als er selbst einräumen mag.





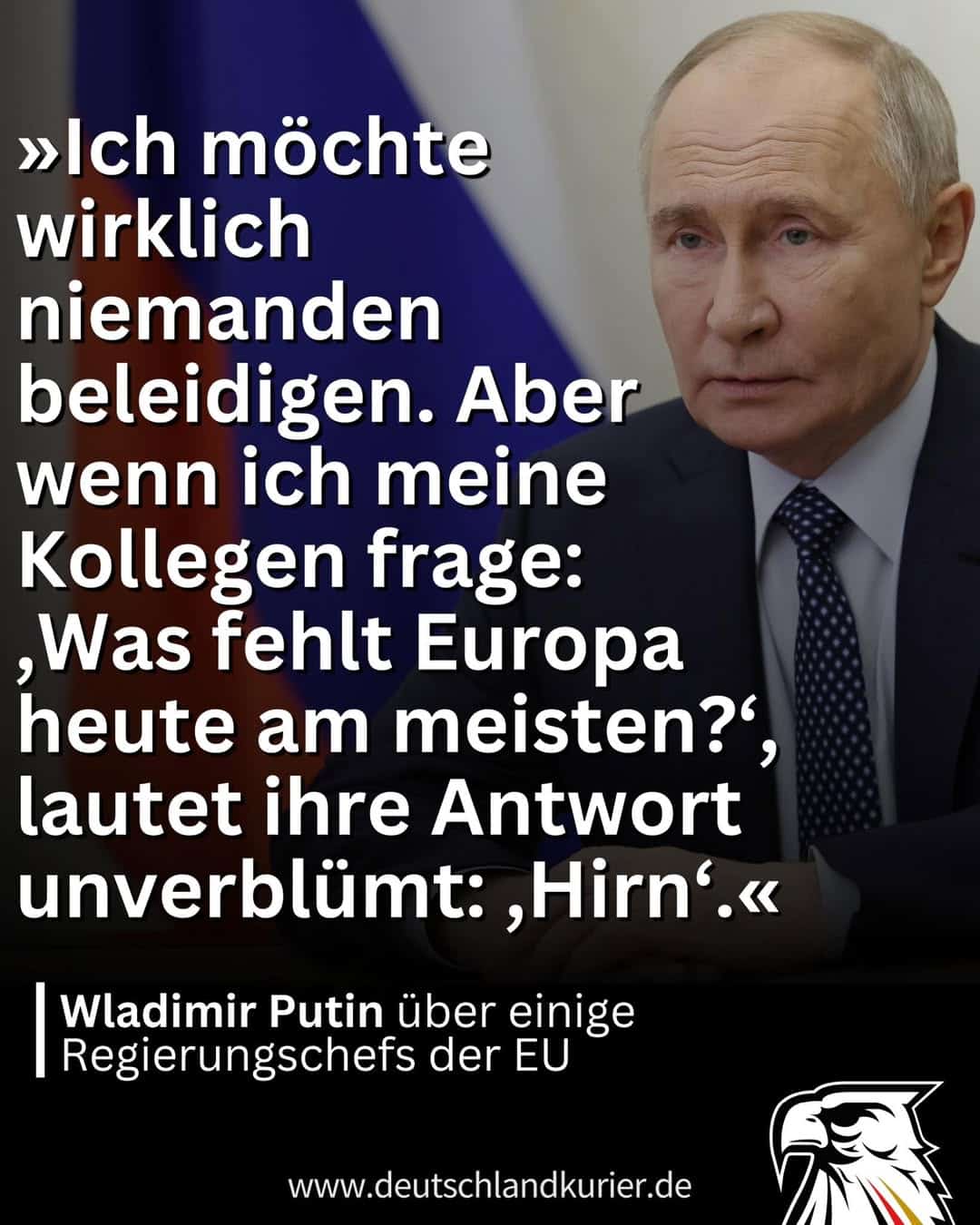



 UNRUHE NACH ALASKA-GIPFEL: Trump stark in der Kritik! – Welche Rolle wird Europa noch spielen?
UNRUHE NACH ALASKA-GIPFEL: Trump stark in der Kritik! – Welche Rolle wird Europa noch spielen?






























