
Es gibt keinen Teil des Grundgesetzes, den Politiker (und seit kurzem auch Inlandsgeheimdienstler) häufiger mit Rechtfertigungsabsicht zitieren als Artikel 1, wobei sie es oft nicht im Ganzen tun, sondern sich darauf beschränken, den Begriff der Menschenwürde anzuführen. Auf kein anderes Grundrecht verwenden Mandatsträger und Medienmitarbeiter seit Jahren eine größere Uminterpretationsmühe. Hier konzentrieren sich alle Versuche, die Abwehrrechte der Bürger gegen den Staat zu einer Verpflichtung der Bürger auf ein bestimmtes Gesellschaftsprogramm umzudeuten.
Die wenigsten kennen die Wurzeln dieses Artikels, der im ersten Entwurf der Verfassungsautoren in Herrenchiemsee zwar etwas Ähnliches meinte, aber erst einmal anders lautete. Die Anfangszeilen des Grundgesetzes stehen auch im Zentrum der Auseinandersetzung um die Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf, in der es weniger um ihre Person als um die Zukunft des Bundesverfassungsgerichts geht – die heutigen Zeilen, aber auch die weitgehend vergessenen aus dem ersten Entwurf von 1948.
Die Mitglieder des Verfassungskonvents, das vom 10. bis zum 25. August 1948 auf der Insel im Chiemsee tagte, stellte an den Anfang des ersten Artikels ursprünglich einen Satz, der das Verhältnis von Staat und Bürger definierte: „Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen.“ Aus dieser Zweckbestimmung des Staates als dienende Entität leiteten sie die Grenzziehung für Legislative, Exekutive und Judikative ab:
„(2) Die Würde der menschlichen Persönlichkeit ist unantastbar. Die öffentliche Gewalt ist in allen ihren Erscheinungsformen verpflichtet, die Menschenwürde zu achten und zu schützen.“
In der am 23. Mai 1949 beschlossenen Endfassung fiel dann der sehr konkrete und wenig interpretierbare Anfang weg; dafür rückte die ursprüngliche Ziffer 2 in leicht veränderter Version ganz nach oben. Dass der Staat Menschen nicht als Zweck betrachten und die Autonomie des Einzelnen für politische Ziele jedweder Art nicht opfern darf, blieb zwar weiter Inhalt dieses Grundrechtsartikels – nur eben ohne die lebensnahe Deutlichkeit dieses Satzes, der auch über den Eingang jedes staatlichen Gebäudes gehört hätte. In ihrer Formulierung – das gilt für Entwurf und Endfassung – verdichteten die Grundgesetzautoren den zentralen Gedanken aus Immanuel Kants „Metaphysik der Sitten“, wonach der Mensch „als Zweck an sich selbst“ existiert, „nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen“.
Die Würde erhält der Einzelne also nicht durch den Staat, er besitzt sie per se. Artikel 1 fordert den Staat in erster Linie nicht dazu auf, etwas Bestimmtes zu tun, sondern etwas zu unterlassen: nämlich willkürlich über ihn zu verfügen, weil eine angeblich höhere Sache es so erfordert.
Dass es sich bei den Grundrechten um Abwehrrechte gegen den Staat handelt, ergibt sich schon aus den ersten 20 Artikeln selbst, und es ergäbe sich noch ein wenig klarer und selbst für eiserne Etatisten verständlicher, wäre der später herausredigierte allererste Satz geblieben. Die Abwehrfunktion gegen einen Staat, der ohne ständigen Gegendruck grundsätzlich zu Übergriffen neigt, stellte das Bundesverfassungsgericht in mehreren historischen Entscheidungen heraus, etwa im Lüth-Urteil von 1958.
Diese Linie der Rechtsprechung verblasste ab einem bestimmten Zeitpunkt, sie faserte aus; schon mit dem Klimabeschluss von 2021, in dem der 1. Senat unter Stephan Harbarth Freiheitsrechte in der Gegenwart gegen hypothetisch angenommene Freiheitsbeschränkungen in der Zukunft abwog, aber noch sehr viel deutlicher im Beschluss zur sogenannten Corona-„Bundesnotbremse“: Hier verzichteten die Verfassungsrichter 2021 ganz darauf, dem Staat bei Grundrechtseinschränkungen rote Linien zu ziehen, sondern erklärten, Legislative und Exekutive hätten sich ihre Maßnahmen schon gut überlegt, und man gedenke nicht, ihnen in den Arm zu fallen.
Sollten die Kandidatinnen Frauke Brosius-Gersdorf und Ann-Katrin Kaufhold tatsächlich am Richtertisch Platz nehmen, dann stünden sie für eine Transformation von Verfassungsgericht und Rechtsverständnis, die alle bisher schleichenden Veränderungen weit übertreffen würde. Von schleichend könnte dann nämlich keine Rede mehr sein. Beide stehen für eine Umdeutung des Staat-Bürger-Verhältnisses, die ein politisch-medial-akademisches Milieu seit gut zehn Jahren in kleinen Schritten vorantreibt.
Dabei lässt sich ein übergreifendes Ziel erkennen: Den Bürgern soll das Bewusstsein verloren gehen, dass es sich bei Grundrechten überhaupt um Abwehrrechte gegenüber dem Staat handelt. Stattdessen versuchen ihnen wichtige Meinungspräger einzureden, die Grundrechte würden vielmehr sie, die Bürger respektive ein waberndes steinmeierisches Wir („wir als Gesellschaft“) dazu verpflichten, eine bestimmte politische Agenda zu unterstützen oder ihr zumindest nicht im Weg zu stehen.
Nirgends lässt sich dieser Prozess besser ablesen als an der Benutzung von Artikel 1 seit 2015 für tagespolitische Zwecke – das heißt, nicht in der Berufung auf seinen eigentlichen Inhalt, sondern seine Neuinterpretation. Nach ihrer Entscheidung zur Öffnung Deutschlands für eine schrankenlose Migration pflegte Angela Merkel in fast jeder größeren Rede, den Verweis auf die Menschenwürde einzuflechten. Auf einer Pressekonferenz im August 2015, als sie auch den verschachtelten Satz formulierte, in dem „wir schaffen das“ vorkam, erklärte sie, der Grundsatz der Menschenwürde gelte für jedermann, „gleichgültig, ob er Staatsbürger ist oder nicht, gleichgültig, woher und warum er zu uns kommt“. Merkel, – das zur Erinnerung – ersetzte damals nach den Worten des früheren Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier das Asylrecht durch ein „Asylantragsrecht“ (Papier).
In dieser von der Verfassung abweichenden neuen Rechtsrealität spielte die eigentliche Zweckbestimmung von Artikel 16, nämlich (nur) politisch Verfolgten Schutz zu gewähren, keine Rolle mehr, genauso wenig wie die Tatsache, dass fast alle Migranten, die Deutschland erreichten, vorher schon mehrere sichere Länder durchquerten, weshalb sie sich nach Wortlaut des Artikels eigentlich nicht mehr auf das Asylrecht berufen konnten. Nach Merkel musste der Staat trotzdem jede Person ohne Vorbedingungen hereinlassen, was in der Praxis bedeutete, dass die Einwanderer Unterbringung, Versorgung und Geld erhielten und in den allermeisten Fällen auch bleiben durften, unabhängig davon, ob sie Asyl beziehungsweise Flüchtlingsstatus erhielten oder nicht. Denn diese Kriterien trafen nur für eine sehr kleine Minderheit zu.
Merkel wusste, dass die Mehrheit der Migranten, die 2015 kamen, vom Westbalkan und aus dem Maghreb stammten, also aus Gebieten, in denen weder Krieg noch systematische Verfolgung herrschten. Genau das meinte sie mit „gleichgültig, woher und warum er zu uns kommt“. Es trifft zu, dass Artikel 1 nicht nur für Deutsche gilt. Aber in der Umdeutung verwandelte die CDU-Politikerin den als Abwehrrecht gegen den deutschen Staat konzipierte Verfassungstext kurzerhand in ein weltweit gültiges Eintrittsbillett für die Bundesrepublik inklusive Versorgungsanspruch, dessen Erfüllung sie denjenigen aufbürdete, „die schon länger hier leben“.
Dabei ging und geht es nicht nur um finanzielle Lasten gewaltigen Ausmaßes, sondern auch um eine Verschlechterung der öffentlichen Sicherheit und eine langfristige Veränderung von Demografie und Kultur des Landes. Mit ihrer Formulierung „wir haben es nicht in der Hand, wer zu uns kommt“ und „es gibt keine Obergrenze“ erklärte sie damals in bemerkenswerter Offenheit, die Bürger des Landes hätten bei der Migration keine eigenen Interessen anzumelden, sondern nur die materiellen und mentalen Rechnungen zu begleichen. Wer das anders sehe, so ihre Deduktion, vergehe sich an der Menschenwürde der Neuankömmlinge und stelle sich gegen das Grundgesetz. Aus dem Abwehrrecht machte sie damit eine Duldungspflicht ihrer politischen Doktrin. Das sieht sie bis heute so und mit ihr wesentliche Teile der Funktionselite. Bei der Vorstellung ihres Buchs „Freiheit“ erklärte Merkel die Versorgung der Migranten bekanntlich zur „Bringschuld“.
In ihrer Regierungserklärung vom 21. März 2018 ging sie mit der Umkehrung des Grundgesetzanfangs noch ein Stück weiter: „Insbesondere das Zusammenleben der Religionen stellt uns vor große Herausforderungen. ‚Die Würde des Menschen ist unantastbar‘, so heißt es in Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Dieser Artikel beschreibt den Kern unseres Zusammenlebens. Er macht klar, dass Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus in unserem Rechtsstaat keinen Platz haben.“ Nein, Artikel 1 beschreibt eben nicht „den Kern unseres Zusammenlebens“, sondern richtet sich ausschließlich an den Staat, dessen Zugriff auf den Einzelnen er eine Grenze setzt.
Eine Person, die sich angeblich oder tatsächlich fremdenfeindlich oder rassistisch äußert, verstößt möglicherweise gegen Gesetze – aber eben unmöglich gegen den Grundrechtsartikel. Bekanntlich dehnten Medien, staatsfinanzierte Organisationen wie die Amadeu-Antonio-Stiftung und Politiker die Begriffsgrenzen für „Fremdenfeindlichkeit“ und „Rassismus“ ab 2015 so weit, dass jeder hineinpasste, der sich nicht darüber freute, dass das Land sich „drastisch ändert“ (Katrin Göring-Eckardt). Was den Antisemitismus angeht, den Merkel damals unter die Phänomene zählte, die im Rechtsstaat „keinen Platz haben“: Dass in Wirklichkeit speziell dieser Platzbedarf in den nächsten Jahren stark wachsen würde, wenn Millionen Migranten aus Ländern kommen, in denen Judenhass zu den Selbstverständlichkeiten gehört, musste ihr klar gewesen sein. Umso dringender spürte sie offenbar das Bedürfnis, genau diese Fragen im selbstangerührten Begriffsnebel (Artikel 1, Kern unseres Zusammenlebens) verschwinden zu lassen.
Ähnliche Beispiele für die Benutzung von Artikel 1 zur Rechtfertigung der Migrationspolitik und der Eindämmung von Kritik, vorgetragen von Merkel und anderen, ließen sich noch reihenweise aufführen. Ab 2023 kam noch ein anderes Einsatzgebiet dazu: Das Bundesamt für Verfassungsschutz kaprizierte sich bei der Einstufung der AfD erst als rechtsextremistischer Verdachtsfall und dann als „gesichert rechtsextremistisch“ ganz auf die Argumentation, Mitglieder der Partei verträten ein „ethnisches Volksverständnis“ und verstießen damit gegen die Menschenwürdegarantie von Artikel 1. Abgesehen davon, dass der Staat selbst einen ethnisch begründeten Volksbegriff verwendet (etwa im Staatsbürgerschaftsrecht, aber auch bei der Förderung der deutschen Kultur in Rumänien), abgesehen auch davon, dass viele der vom Verfassungsschutz in seinem sogenannten Gutachten zusammengetragenen Zitate von AfD-Mitgliedern nicht den unterstellten ethnischen, sondern nur einen historisch-kulturellen Volksbegriff hergeben: Auch hier gilt das Gleiche wie oben. Gegen den ersten Grundrechtsartikel kann ein Einzelner genauso wenig verstoßen wie gegen die anderen Grundrechte.
In diese späte Phase einer langen Instrumentalisierungsgeschichte von Artikel 1 stößt nun die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht Frauke Brosius-Gersdorf mit einem bunten Bukett von Rechtsmeinungen, aus dem ihre Ansicht zum Schutz beziehungsweise der Relativierung des ungeborenen Lebens ein gutes Stück herausragt. Im Februar 2025 erklärte sie als Sachverständige vor dem Rechtsausschuss des Bundestages: „Ob dem Embryo und später Fötus der Schutz der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes zukommt, das ist in der Tat in der Verfassungsrechtswissenschaft sehr umstritten. Meines Erachtens gibt es gute Gründe dafür, dass die Menschenwürdegarantie erst ab Geburt gilt.“ Zwar macht sie geltend, ein ungeborenes Kind habe ihrer Ansicht nach ein „Lebensrecht“. Den Paragraf 218, der die Abtreibung in den ersten 12 Wochen straffrei stellt, die Abtreibung generell aber als illegal kennzeichnet, möchte Brosius-Gersdorf trotzdem aus dem Strafgesetzbuch streichen – so, wie es viele Vertreter von Grünen und SPD seit längerem fordern. Ein Lebensrecht, aber ohne Würde – das wäre dann eben kein Lebensrecht per se, sondern eins, das der Staat zugestehen würde (wobei unklar bleibt, wie er es durchsetzt, wenn es zur Abtreibung keine strafrechtliche Regelung mehr geben würde). Als Professorin kann sie diese Idee entwickeln. Nur steht sie damit nicht nur gegen das, was Artikel 1 meint, der die Menschenwürde eindeutig nicht auf das geborene Leben beschränkt – sondern auch gegen die ständige Rechtsprechung des Gerichts, in dem sie demnächst Platz nehmen will.
In seiner Entscheidung vom 25. Februar 1975 zum Schwangerschaftsabbruch begründete das Bundesfassungsgericht den Schutz des ungeborenen Lebens ausdrücklich unter Verweis auf Artikel 1 des Grundgesetzes: „Das sich im Mutterleib entwickelnde Leben steht als selbständiges Rechtsgut unter dem Schutz der Verfassung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 1 Abs. 1 GG). Die Schutzpflicht des Staates verbietet nicht nur unmittelbare staatliche Eingriffe in das sich entwickelnde Leben, sondern gebietet dem Staat auch, sich schützend und fördernd vor dieses Leben zu stellen.“ In seinem Urteil vom 28. Mai 1993 bekräftigte der 1. Senat in Karlsruhe noch einmal den Schutzbereich der Menschenwürde:
„Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, menschliches Leben, auch das ungeborene, zu schützen. Diese Schutzpflicht hat ihren Grund in Art. 1 Abs. 1 GG; ihr Gegenstand und – von ihm her – ihr Maß werden durch Art. 2 Abs. 2 GG näher bestimmt. Menschenwürde kommt schon dem ungeborenen menschlichen Leben zu. Die Rechtsordnung muß die rechtlichen Voraussetzungen seiner Entfaltung im Sinne eines eigenen Lebensrechts des Ungeborenen gewährleisten. Dieses Lebensrecht wird nicht erst durch die Annahme seitens der Mutter begründet.“
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gehören in Deutschland zum unmittelbar geltenden Recht, das auch Verfassungsrichter bindet. Würde sich die Sicht von Brosius-Gersdorf durchsetzen, dann hieße das in der Praxis: Artikel 1 Grundgesetz dient mittlerweile in der politischen Auseinandersetzung zu allem Möglichem, von der Absicherung der Migrationspolitik bis zur Verdrängung der größten Oppositionspartei aus dem politischen Geschäft – aber ausgerechnet für den Lebensschutz soll er nichts mehr bedeuten.
Was die Kandidatin meint und vorschlägt, steht also frontal gegen die Verfassungsrechtsprechung, um einen originären Gedankengang der Professorin handelt es sich allerdings nicht. Sie spinnt damit den Beschluss des JuSo-Bundeskongresses von 2018 weiter, der damals forderte, den Paragraf 218 zu streichen. In dem Beschluss heißt es: „Die Festlegung einer Frist, nach deren Ablauf eine Abtreibung verboten ist, unterstellt, dass Frauen nicht dazu in der Lage sind, selbstständig die für sie richtige Entscheidung zu treffen.“
Auch damals spielte sich in der öffentlichen Kommentierung etwas sehr Ähnliches ab wie heute: Als einige Medien zutreffend darauf hinwiesen, das JuSo-Papier würde den Weg zu Abtreibungen bis in den 9. Monat öffnen, empörte sich der damalige Verbandschef Kevin Kühnert über die schlimme Desinformation. „Rechtsradikale jedweder Couleur tragen die Lüge in die Welt, die Jusos wollten Abbrüche bis in den neunten Schwangerschaftsmonat ermöglichen“, so Kühnert damals zum Handelsblatt: „Nichts dergleichen wollen wir, nichts dergleichen haben wir beschlossen.“ Richtig ist: Der JuSo-Beschluss nannte überhaupt keine Frist.
Es gibt noch einen zweiten vor einiger Zeit politisch heftig diskutierten Bereich, in dem Artikel 1 seine Schutzwirkung entfaltet beziehungsweise entfaltet hätte: Eine allgemeine Corona-Impfpflicht, wie sie große Teile der Ampelkoalition Anfang 2022 durchdrücken wollten, hätte an diesem Grundrecht zwingend scheitern müssen, jedenfalls nach seiner ursprünglichen Intention. Denn die Entscheidungshoheit, was jemand mit seinem Körper anstellen lässt, gehört nun einmal zum Kernbereich der Menschenwürde, noch dazu, wenn es sich um einen experimentellen Stoff mit Notfallzulassung handelt. Auch hier sah Brosius-Gersdorf die Würdefrage etwas anders.
Sie plädierte seinerzeit nicht nur für eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht, sondern schlug darüber hinaus vor, Ungeimpfte an den Behandlungskosten zu beteiligen, sollten sie erkranken, was faktisch bedeutete, sie aus der Solidargemeinschaft ihrer Krankenkasse auszuschließen. Als Markus Lanz sie am Dienstag in seiner Talkshow dazu befragte, trug sie übrigens kein Jota irgendeiner juristischen oder gar verfassungsrechtlichen Begründung vor, sondern erklärte, viele Krankenkassen seien „finanziell notleidend“. Deshalb gehe es darum: „Wie kann man da Kosten eindämmen?“ Grundrechtseinschränkung mit Verweis auf die Kassenlage – diese Frau betritt tatsächlich ganz neue und bisher nur sehr vage kartierte Pfade.
Es gibt ein ganzes Bündel von Gründen, Brosius-Gersdorf von Karlsruhe fernzuhalten. Schon als sie (ebenfalls bei Lanz) freimütig erklärte, ein AfD-Verbot wäre ein „ganz starkes Signal“, auch wenn das die Anhänger dieser Partei nicht „beseitigen“ könnte, erledigte sie sich nach Maßstäben der freilich schon halb verschütteten alten Bundesrepublik selbst. Denn die Juristin würde im Fall ihrer Wahl dem 2. Senat in Karlsruhe angehören, der über ein AfD-Verbot urteilen müsste, sollte es einen Antrag geben. Wer noch nicht einmal die Grundregel befolgt, sich zu möglichen Prozessthemen nicht parteiisch zu äußern, beweist schon seine Untauglichkeit für andere Gerichte – aber über die Schwelle dieses Verfassungsorgans, das keiner Kontrolle unterliegt, sollte eine vorgeschlagene Person niemals kommen.
Auch mit ihrer Forderung nach „Parität“, also einer gesetzlichen Verpflichtung für Parteien, bei Aufstellung ihrer Kandidaten für Parlamentswahlen eine Frauenquote von 50 Prozent einzuhalten, steht sie diametral gegen die Verfassungsrechtsprechung. Entsprechende Gesetzesvorlagen auf Landesebene verwarfen bisher die Verfassungsgerichte von Brandenburg und Thüringen; eine Beschwerde, die den Gesetzgeber zu einer solchen Regelung zwingen sollte, beschied das Bundesverfassungsgericht 2021 abschlägig.
Mit ihrer Ansicht zur Nichtmenschenwürde des ungeborenen Lebens löste die Bewerberin allerdings eine sehr viel stärkere öffentliche Reaktion aus als mit allen übrigen Wortmeldungen zusammen. Wahrscheinlich rechnete sie selbst nicht damit, erst recht nicht, dass sich sogar Kirchenvertreter, die sich sonst mit Fragen wie Tempolimit und synodalem Weg befassen, sich hier zu Wort melden würden. CDU-Chef Friedrich Merz und die Unionsfraktionsführung jedenfalls sahen den Widerstand in den eigenen Reihen gegen diese Kandidatin bis zuletzt nicht kommen. An der Unionsspitze stellt man sich nämlich schon seit Jahren vor, dass der Kulturkampf ausfällt, wenn man nicht hingeht.
Die Juristin beklagt sich, sie würde in der öffentlichen Debatte nur unvollständig zitiert. Je gründlicher und umfassender man sich aber mit ihrer Gedankenwelt befasst, desto deutlicher tritt ihre etatistische, autoritäre Gesamtüberzeugung hervor, die alles in allem den direkten Gegenentwurf zu dem leider verlorengegangenen ersten Grundgesetz-Satz von 1949 bildet, der Staat sei für die Bürger da und nicht umgekehrt. In ihren „THESEN ZUR SOZIALEN GERECHTIGKEIT IM LEBENSWEG“ fordert sie unter anderem die „Abschaffung des Ehegattensplittings für Neu-Ehen zur Beseitigung der […] Negativanreize für die Erwerbstätigkeit von Frauen“ (das Steuersplitting geht auf ein Verfassungsgerichtsurteil zurück); ferner eine „Reform des Erbrechts zum Zwecke einer gerechteren Verteilung von Vermögen auf alle Menschen und zur Verwirklichung des Leistungsprinzips“.
Das wiederum passt nahtlos zur Forderung der SPD wie auch der Linkspartei, ein „Grunderbe“ von 20.000 bis 60.000 Euro, finanziert aus einer sehr viel höheren Besteuerung von Erbschaften. Ganz nebenbei wandelt sie den Kampfbegriff vom „leistungslosen Einkommen“ dezent ab, das eine Erbschaft nach plünderlinker Auffassung darstellt. Wie mittlerweile die Mehrheit der Politiker im linken Block spielt es für sie offensichtlich keine Rolle, dass der Freiheitsaspekt beim Erben zuallererst in der Testierfreiheit besteht, also in der Entscheidung, an wen man sein Vermögen weitergibt.
Ebenfalls Teil ihres Lebensweg-Papiers: die „Abschaffung von sozialversicherungsfreien Minijobs. Beschäftigung muss ab dem ersten Cent Lohn sozialversicherungspflichtig sein“. Zum ganzen Bild, das sich Brosius-Gersdorf von den Medien wünscht, gehört auch ihre Position zur Gendersprache: In einem Interview meinte sie 2022, Kritik an dieser von gut drei Vierteln der Bevölkerung abgelehnten Kunstsprache werde „von manchen auch als Vorwand genutzt, sich dem Thema nicht stellen und weiterentwickeln zu müssen“ für eine höhere evolutionäre Stufe, zu der manche erst noch aufrücken müssen.
Den vorläufigen Höhepunkt ihrer Bewerbung bildet ein Anwaltsschreiben, in dem sie Medien und unwilligen Politikern mitteilen lässt, wie sie sich bewertet sehen möchte. „In Zeiten, in denen Politikerinnen und Politiker für sich zu Recht stärkeren Schutz vor verbalen Angriffen fordern und ein ,digitales Vermummungsverbot‘ diskutieren“, heißt es da, „befremden anonyme Äußerungen aus den Reihen politisch verantwortlicher Funktionsträger des Staates“. Verbale Angriffe gehören zum politischen wie zum allgemeinen gesellschaftlichen Leben, und das nicht erst seit diesem oder dem vorigen Jahrhundert. „Schutz vor verbalen Angriffen“ – wie muss man sich das vorstellen?
Selbst Beleidigung und Verleumdung ahndet die Justiz erst nachträglich, aber sie schützt niemanden davor. Wer verbal nicht öffentlich angegriffen werden möchte, muss die Öffentlichkeit eben meiden. Und was „digitales Vermummungsverbot“ angeht – die so genannte Klarnamenspflicht im Netz (und offenbar irgendwie auch außerhalb) befürwortet sie offenbar auch noch. Immerhin weiß jetzt jeder, wo sie die Grenzen der Meinungsfreiheit erreicht sieht.
Inkonsistenz ist so ziemlich das Letzte, was man Brosius-Gersdorf vorwerfen kann. Bei ihr fügt sich eins ans andere zu einem Grand Design einer postdemokratischen Ordnung, in der eine wohlmeinende Elite den Bürger mal sanft, mal nachdrücklich in eine vorgegebene Richtung schubst, ihn gelegentlich bestraft und vor allem über ihn verfügt.
Gerade mit ihren Steuerideen macht sie deutlich, welchen Platz sie dem Normalbürger zuweist: Es sollen möglichst alle in Vollzeit arbeiten, Männer wie Frauen, um Steuern und Sozialabgaben zu generieren. Bei Vermögensbildung, soweit es sie überhaupt gibt, muss wiederum spätestens am Lebensende ein ordentlicher Teil beim Staat landen. Und gehen Wahlen nicht so aus wie gewünscht, liegt die Lösung nicht etwa in der Änderung der bisherigen Politik, sondern in der Reduzierung des politischen Angebots. Würde sie gewählt, dann wäre das zum einen der Vorgriff auf eine Miersch-Reichinnek-Haßelmann/Dröge-Koalition, also auf die Regierung der meisten Journalistenherzen und NGOs. Und zum anderen der Schlusspunkt einer langen Entwicklung, an deren Anfang Verfassungsautoren standen, die einmal ganz ernsthaft meinten, der Staat hätte seinen Bürgern zu dienen.
Nummer 25 der berühmten 36 chinesischen Strategeme lautet: „Ohne Veränderung der Fassade die Stützpfosten stehlen“. Diese Arbeit wäre weitgehend getan, sollte Brosius-Gersdorf die rote Robe erhalten, zusammen mit ihrer Kollegin Ann-Katrin Kaufhold, die meinte, ein Verfassungsgericht könnte und sollte „unpopuläre Maßnahmen“ beispielsweise zur CO2-Reduktion anordnen, denn dieses Verfassungsorgan müsste schließlich keine Rücksicht auf Wähler nehmen.
Manche meinen, der Grund für das zähe Festhalten von SPD und Grünen an dem Wahlvorschlag liege vor allem in der Erwartung, dass mit den beiden Juristinnen ein AfD-Verbot mit größerer Wahrscheinlichkeit durchkäme. Bisher fürchteten sogar etliche SPD-Abgeordnete den Gang nach Karlsruhe wegen des Risikos, dort Schiffbruch zu erleiden. Und selbst mit den Neubesetzungen wären die mindestens nötigen fünf Stimmen für den Antrag nicht sicher.
Bisher schien es so, als würde eine Mehrheit im Bundestag die Verbotsdrohung lieber ewig wie einen Polizeihubschrauber über der Partei kreisen lassen, statt das Risiko eines Verfahrens einzugehen. Außerdem dürften etliche in Berlin – wenn auch nicht alle – die Konsequenz erkennen, die darin besteht, dass sich Deutschland nach einem AfD-Verbot in eine Pariarolle begeben würde. Selbst in einer autoritären Halbdemokratie wie Brasilien gab es bisher noch keinen Versuch, eine Oppositionspartei zu illegalisieren. Das geschah in letzter Zeit nur in einem einzigen Staat weltweit, nämlich in Thailand – einer Monarchie mit einem Gottkönig an der Spitze und starkem Militär hinter ihm. In dieser Liga würde die Bundesrepublik dann landen. Möglicherweise geben Verbotspläne den Ausschlag für diese Auseinandersetzung. Vielleicht geht es auch um eine ganz grundsätzliche Machtdemonstration der Kräfte, die finden, dass ihre Zeit jetzt kommt. Sollte die Bewerberin sich am Ende doch zurückziehen, dann nur, weil die Union irgendeinen hohen politischen Preis dafür zahlt.
Um Brosius-Gersdorf herum marschiert jedenfalls so ziemlich alles auf, was zum Postdemokratielager gehört. Die Zeit erklärt die Potsdamer Juristin zur gesellschaftlichen Mitte („näher bei Ludwig Erhard als bei Rosa Luxemburg“).
Screenprint: Zeit
Als Gutachter für das Hamburger Blatt fungiert Mark Schieritz, Autor des Buchs: „Zu dumm für die Demokratie. Wie wir die liberale Ordnung schützen, wenn der Wille des Volkes gefährlich wird“. Was der Zeit-Autor als Gesellschaftstheorie entwirft, verspricht die Kandidatin praktisch zu verwirklichen. Es fand sich auch schnell das übliche gesellschaftliche Unterschriftenbündnis pro Brosius-Gersdorf zusammen, organisiert unter anderem von Alexander Thiele, einem Rechtsprofessor, der während der Coronazeit nicht nur die Impfpflicht bewarb, sondern auch laut über Zwangsimpfungen nachdachte.
Screenprint: Morgenpost
Der Spiegel wiederum deckt eine Verschwörung rechter Medien und Kirchenleute auf, ohne die es längst die nötige Mehrheit für die Wunschfrau gäbe.
Screenprint: Spiegel
Screenprint: Spiegel
Rechte Medien verfügen nämlich über keine Kampagnenlizenz und Kirchenleute sollten besser erst in Redaktionen und Parteigeschäftsstellen nachfragen, bevor sie sich wild drauflos äußern. Apropos, was macht eigentlich „Correctiv“? Gab es nicht irgendein Geheimtreffen zur Verhinderung progressiver Richterinnenkandidatinnen? Falls nicht, müsste man es glatt erfinden.
Zurzeit fliegt vieles aus dem alten bundesrepublikanischen Bestand gerade aus dem Fenster. Unter anderem auch das freie Mandat von Abgeordneten nach Artikel 38 Grundgesetz. Die Grünen verlangen von Unionsfraktionschef Jens Spahn ultimativ, die nötige Mehrheit für Brosius-Gersdorf irgendwie herbeizuschaffen, einer ihrer Abgeordneten sieht in der vorläufigen Nichtwahl schon ein Problem für Sicherheitsbehörden.
Ganz gleich, wie die Affäre ausgeht: Hier deutet sich der Stil der Republik in Umgründung schon einmal an. Zu den Verschwörern und Gefährdern gehört ab jetzt, wer darauf hinweist, dass die letzten Stützpfosten hinter der Fassade gerade verschwinden.








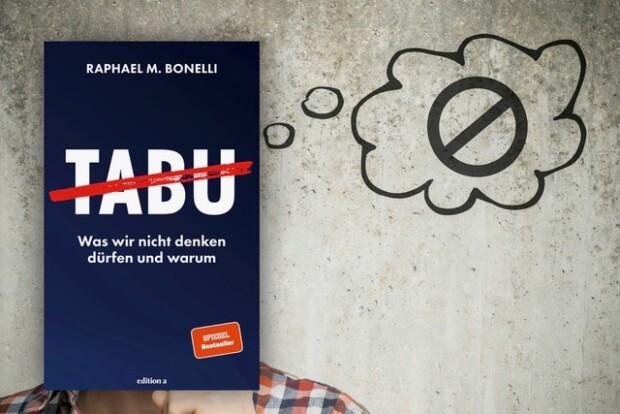
 DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE
DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE






























