
Wer verhandeln will, sollte die Sprache des Gegenübers sprechen oder zumindest verstehen. „Sprache“ bedeutet dabei mehr als das Verständnis der Worte. Wer mit Russlands Präsident Wladimir Putin (und US-Präsident Donald Trump) verhandeln will, muss vor allem die kalte Sprache der Macht verstehen. Eine Sprache, die Friedrich Merz (CDU) und die Europäer nicht verstehen und in der sie allenfalls stammeln können.
Es beginnt mit dem „Waffenstillstand“, den Merz und die Europäer als Voraussetzung für Friedensgespräche fordern. Ein Wunsch, der gut, richtig und rational ist: Wer verhandelt schon mit einem Gegner, der einem gleichzeitig Bomben auf den Kopf wirft. Das Problem: Es ist nicht Putin, der verhandeln will. Aus seiner Sicht läuft die tägliche (nächtliche) Zermürbung der Ukraine durch Drohnenangriffe und Bombardierungen bestens, und ein Waffenstillstand würde Kiew nur eine Atempause zum Reorganisieren der zerzausten Truppen verschaffen. Kein Wunder also, dass Putin von einem Waffenstillstand nichts wissen will.
Bundeskanzler Friedrich Merz gestern im Weißen Haus in Washington D.C., wo US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs zu Gesprächen über ein Ende des russischen Krieges in der Ukraine zusammen kam.
Das Selbstverständnis der Russen baut ohnehin darauf, im Gegensatz zum dekadenten Westen zäher, härter zu sein und am Ende Entbehrungen länger zu ertragen als der Rest der Welt. Mit anderen Worten: Menschen und Material gehen Putin noch lange nicht aus. Laut einer Umfrage des angeblich unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Lewada, aus der Table Media zitiert, würden gut drei Viertel der Menschen in Russland Putin auch nach seiner aktuellen Amtszeit als Präsidenten sehen wollen. Er hat also keinen Druck und auch keinen Zeitdruck.
Auch das derzeit viel diskutierte Zweiertreffen Putins mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dürfte eine Illusion bleiben. Putin verachtet Selenskyj als eine Art politischen Wichtelmann, der aus Kreml-Sicht nicht viel mehr ist, als Statthalter eines russischen Satellitenstaats und mit einer weltweiten Kampfanzug-Inszenierung die eigene Machtlosigkeit verbrämt. Bislang sah Putin keinen Anlass, Selenskyj mit einem solchen Treffen aufzuwerten und auf Augenhöhe mit sich selbst zu hieven.
Der russische Präsident Wladimir Putin sieht in Selenskyj nur einen Statthalter – und verspottet seine militärische Selbstinszenierung.
Auch protokollarisch ist es wenig sinnvoll, die Hauptpersonen des Konflikts in Verhandlungen zu schicken, weil sie gar nicht anders könnten, als ihre öffentlich bekannten Attacken und Vorwürfe zu wiederholen. Das sind sie ihren Rollen schuldig. Traditionell beginnt man mit unbedeutenden Unterhändlern wie unlängst in Saudi-Arabien oder allerhöchstens den Außenministern und behält als Regierungschef die Fäden in der Hand.
Putin während des Alaska-Gipfels am 15. August 2025 in Anchorage.
Ich habe als Reporter auch die Treffen von Kanzlerin a.D. Angela Merkel (CDU) mit Putin begleitet, und es kann niemand verwundern, dass der russische Präsident „Sicherheitsgarantien“ für die Ukraine zunächst zustimmt, damit aber selbstverständlich keine Nato-Truppen im eigenen Vorhof in der Ukraine meint. Putin kennt die Vorliebe des Westens für solche wolkigen und abstrakten Begriffe, unter denen jeder verstehen kann, was er will. Der Westen kann also Kiew garantieren, was er möchte, solange es Sprüche und luftige Bemühenszusagen bleiben. Die Sprache der Macht ist die Sprache der Fakten, und die schafft Putin.
Selbstverständlich geht man immer erst einmal mit einem Maximal-Katalog an Forderungen in Verhandlungen hinein, die man sich dann im Zuge zäher Verhandlungen nur so weit abringen lässt, wie es sich nicht vermeiden lässt. Aber auch vor Beginn wirklich ernsthafter Gespräche ist heute schon klar, dass Putin mit „mehr Ukraine in der Tasche“ nach Hause gehen wird, als vor dem Krieg. Das wissen auch die Europäer um Friedrich Merz und werden versuchen, die faktische Verfügungsgewalt Russlands über Krim und Teile der Ost-Ukraine so zu gestalten, dass es keine völkerrechtlich verbindliche Abtretung von Gebieten wird und man die Zugehörigkeit formal (zur Gesichtswahrung) offenhalten kann.
Das Kern-Problem des Ukraine-Konflikts besteht darin, dass sich Putin darauf verlassen kann, dass der Westen ihm nicht bewaffnet entgegentreten und wirklich brutale Verluste zufügen will. Die Wohlstandsgesellschaften Europas, die kaum noch Lebenszeit für Wehrdienst opfern wollen, haben viel zu verlieren und müssen sich – siehe Deutschland – schwer verschulden, um überhaupt genügend Wehrgerät vorhalten zu können.
Präsident Putin spekuliert auf die besetzten Gebiete in der Ost-Ukraine.
US-Präsident Trump wiederum will „einen Deal“, ganz gleich, wie dieser aussieht und zustande kommt. Er hat beim Treffen in Washington mehr als deutlich gemacht, dass es nicht sein Konflikt ist und die Europäer ran müssen. Die Europäer dagegen wollen einen maximal fairen und gerechten Deal, um nicht Krieg, Überfall und Schurkentum Russlands auch noch zu belohnen. Das ist mehr als nachvollziehbar. Wie so häufig in der Weltgeschichte kostet das Warten auf den Sieg des Wahren, Edlen und Gerechten blutige Zeit, bevor auch der Letzte eingesehen hat, dass der Himmel auf Erden nicht zu erlangen ist. Zumindest dann nicht, wenn man nicht bereit ist, der kalten Macht mit ebenso blutiger Entschlossenheit entgegenzutreten.
Eines kann und muss man Friedrich Merz allerdings zugutehalten: Er hat den europäischen Hühnerhaufen immerhin dazu gebracht, ordentlich und diszipliniert auf einer gemeinsamen Stange zu sitzen. Oder wie Gabor Steingart zutreffend schreibt, dass „ein französischer Gockel, eine im Brüsseler Machtapparat versteifte EU-Bürokratin, eine italienische Nationalistin, ein den Amerikanern höriger Nato-Generalsekretär und ein leicht entflammbarer ukrainischer Kriegsherr“ nicht mehr durcheinander gackern. Ein Hühnerhaufen bleibt es trotzdem. Mehr Gewicht und Respekt bekommt er in den Augen Moskaus auch so nicht.
Lesen Sie auch:So lief der Gipfel zur Ukraine in Washington ab: Zähes Ringen trotz demonstrativer Einigkeit







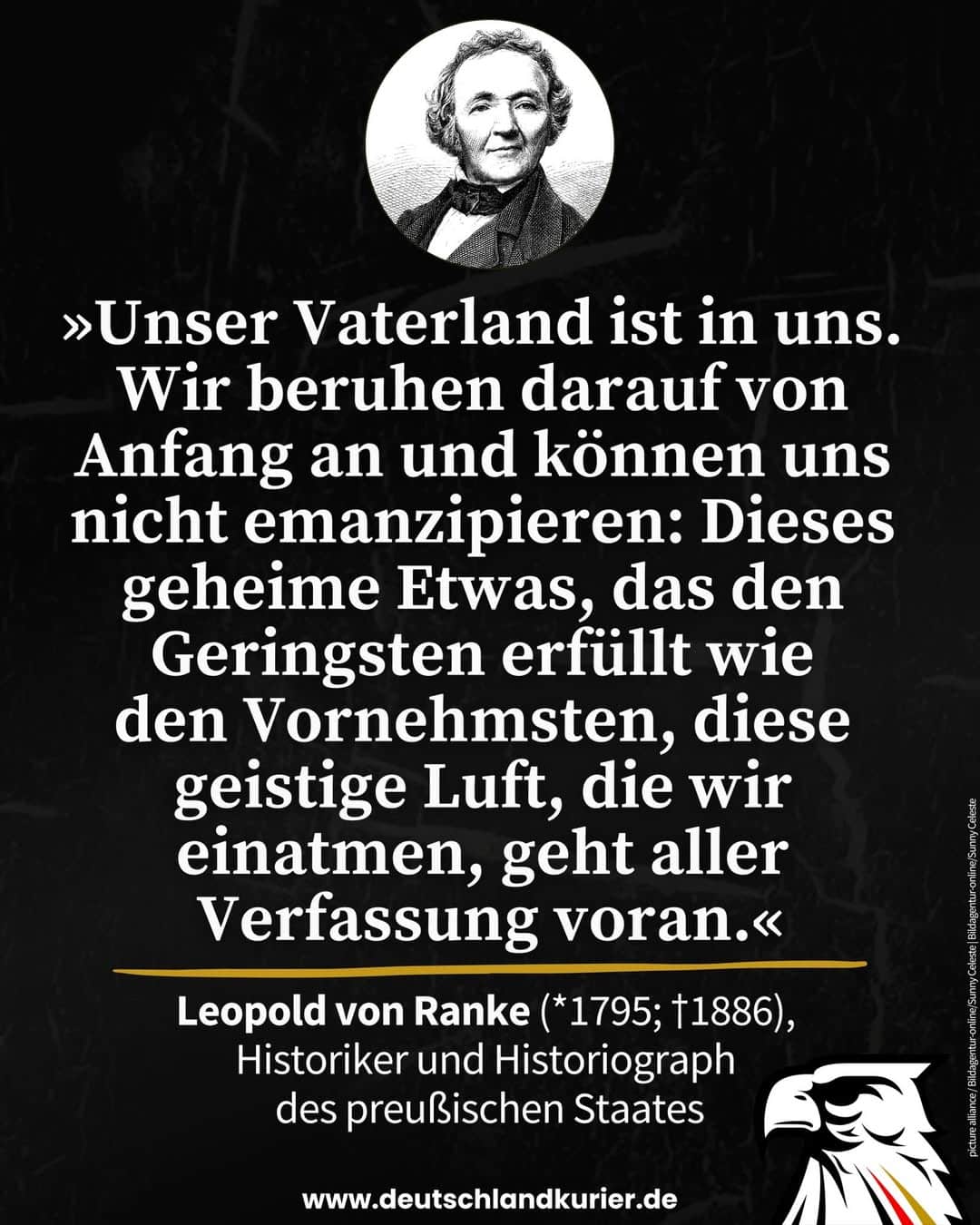

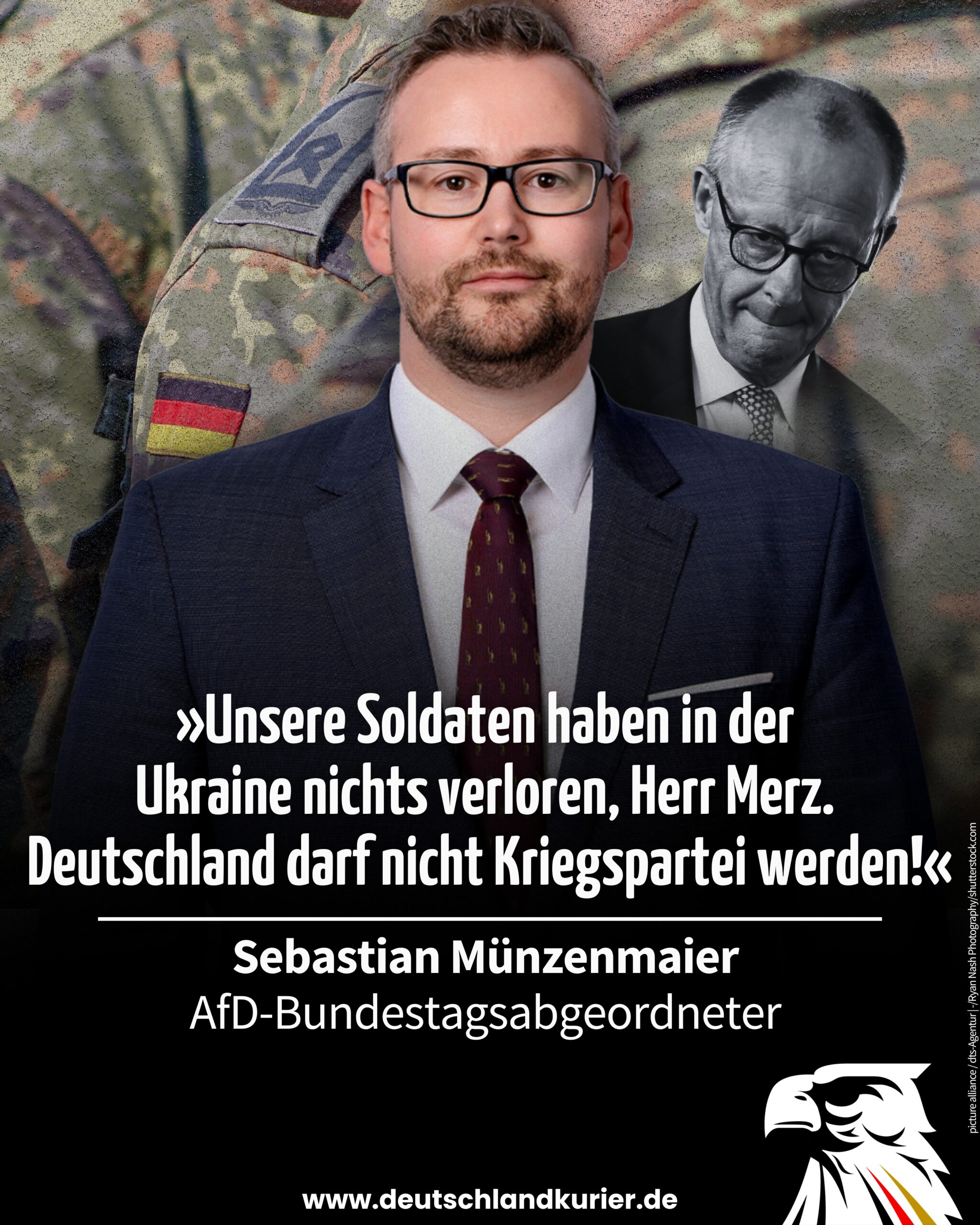
 UKRAINE-KRIEG: "Mal sehen, was rauskommt" – Trump setzt Selenskyj unter Druck | LIVE-SONDERSENUNG
UKRAINE-KRIEG: "Mal sehen, was rauskommt" – Trump setzt Selenskyj unter Druck | LIVE-SONDERSENUNG






























