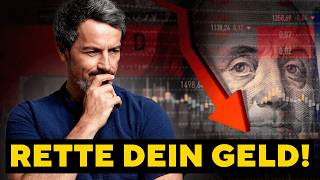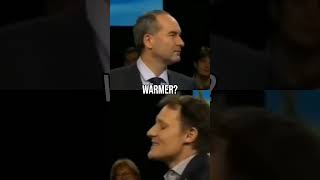Wenn man so mancher Berichterstattung über die neue US-Regierung folgt, ist das Land mit Trumps Antritt wahlweise zu einer „Oligarchen-Republik“, „Broligarchie“ oder Herrschaft der „Räuberbarone“ geworden. Die Bilder von Musk, Zuckerberg und Bezos, wie sie sich zur Amtseinführung um den neuen Präsidenten scharen, gelten als Beweis genug.
Die neue linke Angriffsschiene auf Trump und seinen Triumph bei den letzten US-Wahlen ist klar: Statt Marionette Putins (verzweifelter Erklärungsversuch von 2016) soll er diesmal eine Marionette des amerikanischen „Big Business“ und vor allem „Big Tech“ sein. Dieser Delegitimierungsansatz war Linken eigentlich schon immer lieber als der – zwar wahrheitswidrige, aber wenn man ehrlich ist vom Grundimpuls viel eher konservative – Vorwurf des Verrats ans Ausland. Trump und der amerikanische Wild-West-Kapitalismus – alles in einem Feindbild, das fühlt sich auch für viele deutsche Journalisten, die doch so gerne besser wissen, wie es in Washington laufen sollte, viel passender an.
Aber tatsächlich nicht nur hierzulande: Auch US-Linke schalten in ihrer Verzweiflung neuerdings auf diese Attacke um. „Donald Trump stellt eine Regierung zusammen, die sich auf die Wall Street konzentriert – nicht auf die Main Street“. Mit „Main Street“ sind hier die Durchschnittsamerikaner gemeint. Mit solchen Tweets versuchen aktuell die US-Demokraten Stimmung gegen Trump zu machen. Es sind fast wortwörtlich die gleichen Sprüche wie vor 12 Jahren: „Barack Obama kümmert sich um die Main Street. Mitt Romney kümmert sich um seine Freunde an der Wall Street“, hieß es damals.
Eine altbewährte Formel? Nur wenn Donald Trump Mitt Romney wäre – aber das ist er nicht. Die Uhren stehen nicht auf 2012, sondern 2025. Die republikanische Partei sieht völlig anders aus, denn in vielerlei Hinsicht trat Trump als Gegenstück zu Romney auf – auch wenn er selbst Milliardär ist. Man könnte meinen, das hätte man seit dem jahrelangen Philosophieren über „Trumpismus“ langsam gelernt, aber offenbar nicht.
Nur weil CEOs seinen Sieg jetzt wahlweise als eigenen Befreiungsschlag gegen woke Unternehmenskultur im eigenen Haus oder mitunter als opportunistisches Einreihen hinter seine Regierung nutzen, heißt das nicht, dass er nicht jahrelang gegen das Establishment in Washington und auf der Wall Street gekämpft hat.
Allein ein Blick auf die Wahlkampfspenden sagt dabei alles: Dort versammelten sich die Wall Street, die US-Bürokratie, die meisten Mitarbeiter im Silicon Valley und Top-Unis mit Millionen von US-Dollar hinter Trumps Rivalen Biden und Harris. Fast drei Milliarden US-Dollar konnte die Harris/Biden-Kampagne im letzten Wahlkampf einsammeln. Trump hingegen nur gut halb so viel – und allein ein Sechstel davon von Musk, der erst in den letzten Monaten auf Trump-Kurs umschwenkte und dabei eine wirkliche Ausnahme unter den Milliardären des Landes blieb.
Und auch Zuckerbergs durchaus ernstzunehmender Sinneswandel nach der Wahl ändert nichts daran, dass es schließlich seine Plattformen waren – neben dem alten Twitter – die Trump jahrelang zensierten. Sie verbannten ihn völlig, bis zu dem Punkt, wo er mit Truth Social seine eigene Social-Media-Welt aufbaute.
Der neue Klassenkampf-Sound der Demokraten wirkt gerade angesichts der massiven Wählerverschiebungen der Trump-Jahre immer realitätsferner. Bei der Präsidentschaftswahl 2025 stimmte etwa zum ersten Mal seit den 60er-Jahren eine Mehrheit des ärmsten Wählersegments, jene, die weniger als 50.000 US-Dollar im Jahr verdienen, mit Trump für einen Republikaner. Harris hingegen gewann eine deutliche Mehrheit des wohlhabendsten Drittels der amerikanischen Wähler, die mehr als 100.000 US-Dollar im Jahr verdienen.
Trump-Wähler kommen zunehmend aus der Arbeiterklasse, die genug hat von woker Gesellschaftspolitik und einer Einwanderungspolitik, die auf günstige illegale Einwanderer als Arbeitskräfte setzt. Demokraten hingegen haben inzwischen das akademische und wohlhabende Milieu fest in der Hand. Die Klischees von „Country Club“- und „Big Business“-Republikanern und „Working Class“- und „Minority“-Demokraten passen somit nicht mehr ins heutige Bild – Trump begeistert auch immer mehr Afroamerikaner und gerade Latinos für sich.
Mit dem Oligarchen-Vorwurf wollen die Demokraten vor allem ihre aktuelle Hilflosigkeit kaschieren. Die Partei ist orientierungslos. Soll man jetzt weiter nach links in eine sozialistische Richtung gehen und so versuchen, Arbeiter zurückzugewinnen? Oder sich moderat zeigen und vom Kulturkampf abgestoßene Wähler so ansprechen? Letzteres würde aber auch ein gewisses Arrangieren mit Trump bedeuten. Es bleibt noch die Möglichkeit, auf den Status Quo zu setzen – auf eine gescheiterte woke Establishment-Politik von Kamala Harris und Hillary Clinton.
Wie ernst man es wirklich mit den „Main Street statt Wall Street“-Sprüchen meint, zeigte kürzlich Ken Martin, Favorit für den nächsten Parteivorsitz der Demokraten (vergleichbar mit einem Generalsekretär in deutschen Parteien). Er erklärte den aktuellen Kampf gegen „Oligarchen“ so: Es gäbe „böse Milliardäre“ wie Musk, die man bekämpfen müsse – Millionen-Spenden von der Wall Street einzusammeln, sei aber kein grundsätzliches Problem, wie der linke Parteiflügel meint. Solange man von „guten Milliardären“ Unterstützung bekäme, sei daran nichts verwerflich, so Martin.
Diese Argumentation verdeutlicht eindrucksvoll das Dilemma seiner Partei, die neuesten Umfragen zufolge so unbeliebt ist wie noch nie seit Aufzeichnungsbeginn: Nur 31 Prozent der Amerikaner sehen die Demokraten laut der letzten Quinnipiac-Umfrage noch positiv, ganze 57 Prozent sehen sie klar negativ. Präsident Biden selbst verließ sein Amt mit 36 Prozent kaum beliebter. Mit seinem langen Verbleib im Rennen hat er in seiner Partei jede mögliche Rolle als Machtfaktor im Hintergrund, wie es einst Obama genoss, verloren.
Das „Oligarchie“-Gerede ist damit vor allem eins: Ein verzweifelter Versuch einer Partei, die völlig am Boden liegt – ohne klare Führungsfigur oder Orientierung. Für Trump ist das eher ein Zeichen des Triumphs.






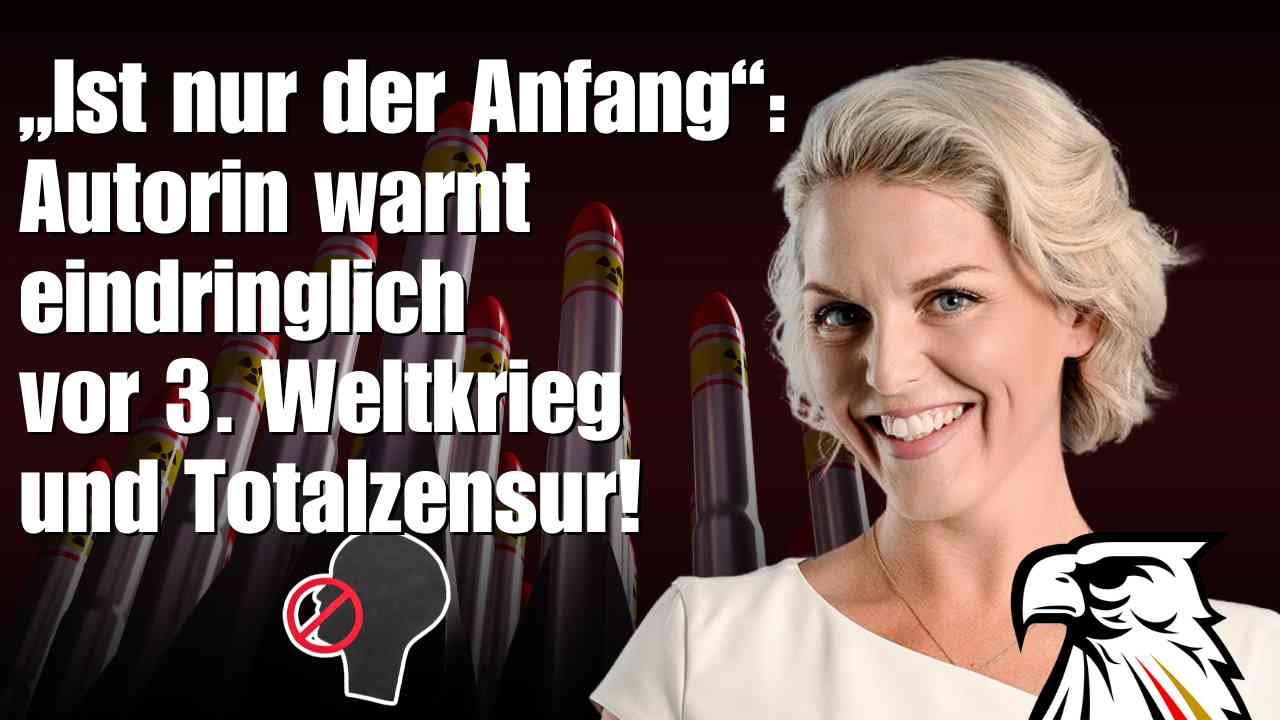

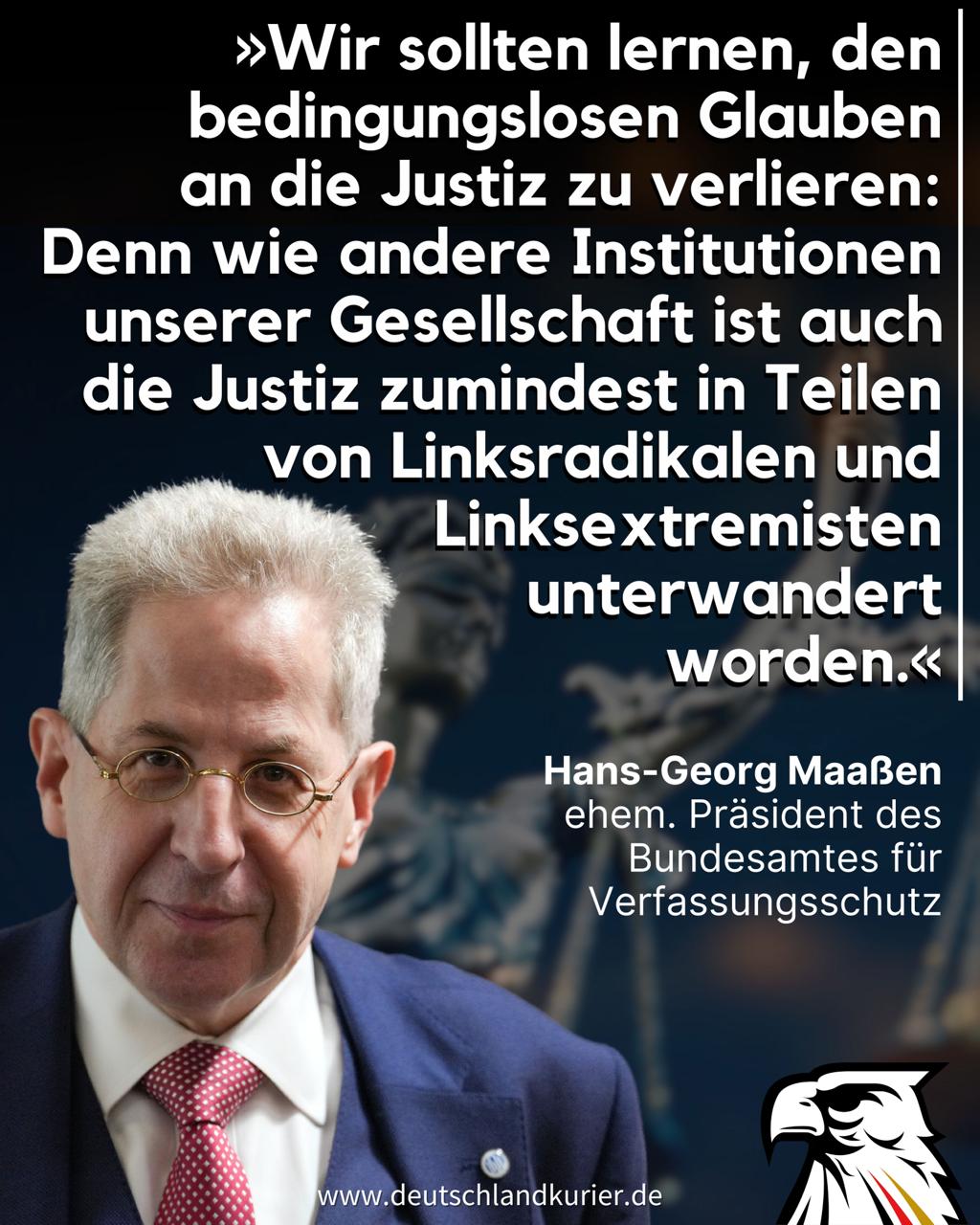

 KRIEG MIT IRAN: Explosion bei Live-Sendung! Rakete aus Israel trifft Staatssender I WELT STREAM
KRIEG MIT IRAN: Explosion bei Live-Sendung! Rakete aus Israel trifft Staatssender I WELT STREAM