
Die nächste Parlaments-Wahl in Ungarn wird voraussichtlich erst im April 2026 abgehalten. Doch schon jetzt rüsten die Kontrahenten, befindet sich das Land im Dauerwahlkampf. Tatsächlich geht es nicht um Ungarn, sondern um die Gestalt der künftigen EU. Und daher hat die Wahl Auswirkungen auch auf Deutschland – den Verbleib der Reste seiner Souveränität sowie die künftige Gestaltung von Wirtschaft und Wohlstand.
Jedes Jahr findet im ungarischen Ort Kötcse ein „Picknik” der „Stiftung für ein Bürgerliches Ungarn” statt. Das ist die Parteistiftung der ungarischen Regierungspartei Fidesz, ähnlich der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Deutschland. Hier versammeln sich – nur auf persönliche Einladung – all jene, die in Fidesz die Stimme des bürgerlichen Ungarn sehen, und in jenen wiederum Fidesz relevante bürgerliche Stimmen erkennt. Es sind also „Multiplikatoren“, Personen des öffentlichen Lebens, aus Kultur, Wirtschaft und Politik.
Jedes Jahr hält Orbán eine Rede darüber, wie er sich das nächste Jahr vorstellt, auf der Grundlage einer umfassenden Analyse der Gesamtlage und der politischen Dynamik im Land, in der EU, und in der Welt. Darüber wird dann diskutiert. Das alles intern. Wer etwas ausplaudert, oder gar aufnimmt und veröffentlicht, dem droht die harte Strafe, nächstes Jahr nicht mehr eingeladen zu werden. Nie hat jemand gegen die Regel verstoßen.
Aber dieses Jahr war alles anders, denn Orbáns Herausforderer bei den anstehenden Wahlen 2026, Péter Magyar, hatte eine Parallel-Veranstaltung angekündigt. Auch er kam nach Kötcse, mit einigen Hundert Anhängern, am Ende waren es vielleicht gar um die 1500, und hielt selbst eine Rede, ein paar Straßen entfernt.
Er hat sich das zur Gewohnheit gemacht: Alles, was Orbán macht, macht er nach. Orbán hält seine jährliche Sommer-Rede im siebenbürgischen Tusványfürdő (Baile Tusnád)? Péter Magyar hält am selben Tag eine ähnlich strukturierte Rede in Székesfehérvár. Und nun also auch eine Orbán-Imitation von Magyar in Kötcse. Sogar die Semantik seiner Rede („ein starkes und reiches Ungarn“) war teilweise buchstäblich wortgleich mit Orbáns Formulierungen.
Magyars Schattenspiel bewegte Orbán, diesmal auch seinen Vortrag öffentlich zu halten, es wurde gestreamt.
Vorweg: Ich bin zwar sonst immer dabei in Kötcse, war diesmal aber anderweitig in der Pflicht, ich hielt eine Lesung in Siebenbürgen. Orbáns Reden snd immer witzig, locker und anhand einiger handschriftlicher Stichworte souverän improvisiert. Diesmal sagte er selbst, da es öffentlich sei, werde er vorsichtiger sprechen. Tatsächlich war die gestreamte Rede – ich verfolgte sie nur online – zwar gehaltvoll und selbstbewusst wie immer, aber etwas weniger unterhaltsam als sonst.
In zweierlei Hinsicht war das Veranstaltung-Duell das zentrale politische Ereignis des (bisherigen) Jahres in Ungarn. Zum einen war es ein Blick in die Zukunft von Wahlkämpfen, wie das Orbán-krtitische Nachrichtenportal Telex treffend schrieb: maximale Mediatisierung im Online-Raum. Alles passiert online, und wird digital verstärkt von den jeweiligen Teams und Anhängern der beiden Kontrahenten. Ein pausenloses Content-Bombardement. (Telex nannte das Duell vom Ergebnis her ein Unentschieden).
Wichtiger: Erstmals war Magyar gezwungen, etwas Inhaltliches zu seinen politischen Vorstellungen zu sagen.
Bislang war er als One-Man-Show erfolgreich, mit teilweise brutal aggressiven Angriffen gegen den politischen Gegner, und teilweise menschelnden, öligen Phrasen, das alles auf Facebook. Auch diesmal menschelte es sehr. Er stellte „neue Gesichter” vor (einen Wirtschaftsexperten, der mal eine westliche Bank-Tochter in Ungarn leitete und davor auch einige Monate lang Staatssekretär war in der zweiten Orbán-Regierung, ohne nennenswerte Spuren zu hinterlassen) und eine bei den Kommunalwahlen 2024 gescheiterte Kommunalpolitikerin, die sich nun für Magyars Tisza-Partei mit dem Thema Tourismus beschäftigen soll. Beide sagten fast wortgleich auf, was offenbar die Kommunikationsexperten ihnen vorgegeben hatten: Sie wollten eine „Politik für die Menschen“, denn bei ihnen stehe „der Mensch im Vordergrund“. Was immer das heißen mag.
Aber Magyar selbst war inhaltlich in der Defensive und musste konkrete Dinge sagen – denn kurz zuvor waren unglückliche Bemerkungen zweier führender Tisza-Politiker im Internet bekannt geworden, MEP Tarr Zoltan und Wirtschaftsstratege Áron Dálnoki. Dálnoki hatte von „progressiven Steuern“ gesprochen (In Ungarn gibt es eine Flatrate-Einkommensteuer von 15 Prozent) und Tarr hatte peinlicherweise gesagt: „Es gibt viele Dinge, über die wir nicht sprechen können, weil wir sonst die Wahlen verlieren.“ Fidesz machte daraus sofort eine wirkungsvolle Kampagne, wonach Tisza Steuererhöhungen plane.
Das zwang die Partei erstmals, Inhaltliches zu sagen über ihre Wirtschaftspläne. Demnach will man mit Steuergutschriften die Einkommensteuer für niedrige Einkommen senken, ansonsten bleibt es – angeblich – bei den 15 Prozent, und dazu soll es eine „Vermögenssteuer” geben von 1 Prozent auf Vermögen über 2,5 Millionen Euro (bestehend aus Geld, Wohneigentum, Autos, Einrichtungsgegenständen, wobei für alle Familienangehörige zusammengerechnet wird). Dazu ging Magyar ins Detail: In der Familienpolitik will er, statt wie Fidesz Steuerermäßigungen für Familien, lieber eine Verdoppelung des Kindergeldes (populär bei ärmeren Bevölkerungsschichten, die mit Steuervorteilen wenig anfangen können, weil sie wenig oder gar kein Geld verdienen).
Im Klartext bedeutet das: Fidesz will die bürgerliche Mittelschicht stärken, Magyar hingegen – in klassischer sozialistischer Manier – die Armen. Das wird manchen ärmeren Roma gefallen, die viele Kinder haben, aber wenig Einkommen.
Das Haupthema aber war am Sonntag auf beiden Seiten die EU. Bisher hatte man von Tisza dazu wenig mehr gehört als den Slogan „Wir bringen die EU-Gelder nach Hause“, wofür freilich nötig wäre, all die EU-Forderungen zu erfüllen, die Orbán nicht erfüllt – etwa in der Migrationspolitik. Jetzt aber kam ein wahres Glaubensbekenntns, wie in der Kirche: „Wir bekennen uns dazu und sprechen es aus: Unser Platz ist im Verbund der EU und der Nato.“ Magyar benutzte das ungarische Wort „kötelék“, was mehr bedeutet als nur „Mitgliedschaft“ – es verweist auf ein Treueverhältnis, anders als bei Orbán, der die EU eher als Interessengemeinschaft sehen möchte. Magyar kündigte an, Ungarn werde „wieder ein aktives und glaubwürdiges Mitglied der EU und der Nato“ sein, und sich nicht mehr „an Diktatoren anbiedern“. Sprechchöre, ob orchestriert oder nicht, verlangten die Einführung des Euro.
Jedenfalls versprach Magyar de facto, mit der EU- und Nato-Strategie einer neuen westlichen Blockbildung zu folgen, während Orbán „Konnektivität“ will – gute Wirtschaftsbeziehungen mit jedem Land, auch mit Russland und China.
Orbán zeichnete in seiner Rede das genaue Gegenteil: Er nannte die EU zunehmend bedeutungslos, weil sie eine Reihe falscher strategischer Entscheidungen getroffen habe. Er prophezeite ihren Zerfall, falls sie sich nicht reformiere – schon der nächste EU-Haushalt könne der letzte sein, wenn man sich überhaupt auf diesen letzten einigen könne (die aktuellen Haushaltspläne drehen sich um eine massive Unterstützung der Ukraine zu Lasten aller anderen EU-Mitglieder).
Er nannte die EU-Politik blind, „undemokratisch“, und kontrastierte den rüchgängigen EU-Anteil an der Weltwirtschaft in den letzten Jahren (minus 8 Prozent, ihm zufolge) mit einem wachsenden Weltmarktanteil der USA (plus vier Prozent).
Das alles war deswegen fasznierend, weil Orbáns Wahlkampf ausdrücklich darauf zielt, Magyar als „Diener der EU“ darzustellen, sich selbst hingegen als Verteidger der „Souveränität“. Erstmals nun bekennt sich Magyar vollkommen zu dieser Rolle eines Musterschülers der EU. Als Analyst müsste man sagen: Er spielt Orbán in die Hand.
Aber das stimmt nur, wenn Orbáns Analyse stimmt und eine relative Mehrheit der Bürger die EU eher skeptisch sieht. Magyars leidenschaftliche Umarmung der EU kann eigentlich nur bedeuten, dass in seiner Analyse die Mehrheit der Ungarn mehr EU wünscht, nicht weniger. Und Orbáns EU-Skepsis kann nur bedeuten, dass in seiner Anayse die Mehrheit eher weniger als mehr EU wünscht. Nur einer kann Recht haben.
Der Ausgang der Wahl wird also davon abhängen, wer die Stimmung im Volk besser verstanden hat.
Die Wahl wird deswegen auch einen Impakt haben auf die Zukunft der EU: Fällt Orbán, so fällt der letzte Rebell gegen die Zentralisierungspläne der EU. Es wird leichter fallen, die Ukraine wider alle „Kopenhagener Kriterien“ schnell aufzunehmen, und unter diesem Vorwand die institutionellen Strukturen der EU weiter zu zentralisieren. Gewinnt Orbán, so wird es schwerer fallen, die gegenwärtige Strategie der EU beizubehalten, die darin besteht, geopolitisches Schwergewicht in der Welt zu werden – wozu interner Widerstand wie jener Orbáns gebrochen werden muss.



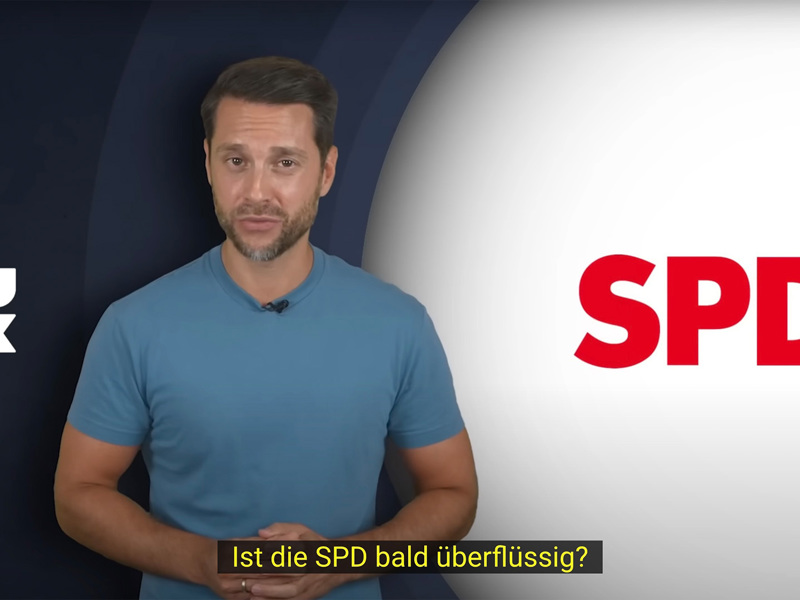




 UKRAINE-KRIEG: Putin zielt aufs Herz der Ukraine! Klitschko warnt vor Eskalation! STREAM
UKRAINE-KRIEG: Putin zielt aufs Herz der Ukraine! Klitschko warnt vor Eskalation! STREAM






























