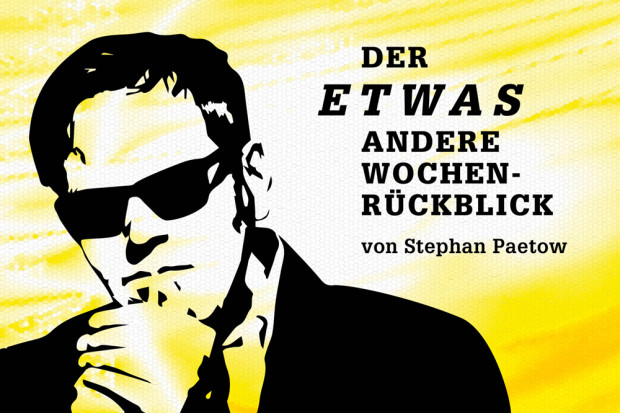Der Landtag wählt am 5. Februar 2020 Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten Thüringens. Der erste liberale Landesvater im Osten. Am 4. März 2020 tritt er zurück – auch auf Druck von FDP-Chef Christian Lindner. Zwei Wochen vor dem ersten Corona-Lockdown. Danach fällt die Partei in den bundesweiten Umfragen von etwa acht auf sechs Prozent. Die Partei erholt sich davon erst gegen Ende des zweiten Lockdowns, der im November 2020 beginnt und erst ab Mai 2021 schrittweise endet.
Soweit die Vorgeschichte. Sie ist wichtig für ein strategisches Papier, das die FDP-Führung für den eigenen Gebrauch erstellt hat und das TE vorliegt. Mit einer Datenanalyse will die Partei sich erklären, was bei ihr in den letzten Jahren schief gelaufen ist. Doch setzen die für das Papier Verantwortlichen die Fehler fort, die sie benennen. Sie fordern, die FDP solle mehr Mut beweisen und ebenso einfacher wie ehrlicher kommunizieren – nennen dann aber den erzwungenen Rücktritt Kemmerichs die „Thüringen-Situation“. So als ob der ehemalige Ministerpräsident der Lord Voldemort der Partei wäre, dessen Namen nicht genannt werden darf.
Die FDP sagt das eine, macht das Gegenteil, zieht die falschen Schlüsse und trifft dann die falschen Entschlüsse… Nur: Wäre das anders, wäre die Partei nicht aus dem Bundestag geflogen oder würde sich zumindest nach all den gebrochenen Versprechen von Friedrich Merz (CDU) jetzt allmählich erholen. Tatsächlich will aber laut Umfragen nur noch ein harter Kern von drei Prozent der Wähler die FDP wählen – wobei diese Umfragen eine Fehlerwahrscheinlichkeit von bis zu zwei Prozent aufweisen.
Trotzdem ist die Analyse spannend. Sie sagt vieles aus über die Wähler, die spätestens seit 2015 eine neue Heimat suchen: Über 5 Millionen Bürger haben die FDP bei den Bundestagswahlen 2017 und 2021 gewählt. Etwa 2,5 Millionen Stimmen braucht sie, um bei diesen Wahlen ins Parlament einzuziehen. Nach dem von Lindner und Angela Merkel (CDU) erpressten Rücktritt Kemmerichs – die „Thüringen-Situation“ – hat die FDP eine Million Wähler in den Umfragen verloren.
470.000 dieser Wähler gingen an Union und „andere“. Wie viele davon an die AfD, das verschweigt das Papier. Die Macher des Papiers ziehen daraus den Schluss, dass der Fehler darin lag, dass die Wahl Kemmerichs dem Image als „Rechtsstaatspartei“ geschadet und Kooperationsbereitschaft zur AfD hin gezeigt habe. Ist gut, legt euch wieder schlafen. Die Idee, dass es Wähler verschrecken könnte, wenn die Partei den eigenen Mann zum Rücktritt zwingt, lassen die Macher gar nicht zu. Aber es gibt halt Gründe, warum die FDP aus dem Parlament geflogen ist.
Aber genau an der Stelle liegt der Schlüssel zu wahren statt zu gewollten Erkenntnissen: Deutlich steilere Abstürze erlebt die FDP an zwei späteren Punkten. Den stärksten, als Anfang 2022 die Ampel ins Arbeiten kommt und die Wähler erkennen, wofür sie in der Tat statt nur in den Worten steht. Dieser Absturz beginnt bei knapp 15 Prozent in den Umfragen und geht über fast zwei volle Jahre. Ausgerechnet 2024 bremst dieser Absturz ab. Fast das gesamte Jahr 2024 verharrt die FDP bei 5 Prozent, obwohl dieses Jahr von inhaltlichem Stillstand und Streit zwischen den Ampel-Partnern geprägt ist. Der zweite Absturz beginnt erst nach dem Aus der Ampel und führt die FDP unterhalb die entscheidende Fünf-Prozent-Hürde, an der sie dann auch bei der Wahl im Februar 2025 klar scheitert.
Bei den Bundestagswahlen 2017 und 2021 erreicht die FDP 5 und 5,3 Millionen Wähler. In diesem Februar stürzt sie auf 2,15 Millionen Stimmen ab. 1,3 Millionen Wähler verliert die FDP an die Union, 890.000 Wähler an die AfD und immerhin noch 160.000 Wähler an das Bündnis Sahra Wagenknecht. Mit diesen Stimmen wäre die Partei bei etwa acht Prozent gelandet. Trotzdem glaubt die Parteiführung, dass sie wegen Kooperationsbereitschaft nach rechts abgestraft worden sei. Zum letzten Mal, versprochen: Es gibt wirklich Gründe, warum die FDP nicht mehr im Parlament ist.
2021 konnte die FDP noch 1,3 Millionen Wähler von der Union gewinnen, 880.000 aus dem Resservoir der Nichtwähler und 380.000 Wähler von der FDP. Verzockt hat es die Partei dann in den Verhandlungen mit SPD und Grünen. In den Koalitionsverhandlungen konnten sich die Liberalen nicht durchsetzen. Also gab es weder niedrigere Steuern und Abgaben noch staatliche Deregulierung. Die Erfolge der FDP bestanden darin, einige rot-grüne Projekte zu verhindern wie das Aufweichen der Schuldenbremse oder ein Tempolimit auf der Autobahn. Nur wählt einen halt keiner, für das, was man nicht tut.
Die heutige FDP-Führung hat richtig erkannt, dass es ein Problem war, dass sie mit SPD und Grünen ihre „Flagship-Reformprojekte“ nicht umgesetzt hat und gar nicht umsetzen konnte. Nicht eines. Die Erkenntnis der heutigen FDP-Führung: Nachdem das klar war, „hätten wir neue Flagschif-Reformprojekte gebraucht“. Nur war das genau das, was die FDP in der Ampel gemacht hat: Weil sie das Recht auf Meinungsfreiheit nicht stärken konnte, hat ihr Justizminister Marco Buschmann das Recht mit dem „Selbstbestimmungsgesetz“ massiv eingeschränkt. Zum Beispiel.
Die drei Abstürze der FDP lassen andere Schlüsse zu, als sie die Parteiführung zieht. Einige Schlüsse gelten für alle Parteien: Wenn eine Partei nicht zu sich steht, wie nach der „Thüringen-Situation“, dann finden Wähler das nicht sexy. Wenn eine Partei wegen einer Koalition das Gegenteil von dem macht, was sie versprochen hat, strafen ihre Wähler sie hart ab. Und wenn sie konsequent nicht konsequent ist, führt das zum Ende. Wie bei der FDP. Denn in ihrem eigenen Papier steht, das der Rauswurf aus dem Bundestag Ende 2024 trotz Heizhammer, Atomausstieg, Verlängerung der Pandemiepolitik und Selbstbestimmungsgesetz noch vermeidbar gewesen wäre. Man muss ein solches Papier nur lesen können – oder wollen.
Denn rund um das Ende der Ampel hat ihr damaliger Vorsitzender Christian Lindner alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Zwar bestimmte sein Streit mit SPD und Grünen das Jahr 2024 bis zu dessen November. Doch das verübelten die harten Wähler der Partei nicht. Sie blieb auf fünf Prozent stehen. Lindner hätte elf Monate Zeit gehabt, die Koalition zu zerbrechen und damit einen Teil der Wähler zurückzugewinnen, der diese nie gewollt hat.
Doch Lindner zauderte. So lange, bis der eigentlich handlungsschwache Olaf Scholz (SPD) ihn rauswarf. Zuerst wollte Lindner gleichzeitig mit der Ampel regieren und als ihr größter Gegner dastehen. Dann wollte er der sein, der sie beendet und dennoch als der gelten, der aus Verantwortung in der Regierung geblieben ist. Solche Taschenspielertricks ziehen nicht mehr bei den Wählern. Die Wähler suchen konsequente und zuverlässige Parteien. Als Christian Lindner dann Marco Buschmann zum Generalsekretär machte, bewies er endgültig, dass er nicht verstanden hatte. Die Wähler wollten die FDP nicht mehr, weil sie in der Ampel zu viel falsche Kompromisse gemacht hatte, und er besetzte ausgerechnet den Mann, der wie kein Zweiter für diese falschen Kompromisse stand.
Nur wohin sollen die frustrierten Wähler ziehen? Diese Frage führt zu der zweiten spezifischen Erkenntnis. Es gibt eine Wählergruppe, die heimatlos ist. Sie lässt bei Wahlen das Pendel in die eine oder andere Richtung schlagen. Diese Gruppe gibt es spätestens, seit Angela Merkel die CDU mit „Euro-Rettung“, Einwanderungspolitik und anderen Entscheidungen die Union nach links geführt hat. Doch eigentlich existiert diese Gruppe schon seit Statt Partei, WASG oder Piratenpartei – und im Osten seit der PDS. Diese Wähler als „rechtes Lager“ zu bezeichnen, ist wenig präzise.
Gerade der Erfolg der Piraten zeigt, dass es vielen dieser Suchenden nicht ausschließlich um rechte Positionen geht. Das zeigt auch der schnelle Aufstieg des Bündnis Sahra Wagenknechts im Jahr 2024. Diesen Wanderwählern geht es darum, Strukturen im real existierenden Politbetrieb aufzubrechen. Sie wollen keine Politiker mehr, die zwar versprechen, ihnen ginge es nicht um Posten und Privilegien, aber nach der Wahl das Gegenteil beweisen. Das zeigt der Abstieg des Bündnis Sahra Wagenknechts im Jahr 2025. Und erst recht wollen sie keine Partei, die meint, wenn sie ihre Grundsätze nicht durchsetzen könne, brauche sie halt andere Grundsätze – das zeigt die FDP-Situation.
Derzeit vereint die AfD das Lager der Wanderwähler hinter sich. Sie weicht nicht aus taktischen Gründen zurück oder gibt Positionen auf, um Koalitionen und damit Zugang zu Posten zu ermöglichen. Ob sie das aus Überzeugung tut, oder weil die anderen Parteien sie nicht lassen, ist so lange egal, so lange die „Brandmauer“ steht. Eine neue Partei aus dem Lager der Sonstigen wird es ebenso schwer haben wie Neugründungen. Wagenknecht hat alles richtig gemacht, als sie ihr BSW pünktlich zur Europawahl gründete und positionierte. Ein solches Fenster gibt es aber erst wieder 2029. Allerdings hat Wagenknecht den schweren Fehler begangen, sich nicht ausreichend darauf vorzubereiten, dass sie nach den Wahlen im Osten dort in Regierungsverantwortung kommen könnte. Als das noch junge BSW genauso operierte wie alle anderen der alten Parteien auch, ist es bei den Wanderwählern gleich wieder unten durch gefallen.
Die Union hatte sich eigentlich vorgenommen, mit der schwarz-roten Koalition so erfolgreich zu sein, dass sie die Wähler zurückgewinnt, die sie an das Wandererlager verloren hat. Doch indem Friedrich Merz (CDU) als Kanzler ein Versprechen nach dem anderen bricht und indem die Bundesregierung die rot-grüne Öko-Planwirtschaft fortführt, ausbaut und damit die deutsche Wirtschaft nachhaltig in den Abgrund führt, bringt Merz den Plan zum Scheitern. Das Lager der Wanderwähler wird unter ihm eher größer als kleiner. Es speist sich in zweiter Linie aus der SPD – und in erster Linie aus der Union. Das stärkt einerseits die AfD und macht andererseits mit einer hohen Zahl an eigentlich Unentschlossenen künftige Wahlen schwer berechenbar. Nur umso größer das Lager, das von der einen zur nächsten Hoffnung zieht, umso stärker wird dieses Lager Wahlen entscheiden. Die Wanderbewegungen zeigen, dass es schon vor dem Amtsantritt von Friedrich Merz gut zwei Millionen Stimmen stark war. Das heißt die Wanderwähler allein geben bald eine Partei ab, die in den Bundestag einziehen könnte.