
William S. Burroughs Roman „Naked Lunch“ von 1959 landete vorübergehend auf dem Index der Stadt Los Angeles, der amerikanischen Post und des Bundesstaats Massachusetts; der Autor musste zwei Gerichtsverfahren anstrengen, um die Verkaufserlaubnis an der Ostküste durchzusetzen. In Deutschland könnte das Buch möglicherweise demnächst wieder auf einer Liste gesellschaftsgefährdender Schriften landen, und zwar nicht wegen des ausführlich geschilderten Drogen- und Sexkrams, sondern wegen einer außerordentlich luziden Beschreibung des rundum zupackenden Staates, der seine Bürger konsequent zu unterwürfigen Wesen abrichtet. Burroughs fiktionaler Staat heißt Annexia, der nicht durch konventionelle Brutalität herrscht, sondern durch ein Netz bürokratischer Vorschriften, das genaugenommen nur für die Normalexistenzen gilt, während der herrschende Apparat sich in der konkreten Anwendung und Ausführung der Gesetze Freiheiten nach Gutdünken genehmigt.
„Jeder Bürger von Annexia“, heißt es in „Naked Lunch“, „war gehalten, sich eine ganze Aktenmappe mit Ausweispapieren ausstellen zu lassen und diese jederzeit mit sich zu führen. Alle Bürger konnten jederzeit auf offener Straße angehalten werden; und der Kontrolleur, der in Zivil, häufig in einem Badeanzug oder Pyjama auftrat […], stempelte die Papiere ab, nachdem er jedes einzelne geprüft hatte. Bei der folgenden Prüfung musste jeder Bürger die ordnungsgemäß ausgeführten Stempel der vorangegangenen vorweisen. Wenn der Kontrolleur eine größere Gruppe kontrollierte, dann überprüfte und stempelte er nur die Papiere einiger weniger. Die übrigen würden bei der nächsten Prüfung verhaftet, weil ihre Papiere nicht ordnungsgemäß abgestempelt waren. Verhaftet bedeutete ‚zwischenzeitliche Verwahrung‘, das heißt, dass der Gefangene freigelassen würde, wenn und sobald eine vom Stellvertretenden Gutachter für Erklärungen korrekt unterschriebene und gestempelte eidesstattliche Erklärung vorgelegt wurde. Aber da dieser Beamte nur selten in sein Büro kam und die eidesstattliche Erklärung nur persönlich beantragt werden konnte, verbrachten die Antragsteller Wochen und Monate damit, in ungeheizten Büros zu warten, die weder über Stühle noch Toiletten verfügten […]. Die Bürger hetzten von einer Dienststelle zur anderen in dem verzweifelten Bemühen, Fristen zu wahren, die sie unmöglich einhalten konnten.“
Den Zweck dieses Prozederes nennt der Autor auch: „Nach ein paar Monaten einer solchen Behandlung kauerten die Bürger wie neurotische Katzen in den Ecken.“ Staaten wie Annexia entstehen nie über Nacht, sondern stufenweise. Es gibt niemals einen fertig ausgearbeiteten Plan für das Gebilde, sondern einen Grundgedanken, aus dem sich eigengesetzlich immer feinere und komplexere Regelungen ergeben. Dieser Grundgedanke lautet: Der Staat darf auf den Bürger in jeder Beziehung zugreifen. Umgekehrt muss sich der Staat nicht um irgendwelche Wünsche und Willensbekundungen der Bürger scheren. Spätestens hier verlässt dieser Text die fiktionale Zone. Denn die politische Kaste Deutschlands teilt diese zentrale Gesellschaftsidee mit den Lenkern von Annexia, auch wenn die Details nicht ganz dem Entwurf von Burroughs entsprechen. Wobei sich viele Unternehmer mit ihren Berichtspflichten, Antragsformularen und Meldefristen schon so fühlen, als würden sie in einer Vorstufe des Burrough’schen Drogentraums leben.
Zwei Grünenpolitiker wünschen sich neuerdings, dass der Zugriffsstaat demnächst fast alle Landesbewohner in den Blick nimmt, und zwar, wie sie betonen, aus Gerechtigkeitsgründen. Die bayerische Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze schlägt zusammen mit ihrem Parteikollegen Florian Siekmann eine allgemeine Dienstpflicht für alle Bürger zwischen 18 und 67 unter der bemerkenswerten Bezeichnung „Freiheitsdienst“ vor.
In der Wortschöpfung steckt noch ein gutes Stück mehr Haltung und Programm als in „zwischenzeitliche Verwahrung“ oder „Demokratieabgabe“. Abzuleisten wäre die obligatorische Tätigkeit von sechs Monaten bei der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk, dem Katastrophenschutz oder im sogenannten Gesellschaftsdienst bei gemeinnützigen Organisationen, wobei vorerst noch offenbleibt, ob es sich dabei um die staatsfinanzierten Vereine handelt, zu denen die Union kürzlich 551 inzwischen wieder vergessene Fragen stellte. Falls das zutrifft, dann bräuchten die Omas gegen Rechts und unter 67 nicht irgendwo einzurücken, auch Mitarbeiter von Correctiv könnten ihre gesellschaftlich wertvolle Tätigkeit pausenlos fortsetzen.
Laut Schulze und Siekmann dürften Jüngere ihr halbes Jahr auch in der Bundeswehr ableisten, ihre Idee steht also im Zusammenhang mit der plötzlich wiederentdeckten allgemeinen Wehrpflicht. Es sei aber „unfair“, so Siekmann, „alle Last nur auf den Schultern der Jungen abzuladen“. Gerechtigkeit wollen die Dioskuren also dadurch herstellen, dass der Staat in Zukunft von jedem bis zum Rentenalter ein Stück seiner Lebenszeit beschlagnahmt. Warum und zu welchem Zweck? Um die Gesellschaft resilienter zu machen, gegen wen oder was auch immer. „Der Freiheitsdienst“, erklärt Siekmann, „ist viel mehr als der alte Wehrdienst, er zielt auf eine Gesamtverteidigung mit gesellschaftlicher Widerstandskraft.“ Es kommt, wie sich gleich zeigen soll, weniger auf die praktische Ausführung als vielmehr die Idee an, die beide der Restbevölkerung vermitteln wollen: Zur Verfügungsmasse des Staates gehören nicht nur Einkommen, Erspartes und Vermögen seiner Insassen, sondern grundsätzlich auch seine Lebenszeit. Also eigentlich alles.
Aus mehreren Gründen kommt der allgemeine Freiheitsdienst aller Wahrscheinlichkeit nach doch nicht so schnell. Was praktisch bedeutet, dass der Block der Zusammenstehparteien vorher eher noch eine Freiheitsabgabe auf unbewegliches Gut und/oder die Zeichnung einer obligatorischen Freiwilligkeitsanleihe einführt. Jedenfalls kündigte Ursula von der Leyen schon einmal an: „Wir werden private Ersparnisse in dringend benötigte Investitionen verwandeln.“
Das nämlich lässt sich vergleichsweise leicht bewerkstelligen. Denn dem Freiheitsdienst steht zum einen die Kopplung an die Wiederbelebung der Wehrpflicht entgegen. Die wiederum gehört, wie jeder mit Praxisberührung weiß, zu den freischwebenden Blasen, wie sie der politisch-mediale Betrieb serienweise ausstößt. Soldaten und Offiziere der Bundeswehr erklären gern im privaten Gespräch und unter der Voraussetzung, sie nicht namentlich zu zitieren, warum Deutschland auf absehbare Zeit keine Wehrpflichttruppe bekommt: Das beginnt mit Schimmel in Kasernen, bröckelndem Putz, undichten Fenstern. Der Sanierungsstau in den Bundeswehr-Liegenschaften beläuft sich aktuell auf 60 Milliarden Euro. Es fehlt also schon an zumutbaren Unterkünften für die bestehende Truppe; für Rekruten einer Wehrpflichtarmee gäbe es nirgends auch nur ansatzweise Platz. Außerdem weder die Ausrüstung noch die nötigen Ausbilder. Zurzeit verliert die Bundeswehr mehr Personal, als sie anwirbt.
Selbst die geplante Sollstärke der Berufsarmee von 203.000 Angehörigen bis 2031 bezeichnen die meisten Militärs im vertraulichen Gespräch als illusorisch. Nun könnten die von der Dienstpflicht begeisterten Politiker der Grünen und darüber hinaus ihren Plan natürlich auch ohne jede inhaltliche Verbindung mit der Bundeswehr weiterverfolgen. Schließlich sehen sie ja auch in Artikel 12 Grundgesetz kein Hindernis, das Zwangsarbeit verbietet und Dienstpflichten nur erlaubt, wenn es sich um „herkömmliche“ handelt, die Einführung neuer Pflichten also ausdrücklich untersagt. Aber selbst dann ergäben sich ein paar praktische Probleme. Zum einen nehmen Schulze und ihre Mitstreiter offenbar an, dass jeder seine eigentliche Arbeit für sechs Monate ohne irgendwelche negativen Konsequenzen für das Funktionieren des Landes verlassen kann, kurzum, sie schließen ganz selbstverständlich von sich auf den ganzen Rest.
Das zweite Problem, das sich aus der Dienstpflicht ergäbe, wirkt selbst nach diesen Maßnahmen etwas ernster: Es geht nämlich auch um Geld. Wenn der Staat auf die Lebenszeit und Arbeitskraft von Erwachsenen mit finanziellen Verpflichtungen von der Miete über Ratenzahlungen bis zum Unterhalt von Kindern zugreifen möchte, käme er nicht umhin, deren Bezahlung in bisheriger Höhe für sechs Monate zu übernehmen. Möglicherweise denken Grünenpolitiker, dass Firmen neben den Meldepflichten zum Lieferkettengesetz und allem Möglichen anderen auch die Gehaltsfortzahlung für den Gesellschaftsdiener übernehmen können. Was aber immer noch nicht die Frage beantwortet, wie sie sich die Vergütung der gut drei Millionen Selbstständigen und ebenfalls etwa drei Millionen Unternehmer vorstellen, die vorübergehend in Schulen vorlesen oder bei NGOs aushelfen sollen. Das wirklich schlagende Argument lautet allerdings: In ihrer Freiheitsdienstzeit könnten sie zumindest keine Steuern abliefern. Vermutlich beeindruckt dieser Punkt die Angehörigen des Politapparats mehr als alles andere, Grundgesetz eingeschlossen.
Eine Sicherheit dafür gibt es allerdings nicht. Denn bei Vorschlägen und kreativen Ideen aus dieser Sphäre kommt es schon längst nicht mehr auf Plausibilität und Folgen an, sondern im Wesentlichen auf Symbolgehalt und Binnenlogik. Beispielsweise arbeiten der Grünen-Vorsitzenden Franziska Brantner zufolge „Wissenschaft und Wirtschaft“ schon an einer EU-Variante von Google und Amazon, weshalb sie der Zollauseinandersetzung mit den USA zuversichtlich entgegensieht. Die Abschaltung der Kernkraftwerke blieb bekanntlich nicht nur eine Idee, sie geschah wirklich, und zwar ebenfalls mit der Begründung, das steigere die Resilienz des Landes. Vor wenigen Tagen erklärte die grüne Fraktionschefin Britta Haßelmann: „Wir Grüne haben Deutschland sicherer gemacht.“
Florian Siekmann, Jahrgang 1995 und ihr Sidekick beim Freiheitsdienstvorschlag, gelangte gleich nach dem Studium ins bayerische Parlament. Auch bei ihm führte der Weg über die qualifizierende Spitzenfunktion in der Grünen Jugend. Der Vorschlag: Jeder sollte irgendwann im Leben einmal was für die Gesellschaft tun, kommt also von Personen, die sich von Anfang an auf der Nehmerseite des Steuerstaates befinden und alles Erdenkliche tun, um sich dort dauerhaft festzusetzen.
Schulze erlangte eine größere Bekanntheit durch ein Video, in dem sie sich 2020 sichtlich aufgekratzt über islamische Terroranschläge in Frankreich verbreitete. Und zum zweiten durch ihre Rede im bayerischen Landtag von 2023, in der sie nicht nur die Corona-Impfpflicht forderte, sondern auch die Schließung des Handels für alle Ungeimpften.
Wie schon erwähnt: Schulze/Siekmann schlagen die Dienstpflicht nicht allein vor. Die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högl etwa lobte den Gedanken als „sehr, sehr gut“. Überhaupt stammt das Konzept der Dienstpflicht für alle zwischen Jugend und Rentenalter von allerhöchster Stelle, nämlich Frank-Walter Steinmeier, der sie zusammen mit mehreren Unterstützern schon seit längerem als Mittel bewirbt, um Wiralsgesellschaft zu festigen und die Risse darin – wie es in seinen Reden regelmäßig heißt – mit Kitt zu befüllen. Im vertrauten Bundespräsidententon klingt das dann so: „In dieser Zeit des Gegenwinds und der Veränderungen müssen wir alles stärken, was uns verbindet! Denn nur gemeinsam können und werden wir unsere Freiheit und unsere Demokratie verteidigen. Nur gemeinsam wird uns der Übergang ins postfossile Zeitalter gelingen. Und nur gemeinsam werden wir es schaffen, unseren Kindern und Enkeln ein gutes Leben auf unserem Planeten zu ermöglichen.“
Mit Dienstpflicht gegen Gegenwind, für die postfossile Ära und den Planeten – so die Kette der nun wirklich unabweisbaren Argumente. Es geht also gar nicht so sehr darum, dass jemand beim Technischen Hilfsdienst irgendetwas Nützliches erledigt. Sondern um Zusammenhalt, um Unseredemokratie. Und das Aufbrechen überkommener Strukturen natürlich, in denen niemand so hartnäckig feststeckt wie die Angehörigen der Nomalbevölkerung.
Bei Steinmeier heißt es dazu: „Einmal im Leben aus dem gewohnten Umfeld herauskommen und sich Menschen widmen, die in ganz anderen Umfeldern zuhause sind: Das ist die Idee der sozialen Pflichtzeit.“ Einmal, wenigstens einmal im Leben hinaus aus seiner Umgebung, aus seiner Wahrnehmungsblase, aus seiner Komfortzone: Gäbe es für diese Botschaft an die Menschen da draußen bessere Botschafter als die Steinmeiers, Schulzes und Högls? Selbstredend nicht.
Zu den Unterstützern der Steinmeier-Schulze-Vorstellung vom dienenden Bürger zählt neben anderen Funktionären auch Jens Kreuter, Hauptgeschäftsführer von „Engagement Global“, einem hundertprozentigen Ableger des Entwicklungshilfeministeriums. Er plädiert für eine sehr weit gefasste Indienstnahme von Bürgern und Zugezogenen nicht nur beim Technischen Hilfswerk, sondern auch im Gesundheitswesen, und das mit folgender Begründung, zitiert auf einer Webseite des Bundespräsidialamts:
„Wenn der eingefleischte AfD-Wähler sieht, mit welcher Liebe seine hoch demente Mutter von einem afghanischen Jugendlichen gepflegt wird, wird der seine Meinung ändern.“ Die Pflege einer dementen Person stellt aus seiner Sicht also nur ein Mittel dar; der eigentliche Zweck der Übung besteht darin, einem eingefleischten AfD-Wähler eine Lektion zu erteilen. Bei der Pflegearbeit handelt es sich für ihn um etwas, was jeder Jugendliche ohne weitere Voraussetzungen erledigen kann. Der Frage, weshalb es dann überhaupt eine Ausbildung zum Altenpfleger gibt, geht Kreuter deshalb gar nicht erst nach. Seiner Biografie zufolge verbrachte er fast sein gesamtes Berufsleben bei der EKD und dem Staat. Als Hauptgeschäftsführer von „Engagement Global“ erhielt er laut Corporate Governance-Bericht 2022 ein Salär von 127.859,55 Euro.
Erst ab dieser Gehaltshöhe, nämlich B6, beginnt die Zone, in der man sich überhaupt mit dem Zusammenhalten der Gesellschaft befasst. Diejenigen, die weit darunter rangieren und nicht ganz wunschgemäß zusammenhalten, kümmern sich nämlich um ganz andere Dinge. Ihnen nimmt der Staat derzeit 52,6 Cent von jedem verdienten Euro.
Der Grundsatz von Friedrich II: „Es ist gerecht, daß jeder einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber es ist nicht gerecht, daß er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staate teilen muß“, galt ganz früher einmal in despotischen Zeiten. Aber nicht mehr in der modernen Ära von Zusammenhalt und Resilienz. Auch nicht unter dem heutigen Friedrich. Nicht nur vom Verdienten, auch von dem, was der Einzelne davon nach Besteuerung beiseitelegt, möchte der Fiskus noch seinen Anteil.
Die SPD schlug im Zuge der Koalitionsverhandlungen vor, die Abgeltungssteuer, also die Steuer auf Zinsen und Dividenden, von derzeit 25 auf 30 Prozent zu erhöhen, plus Solidaritätszuschlag, was dann bedeuten würde, dass ein Sparer gut ein Drittel von jedem Ertrag abliefern müsste, der den schmalen Sparerfreibetrag von 1000 Euro im Jahr überschreitet. Die nächste Idee aus der gleichen politischen Richtung besteht darin, den steuerfreien Verkauf von Immobilien nach zehn Jahren zu streichen. Dazu kommen noch kreative Überlegungen zur Erhöhung der Erbschaftssteuer. Für neuerdings schlecht bezahlte und demnächst durch KI ersetzte Onlinemedienmitarbeiter liegt der ideale Steuersatz schon seit Jahren bei 100 Prozent.
Screenprint: Süddeutsche Zeitung
Screenprint: Spiegel
Auf der anderen Seite schlagen mehrere Politiker ein „Grunderbe“ für alle Landesbewohner ab 18 vor; die Angebote reichen von 20.000 (so der SPD-Politiker Carsten Schneider) bis 50.000 Euro pro Person (Linkspartei). Dass es auch hier wie bei dem Freiheitsdienst wieder um Gerechtigkeit und Zusammenhalt geht, versteht sich von selbst.
Die zu lernende Grundbotschaft für alle Einwohner unterhalb des politischen Apparats lautet: Dir gehört nicht dein Einkommen, nicht dein Erspartes, nicht deine Immobilie, nicht das im Leben Zusammengetragene, was du dir einbildest, an irgendjemanden deiner Wahl weiterreichen zu können. Und eben auch nicht deine Lebensstunden und -monate, sondern nur das, was wir davon verschont lassen. Denn alles unterliegt generell dem staatlichen Zugriff, der außer ein paar Stanzen wie Zusammenhalt und Resilienz keiner Begründung bedarf.
Diese Behandlung bewirkt etwas, um auf die Passage aus Burroughs Roman zurückzukommen. Sehr viele stellen nämlich gar nicht mehr die Frage, mit welcher Berechtigung eine verschwenderische und immer stärker in die Breite wuchernde Kaste ohne jede Verbindung zur Arbeitswelt und mit einem umso größeren Erziehungsdrang nach Gütern und Leben von Leuten greift, die sowieso schon alles tragen und zahlen. Stattdessen herrscht bei diesen konditionierten Bürgern schon eitel Freude, wenn die Abgeltungssteuer demnächst nicht auf 30, sondern nur auf 28 Prozent steigt. Oder wenn sie es schaffen, durch eine geschickte Schenkungsvariante mehr von ihrem Besitz in die Hände der nächsten Generation zu geben als durch eine Erbschaft, und so noch ein bisschen von dem retten, was ihnen von Rechts wegen gehört.
Der gleiche Typus atmet auch erleichtert auf, wenn die Steinmeier-Schulzens den Freiheitsdienst wegen der oben beschriebenen Hindernisse am Ende doch nicht einführen. Oder nur in einer ganz kleinen Variante. Immerhin schlug ein von der Bertelsmann-Stiftung zusammengecasteter Bürgerrat 2024 verpflichtende Seminare vor, in denen jeder und jede lernen soll, wie man sich vor Desinformation hütet. Schon jetzt bildet sich in Deutschland mindestens eine Vorform von Annexia heraus, etwa, wenn demnächst der Führerschein alle 15 Jahre erneuert werden muss. Unabhängig davon müssen alle Inhaber älterer Führerscheine die Papiere gegen einen neu entworfenen Ausweis umtauschen.
Demnächst soll auf Vorschlag des „Deutschen Instituts für Normung“ außerdem eine jährliche „Verkehrssicherheitsüberprüfung für Wohngebäude“ mit 250 Einzelprüfungen stattfinden. Irgendwas wackelt schließlich immer oder genügt einer frisch überarbeiteten Energieeffizienzrichtlinie nicht. Die Kosten haben die Hauseigentümer zu tragen, die sie ihrerseits natürlich an ihre Mieter weitergeben können. Wer außerdem noch als selbständiger Berge von Papierbelegen für den Fall sammelt, dass ein Finanzamtsmitarbeiter sie in Augenschein nehmen will, wer irgendetwas am Haus umbauen möchte – von Neubau ganz zu schweigen –, wer als Immobilieneigentümer vor einiger Zeit in seiner Steuererklärung Daten zusammentragen musste, über die der Staat ohnehin schon verfügt, der kann sich schon ein bisschen wie ein Insasse von Annexia fühlen, der immer hinter irgendeiner Frist und einem gestempelten Papier hinterherläuft. Insofern besteht längst eine Leichtversion der Dienstpflicht für alle möglichen Branchen des Staates.
Die Indienst- und Inpflichtnahme der Bürger durch eine Klasse, die sich mit dem Staat gleichsetzt, kennt keinen statischen Zustand. Sie weitet sich eigengesetzlich aus wie der Apparat selbst. In diesem Apparat und unter seinen Freunden in den Medien gilt es längst als ausgemacht, dass es sich bei dem argentinischen Präsidenten Javier Milei, der den Staat gerade mit der Kettensäge auf Normalmaß stutzt, um einen Zerstörer und Faschisten handelt.
Das, was die Lenker der EU und speziell des Staates in Deutschland anstreben, beschränkt sich aber nicht auf die Abwehr der Ideen Mileis. Vielmehr setzen sie ein spiegelbildliches Gegenprogramm durch, das die Kettensäge am Bürgerbewusstsein ansetzt. Das gilt es zu beschneiden, zu kupieren, zu zerschroten mit dem Ziel, dass die Normalpersonen in ihren Ecken kauern, die ihnen der Zugriffsstaat noch lässt. Dieser Zugriff erstreckt sich nach den neuesten Plänen auch auf die Wahlentscheidung, um zu verhindern, dass er irgendwann eine politische Kraft an die Macht bringt, die zumindest verspricht, ihn besser zu behandeln. In Deutschland soll demnächst eine zweimalige Verurteilung wegen des noch zu verschärfenden Volksverhetzungsparagrafen reichen, um jemanden von einer Kandidatur auszuschließen; in Frankreich genügt eine Allerweltsverurteilung, um eine politische Karriere zu beenden, falls man nicht gerade Christine Lagarde heißt.
Die Etikettierung Mileis als Faschist dient als Fingerzeig, dass sich dieses electoral engineering nicht nur gegen die bekannten Schwefelparteien richtet, sondern genauso jede neue Kraft treffen würde, die der alten Kaste gefährlich werden könnte. Dazu müsste sie noch nicht einmal mit der Kettensäge antreten. Heckenschere genügt schon.
Darauf läuft es in den kommenden Jahren hinaus: Entweder rotiert in einem Land die Kettensäge nach den Grundsätzen eines Milei oder nach denen der Schulze-Steinmeier-Kongregation. Entweder gegen den Zugriffsstaat, die große Raupe Nimmersatt, deren Endziel in irgendeiner Spielart von Annexia besteht. Oder die Säge liegt in den Händen der Annexiafraktion, die sich den Bürger zum Untertanen zurechtschnippelt und trotzdem nach jedem Durchgang noch etwas findet, um die Schneide erneut anzusetzen. Entweder das eine oder das andere Konzept setzt sich durch. Aber es gibt keine friedliche Koexistenz zwischen beiden. Und auch immer weniger Inseln, von denen aus sich dieser Kampf aus bequemer Entfernung beobachten lässt.
Die Frage lautet also für mehr oder weniger alle: An welchem Ende der Kettensäge wollen Sie stehen? Es gibt nur zwei.




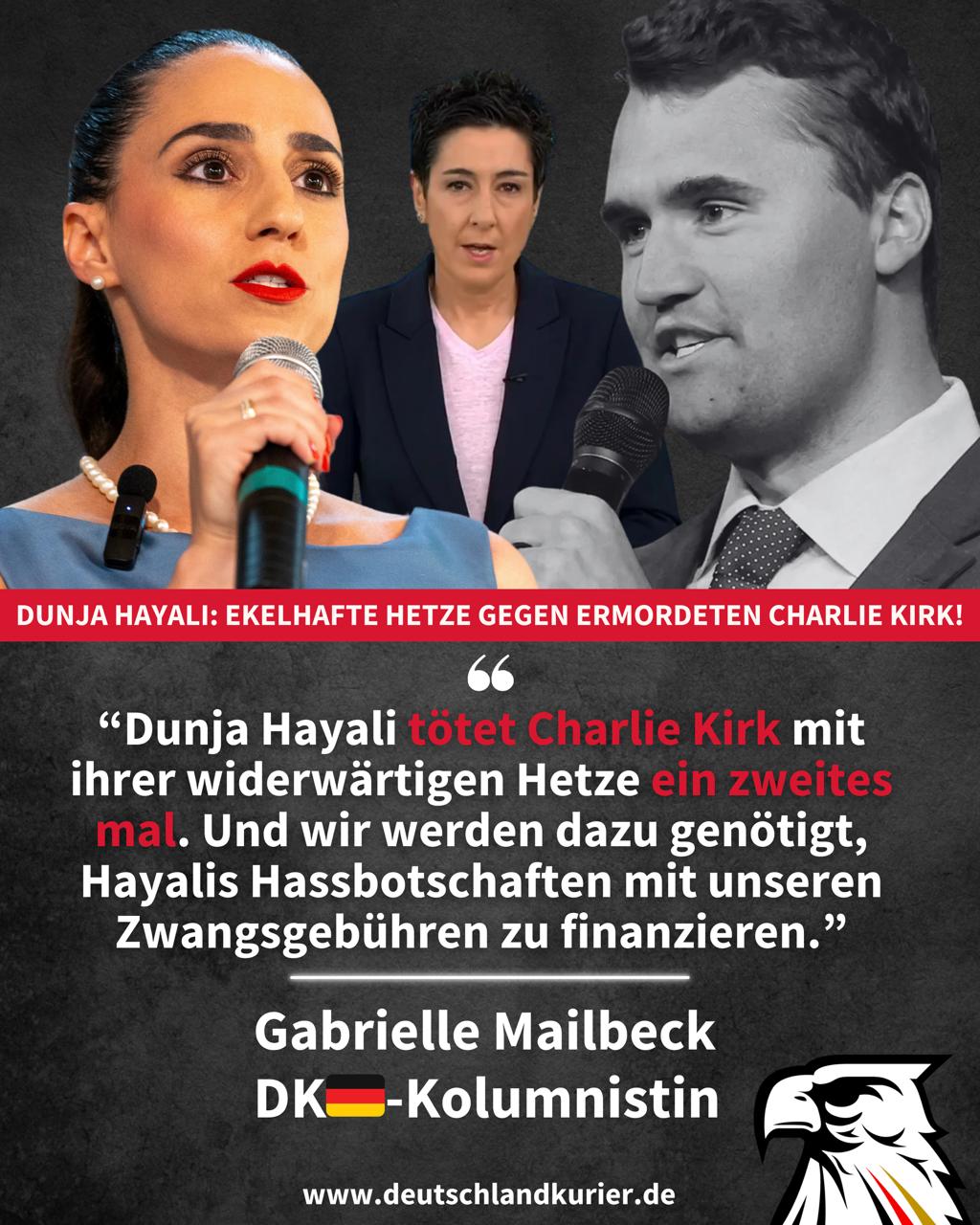




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























