
Mit dem Roman „2075 – Wenn Schönheit zum Verbrechen wird“ ist dem Soziologen und Historiker Rainer Zitelmann das anti-egalitäre Buch des Jahres gelungen. Nicht nur wird die grausame Logik aller Gleichheitsfanatiker aufgedeckt, sondern auch ein optimistischer Gegenentwurf mitgeliefert. Ein erfrischender Gegensatz zu den vielen einseitig düsteren Zukunftsvorhersagen im politischen Büchermarkt.
Kleiner Transparenzhinweis zu Beginn: Rainer Zitelmann hat mir das Buch wie schon andere Werke von ihm vor Erscheinen kostenlos zukommen lassen. Ich bin großer Fan vieler seiner Sachbücher, kaum ein deutscher Autor verteidigt die Marktwirtschaft mit einer solchen Faktendichte. Ich bin also genauso voreingenommen und fernab jeder Pseudo-Neutralität wie in sämtlichen anderen Kolumnen auch.
In dem Thriller geht es um eine radikale Gleichheitsbewegung, die sich „Movement for Optical Justice“ (MOVE) nennt. Im Jahr 2075 kämpft sie gegen ungleich verteilte Schönheit, insbesondere gegen „überschöne“ Frauen. Diese genössen unfaire Privilegien. Die fanatische Bewegung startet als kleine Randgruppe, die kaum ernst genommen wird, gewinnt schnell immer mehr Zustimmung und gelangt schließlich an die Macht. Höhere Steuern und allerhand Nachteile für „überschöne“ Frauen sind dabei nur der „moderate“ Anfang, schlussendlich werden Zwangsoperationen an zu attraktiven Frauen durchgeführt.
Anders als in so gut wie allen Romanen mit düsteren Zukunftsszenarien geschieht dies nicht in einer generell dystopischen Welt. Dafür hat Rainer Zitelmann zu viel Vertrauen in die Freiheit und den Fortschritt. Klassisch linke Zukunftsängste finden deshalb keinen Platz. Der Klimawandel ist dank der erfolgreichen Kernfusion kein Thema mehr. Anstelle von Massenverelendung und Überbevölkerung ist die Armut besiegt. Es gibt private Raumfahrt zum Mond und zum Mars. Ressourcenknappheit existiert nicht, stattdessen werden seltene Erden auf Asteroiden abgebaut. Auf dem Mars gibt es libertäre Privatstädte, nach Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises benannt. Sie garantieren Meinungs- und Vertragsfreiheit, ein Leben mit privaten Versicherungen und ohne staatlichen Zwang. Fast alle Krebsarten sind besiegt, zerstörte Augen lassen sich in den meisten Fällen komplett wiederherstellen und Wunden sind in Sekundenschnelle durch KI-Instrumente identifiziert und in Minutenschnelle behandelt. Wunderbar schmeckendes Fleisch aus dem Labor hat Tierleid überflüssig gemacht, die Gentechnik hat sich zum Wohl aller durchgesetzt.
„2075“ beschreibt die Wandlung von dieser Welt hin zur totalitären Gesellschaft. Erschreckend ist, dass Zitelmann gar nicht besonders kreativ sein muss, um sich Maßnahmen und Mechanismen auszudenken, die das ermöglichen. Er muss größtenteils nur auf den Instrumentenkasten der Gleichheitsfanatiker des Jahres 2025 zurückgreifen.
Fanatische Studenten, die andersdenkende Professoren unter Druck setzen. Lehrstühle für die „Erforschung der optischen Ungleichheit“, die ausschließlich an Freiheitseinschränkungen interessiert sind, und „Meldestellen für Verstöße gegen optische Gleichheit“. Bürgerliche, die dem Treiben aus Konformitätsdruck und Feigheit zu lange zusehen: „Ach, so eine Spinnerei hat nicht die geringste Chance sich durchzusetzen“ und ähnliche verharmlosende Sätze fallen von ihnen. Mobbing in der Schule, inklusive rückgratloser Lehrer mit vorauseilendem Gehorsam dem Staat gegenüber. Gesetze gegen „Fake News“ und Kontrolle der Sprache. So wird beispielsweise strafrechtlich verfolgt, wer die staatlich als „Optical Optimization Therapy“ propagierte Maßnahme wahrheitsgemäß als „Zwangsoperation“ bezeichnet. Quoten, die schöne Frauen benachteiligen, eine sich selbst weitestgehend gleichschaltende Medienlandschaft, rückgratlose, sich dem Zeitgeist ergebende Unternehmen und eine heuchlerische Politikerkaste, die Frauen verfolgt, die sie privat gerne um sich hat.
Bei der Beschreibung dieser Vorgänge kann Zitelmann sein stilistisch eher nüchternes Sachbuchautor-Wesen nicht gänzlich abstreifen. In keinem anderen Zukunftsroman dürften so viele Studien und so viele Fakten zu Gleichheit und Neid vorhanden sein. Das führt stellenweise zu einer etwas weniger dichten Atmosphäre, hat aber einen großen Vorteil. Jeder einzelne Schritt in Richtung einer totalitären Gesellschaft wird dadurch besser nachvollziehbar und erscheint absolut realistisch. Der dutzendfache Sachbuchautor weiß erkennbar genug über die Geschichte und die Psychologie des Totalitären, dass er mit chirurgischer Präzision die immer gleichen Mechanismen einer jeden totalitären Bewegung offen legt. Die eigentlich undenkbare Idee, zu hübsche Jugendliche hässlicher zu operieren, wird aufgrund dieses Fundaments im Verlauf der Geschichte immer denkbarer.
Autor Rainer Zitelmann bei einem Vortrag in Sao Paulo
Der Kampf gegen die „Überschönen“ ist dabei nur ein austauschbares Beispiel. Es könnte genauso gut um Hochintelligente, Reiche, Ungeimpfte, erfolgreiche Bauern oder jede andere gesellschaftliche Minderheit gehen, was die Brücke von der Zukunftsfiktion in die Gegenwart schlägt.
In „2075“ geht es aber nicht nur um eine totalitäre Bewegung und ihren Weg zur Macht, sondern auch um die Einzelpersonen, die sich dem Wahnsinn entgegenstellen. Da wäre zum Beispiel Riven, ein Journalist, der über die Gefährlichkeit, die Lügen und die Korruptheit der MOVE-Fanatiker recherchiert. Der größte Held ist aber eine Heldin, nämlich Alexa. Sie wandelt sich von einer klugen, aber unsicheren und intellektuell schwankenden Studentin zu einer entschlossenen Widerstandskämpferin und tapferen Beschützerin ihrer kleinen, von den Zwangsoperationen bedrohten Schwester. Mit ihr hat Rainer Zitelmann übrigens wieder einmal bewiesen, dass die stärksten und beeindruckendsten weiblichen Charaktere in Film und Literatur gerade nicht von blauhaarigen Feministinnen geschrieben werden.
Auf dem Buchrücken sieht sich der Roman selbst in einer Tradition mit „1984“ und „Brave New World“, er unterscheidet sich allerdings positiv von ihnen. Er benennt klarer und verständlicher die freiheitsfeindliche Gefahr und er liefert das Gegenmodell gleich mit. Freiheitlich denkende Menschen, die dank libertärer Unterstützung im Rücken und dem gigantischen Reichweitenpotential im Internet die Möglichkeit haben, sich zu wehren.
Rainer Zitelmann denkt in „2075“ die Logik aller Gleichheitsfanatiker bis zum schrecklichen Ende. Und zerstört somit die verfehlte Idee der Gleichmacherei endgültig. Er beweist mit einer spannenden Geschichte, dass Neid und Ungleichbehandlung mit dem Ziel der uniformen Gesellschaft immer in den Abgrund führen.
Die schönste Botschaft der Geschichte ist wohl, dass einzelne Menschen den Totalitarismus besiegen oder wenigstens bekämpfen können, wenn sie trotz aller Gefahren den Mut zum Widerspruch besitzen. Zugleich ist in dieser Botschaft die größte Warnung versteckt: Immer dann, wenn freiheitsliebende Bürger nicht gegen radikale Kollektivisten aufstehen, werden sie ihre Freiheit verlieren. Oder wie der Psychologe Jordan Peterson es mal auf den Punkt brachte: „Evil arises when good men hold their tongue.“
Der Dualismus aus einer totalitären Bewegung und einer immer größer werdenden Gegenbewegung macht das Buch so spannend und empfehlenswert. Es ist ein Werk der Warnung und der Hoffnung zugleich. Und es ist der in Deutschland unübliche Versuch, die Ideen der Freiheit mithilfe eines fiktionalen Romans zu verbreiten. Im letzten Jahrhundert gelang das der Philosophin Ayn Rand in den USA millionenfach, mit Einflüssen bis in die Gegenwart.
Man kann „2075“ nur einen ähnlichen Erfolg wünschen. Der ist leider auch nötig, in einer Zeit, in der die Mauerschützenpartei gerade bei jungen Menschen als cool gilt, Stimmung gegen Reiche und Menschen mit zu großen Wohnungen oder Häusern gemacht wird und die produktivsten Steuerzahler des Landes unter dem größten Generalverdacht stehen.
Mehr NIUS: Zwischen Verantwortung und Ostalgie: Es ist Zeit für ein Ende der Sozialismus-Romantik




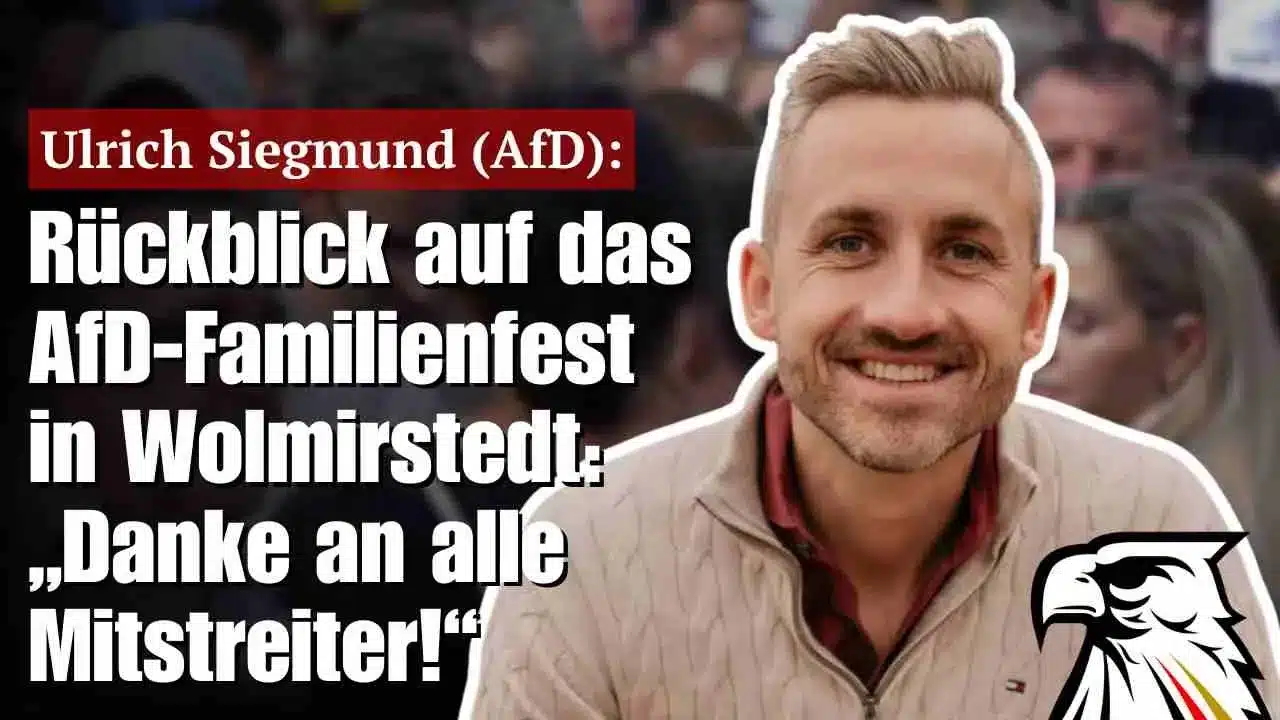





 UKRAINE-KRIEG: "Ausländische Soldaten wären legitimes Ziel!" Jetzt droht Putin Europa direkt! STREAM
UKRAINE-KRIEG: "Ausländische Soldaten wären legitimes Ziel!" Jetzt droht Putin Europa direkt! STREAM






























