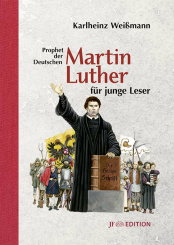Es passiert nicht allzu oft, dass sich ein ganzes Rudel reisender Regierungschefs im Weißen Haus die Klinke in die Hand gibt. Nach dem viel beachteten Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska und der sich daran anschließenden, etwas weniger beachteten Videokonferenz der Europäer waren die Erwartungen entsprechend hoch: Kann ein wie auch immer geartetes Abkommen einen Frieden in der Ukraine erreichen, einen zeitweiligen, wenigstens? Welche Szenarien sind denkbar und realistisch, und wie können Verhandlungen in einer Atmosphäre voller strategischer Ambiguität gelingen?
Zunächst einmal lässt sich festhalten, dass das gestrige Treffen in Washington nicht ohne die Begegnung des russischen und amerikanischen Präsidenten am Freitag zuvor möglich gewesen wäre. Der in den deutschen Medien zum Standardprogramm gehörenden Generalkritik an Donald Trump zum Trotz wächst auch hierzulande die Einsicht, dass die Zeit für Gespräche reif zu sein scheint. Sicherlich: Eine derartige Begegnung zwischen Russland und den USA war eine diplomatische Aufwertung Wladimir Putins, der ausgerollte Teppich etwas zu rot für unseren Geschmack. Doch auf der Habenseite lässt sich verbuchen, dass der Kreml, dass eigentlich alle Beteiligten sich unter dem mitunter diffusen Druck des US-Präsidenten ein wenig zu bewegen scheinen.
Wladimir Putin und Donald Trump bei einer Zeremonie auf dem Flughafen vor ihrem Treffen auf der Joint Base Elmendorf-Richardson.
Wie es NIUS-Kollege Markus Brandstetter in seinem Artikel vom Samstag treffend analysierte, hat Trump damit insgesamt den richtigen Weg eingeschlagen. Der isolationistischen Logik von „America First“ entgegen, hat das Weiße Haus so eine Situation herbeigeführt, in der Russen, Ukrainer und Europäer mit ihm über Krieg und Frieden sprechen wollen – und sich durchaus auch nach ihm richten müssen. Dieser Umstand ist ein wichtiger erster Baustein für alles, was nun passiert.
Werfen wir zuerst einen Blick auf die Interessen Amerikas. Von regelrechten Unkenrufen bis zu sachlich begründeten Bedenken reicht die Bandbreite an Kommentaren, die die europäische Politik zur Ukraine-Politik der US-Republikaner vorhält. Es fallen von liberaler Seite Stichworte wie „Verrat“ und „Sudetenland“, als historische Analogie zum Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Andere wiederum glauben, im Ukraine-Konflikt einen Stellvertreterkrieg zu erkennen, der im Interesse der USA mit Russland geführt werden soll. Beide Interpretationen entspringen einer ideologischen, keiner strategischen Denkweise: Würde Donald Trump „die Ukraine unter den Bus werfen“ wollen, so hielte ihn im Grunde nichts davon ab, die Waffenlieferungen ganz einfach einzustellen und die Sicherheitspolitik auf dem europäischen Kontinent fortan den Eingeborenen zu überlassen.
Umgekehrt wäre es für das durch zwei gewaltige Ozeane von Russland getrennte und immer noch bis an die Zähne bewaffnete Amerika ein Leichtes, die Ukraine mit den modernsten und tödlichsten Waffen solange im Kampf zu halten, wie es das für sinnvoll erachtet. Und doch bemüht die US-Regierung eine andere Strategie: Sie möchte ihre sicherheitspolitische Hegemonie global, insbesondere aber in Europa nicht völlig aufgeben, dabei aber die Kosten senken; und sie will einen Konflikt an zu vielen Fronten vermeiden, um für eine geopolitische Auseinandersetzung im Pazifik gewappnet zu sein. Dazu ist eine Art kalkulierbare Neutralität Russlands sowie ein lediglich punktuelles Engagement im Nahen Osten die Strategie der Wahl.
Der Streit um die außenpolitische Doktrin der US-Demokraten und -Republikaner kann so beschrieben werden: Während die Demokraten der Auffassung sind, die regelbasierte Weltordnung mit den USA als Garant und Profiteur könne aufrechterhalten werden, wenn die Europäer einige der Lasten dieser Ordnung selber schultern, denken die MAGA-Republikaner, dass die Widersacher eines obsolet gewordenen globalen Systems inzwischen so mächtig und zahlreich geworden sind, dass sie ausschließlich in bilateralen Machtbeziehungen und im Sinne einer klassischen Geopolitik überhaupt zu steuern sind.
MAGA-Republikaner sehen Gegner des alten Systems nur noch durch klassische Geopolitik beherrschbar.
Paradoxerweise haben die europäischen Staaten den Ansatz der US-Liberalen durch die eigene Zurückhaltung scheitern lassen und kritisieren nun vehement den unvermeidlichen Strategiewechsel der USA. Dieser Umstand ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass Amerika kein Interesse daran haben kann, dass russische Expansionen nach West- und Mitteleuropa sich halbwegs erfolgreich ereignen: Niemand in Washington möchte eine Situation riskieren, in der die Beistandspflicht des großen Bruders sich als Luftnummer erweist – das würde die US-Hegemonie unterlaufen – doch sie soll auch nicht herausgefordert werden, denn das bedeutet eine unwillkommene Ablenkung.
Dem steht auf gewisse Weise die Haltung der Europäer entgegen, wenn man überhaupt von einer gemeinsamen Haltung der zahlreichen Akteure sprechen will.
Während Emmanuel Macron Frankreich als den geopolitischen Player innerhalb der EU etablieren will – prompt forderte er gestern eine Viererrunde unter eigener Beteiligung –, verfolgen die hiesigen Staaten vornehmlich die Strategie, Russland als militärische Bedrohung einzudämmen und dafür eher eine gestaltbare Neutralität zu China anzustreben. Ihr Interesse liegt darin, die USA und die eigene Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das Betriebssystem der internationalen Beziehungen, auf dessen Grundlage gerade die Bundesrepublik operiert, noch zu retten ist – allerdings fordern sie, dass die USA die entscheidenden Komponenten dafür stellen. Dies entspringt einer Mischung aus Unwillen und Unfähigkeit, entscheidende Fähigkeiten der Amerikaner, aber auch deren nüchterne Doktrin für sich selbst zu entdecken.
Emmanuel Macron versucht, Frankreich als führenden geopolitischen Akteur in der EU zu positionieren.
Was hindert Deutschland, Frankreich oder Großbritannien daran, die Ukraine auf eigene Faust zu unterstützen, wenn das doch der richtige Weg ist? Ihnen fehlt es schlicht und ergreifend an den Mitteln zu einer solchen Politik, weswegen sie die Nähe zu den USA suchen müssen, wenn sie ihr strategisches Ziel halbwegs erreichen wollen. Die militärische Schwäche und der Verlust der kulturellen Deutungshoheit der Westeuropäer trägt auch dazu bei, dass die Länder Mitteleuropas die Brüsseler Kohäsion unterlaufen, indem sie wahlweise auf bilaterale Beziehungen zu den USA setzen oder auf eigene Faust die Verständigung mit Russland suchen.
Zusammengenommen führt dies zu der vulnerablen Ausgangslage, dass sich im Grunde alle einig sind, die Ukraine bei ihrer Verteidigung unterstützen zu wollen, jedoch niemand in der Lage und Willens ist, dafür allzu viel zu riskieren. Lediglich der britische Premierminister ist bereit, Teile seiner zunehmend schrumpfenden Armee in der Ukraine zu stationieren, um deren Sicherheit im Rahmen eines Abkommens zu gewährleisten.
Nur Großbritannien will Truppen zur Sicherung der Ukraine entsenden.
Das soll uns zu einer Analyse der russischen Position führen.
Die Bewertung der russischen Interessen gestaltet sich deshalb schwierig, da unklar ist, welche Absichten der Kreml letztlich verfolgt. Selbst eindeutige Aussagen Moskaus kann man mit gutem Gewissen als Desinformation interpretieren, genau so lassen sich – in aller geopolitischer Nüchternheit – nachvollziehbare Anliegen Russlands identifizieren.
Mit dem Alaska-Treffen hat sich Putin erstmalig in die Karten schauen lassen, was zumindest das betrifft, was man als Etappenziel begreifen kann: Die Kontrolle über die Krim und die Ostukraine im Gegenzug für ein Einstellen der Kampfhandlungen. Wir können schlicht und ergreifend nicht abschließend wissen, ob eine russische Ausdehnung in diese Gebiete und eine irgendwie geartete Neutralität der Ukraine die russischen Sicherheitsinteressen befriedigt oder ob diese im Kreml die Hoffnung schürt, dass der Westen auch im Baltikum verletzlich reagieren wird. Die vermutlich klügste Strategie wird sein, sich auf das Worst-Case-Szenario einzustellen und die NATO-Ostflanke zu befestigen, um aus einer Position der Stärke und Abschreckung heraus Russland zur Neutralität zu bewegen. Dazu kann es nötig sein, einen Waffenstillstand in der Ukraine zu akzeptieren.
Am 19. August fand das Alaska-Treffen von Putin und Trump statt.
Diese Überlegung führt uns abschließend in das angegriffene Land selbst und die derzeitige Lage auf dem Schlachtfeld.
Der schleichende, inkrementelle Vormarsch Russlands und das anhaltende Leid der Zivilbevölkerung und eine sich aufbauende Wehrpflichtkrise sprechen gegen eine Fortführung der Kampfhandlungen. Allen Beobachtern ist inzwischen klar, dass die von Russland de facto kontrollierten Gebiete ohne eine nicht zu leistende, vielfache Erhöhung der Kriegsanstrengungen nicht zu leisten sein wird. Zu einer mehr oder weniger direkten Beteiligung sind weder Europäer noch Amerikaner bereit. Gleichzeitig ist der russische Vormarsch derart langwierig und kostspielig, dass auch die Gegenseite zu der Einsicht gelangen muss, dass zumindest ein Waffenstillstand in ihrem Interesse liegt. Kann sie ihr Momentum als Hebel nutzen, um die Ukraine zu zeitweiligen Zugeständnissen zu bewegen, so gewinnt sie in jedem Fall eine Sicherung ihrer bisherigen militärischen Erfolge. Dies führt zu der einmal von Wolfgang Ischinger beschriebenen Lage, in der beide Seiten die Einstellung der Kampfhandlungen als Vorteil gegenüber deren Fortsetzung begreifen können. Die Voraussetzungen für einen „Deal“ sind also gegeben, ob er zustande kommt, hängt nun von einigen Faktoren ab.
Hier drohen einige nicht aufzulösende Dilemmata, ein Schweigen der Waffen noch unwahrscheinlich werden zu lassen. Zwar ließe sich argumentieren, dass im Grunde beide Konfliktparteien sich behauptet haben: Putin könnte seine russischsprachige Bevölkerung integrieren und sich den Zugang zum Schwarzen Meer sichern; er dürfte sich die Verhinderung einer aus seiner Sicht erfolgten Expansion des Westens nach Osteuropa auf die Fahnen schreiben. Den Ukrainern wäre es ihrerseits gelungen, die Eigenstaatlichkeit gegen alle Widrigkeiten zu erhalten und durch ihr Opfer die Westbindung zumindest ideell zu stärken. Doch es erwartet uns ein gefährlicher Widerspruch in der strategischen Logik.
Putin könnte seine russischsprachige Bevölkerung integrieren und sich den Zugang zum Schwarzen Meer sichern, während er eine Ausweitung des Westens nach Osteuropa verhindern will.
Aus den Minsk-Verhandlungen hat die Ukraine gelernt, dass ein Waffenstillstand zu ihrem Nachteil ist, wenn es an formalen Vereinbarungen über Territorien und vor allem über eine Absicherung mangelt. Putin weiß das, weswegen Russland auf eine formale Anerkennung („de jure“, eben nicht „de facto“) seiner Ansprüche pocht. Selenskyj und seine europäischen Verbündeten bestehen deshalb darauf, dass zunächst die Frage von Garantien geklärt wird, bevor die militärische Gegenwehr ein Ende findet. Aus Moskauer Sicht allerdings sind alle denkbaren Sicherheitsgarantien für Kiew, die über bloße Zusagen auf dem Papier hinausgehen, funktional gleichbedeutend mit einer NATO-Mitgliedschaft „light“ – also eine faktische, wenn auch nicht formelle Einbindung der Ukraine in die westliche Militärmacht.
Das Dilemma: Gibt der Westen Garantien, die mit der Stationierung von Truppen oder der Aufrüstung der Ukraine zu tun haben, besteht für Russland kein strategischer Anlass, seinen teuren, aber letztlich fortschreitenden Feldzug aufzugeben, da so eines der bedeutsamsten strategischen Ziele nicht erreicht würde. Gibt der Westen jedoch keine Garantien ab, die die Ukraine in die Lage versetzen, sich bei einem erneuten Bruch des Waffenstillstandes erfolgreich zu verteidigen, so gibt es für sie zumindest keinen strategischen Grund, ihre Gegenwehr einzustellen.
Deutlich gemacht hat Europa, allen voran der französische Präsident mit seiner hilflosen Forderung nach einer eigenen Führungsrolle, dass es trotz der hochtrabend formulierten Ansprüche in diesem Krieg nicht in der Lage ist, den gewünschten Ausgang herbeizuführen. Die derzeit vielversprechendste Politik dürfte sein, den ukrainischen und den russischen Präsidenten an einen Tisch zu kriegen – ein kleines, aber nicht zu verachtendes Etappenziel auf der Agenda des US-Präsidenten und der derzeit einzig denkbare Durchbruch in einem tödlichen Ringen, das uns noch lange begleiten wird.
Lesen Sie auch:Die Europäer verstehen die kalte Sprache der Macht nicht






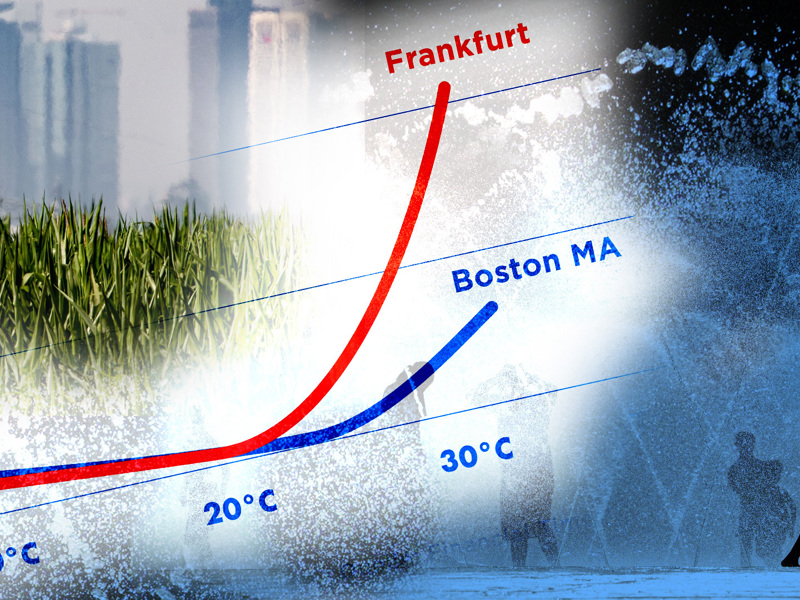

 WASHINGTON: Zeichen des Zusammenhalts – Wie wahrscheinlich ist Frieden in der Ukraine?
WASHINGTON: Zeichen des Zusammenhalts – Wie wahrscheinlich ist Frieden in der Ukraine?