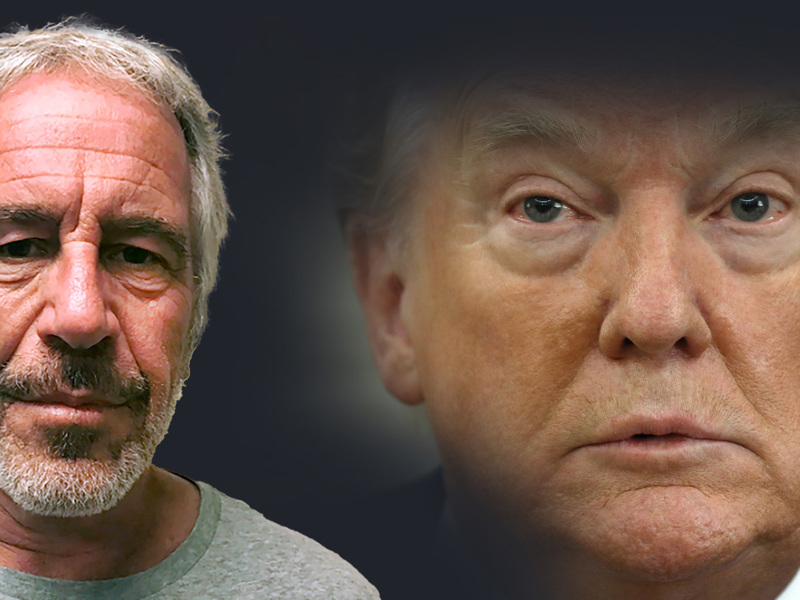
Pam Bondi kündigte eine Kundenliste von Jeffrey Epstein an – dann verschwand sie. Die US-Regierung behauptet inzwischen, eine solche Liste habe nie existiert. Trump schweigt. Deutsche Medien sprechen von einer „Verschwörungsfalle“, doch die zentrale Frage bleibt: Was lag wirklich auf dem Schreibtisch der Justizministerin?
Es war der 27. Februar 2025, als US-Justizministerin Pam Bondi eine Bombe platzen ließ, die es mittlerweile nicht mehr geben soll. „It’s sitting on my desk right now to review — that’s been a directive by President Trump“, sagte sie in einem Fernsehinterview mit Fox News. Gemeint war ausdrücklich die sogenannte „Client List“ von Jeffrey Epstein – also eine Liste mutmaßlicher Kontakte und Freier –, die Bondi zufolge physisch vorlag. Weniger als ein halbes Jahr später heißt es aus dem Justizministerium und dem FBI – per Pressemitteilung: Eine solche Liste existiere nicht. Nach einer „systematischen Überprüfung“ sei man zu dem Schluss gekommen, es gebe keine belastbare Epstein-Kundenliste – und auch keine glaubwürdigen Hinweise darauf, dass Epstein prominente Personen erpresst habe. Eine Untersuchung gegen nicht angeklagte Dritte sei daher nicht gerechtfertigt.
Für öffentlich-rechtliche Medien wie das ZDF war die Sache ohnehin von Anfang an eine „Verschwörungsfalle“, in der Trump nun selbst sitze – so die jüngste Deutung bei ZDF heute. Trump habe „Gerüchte angefacht“, die ihn nun selbst einholen. Solche Schlagzeilen sind erwartbar, sagen aber wenig. Interessanter ist die eigentliche Frage: Wenn alles nur Verschwörungstheorie war – also viel Lärm um nichts –, was lag dann auf Pam Bondis Schreibtisch? Inzwischen will die Justizministerin Fragen zur Causa nicht mehr beantworten, wie sie vor zwei Tagen deutlich machte:
Zum Hintergrund: Jeffrey Epstein war ein verurteilter Sexualstraftäter, dem über Jahrzehnte der systematische Missbrauch minderjähriger Mädchen vorgeworfen wurde, die Jüngsten vierzehn Jahre alt. Im Jahr 2008 bekannte sich Jeffrey Epstein im Rahmen eines sogenannten Plea Deals schuldig – unter anderem wegen Anstiftung zur Prostitution Minderjähriger sowie wegen weiterer Prostitutionstatbestände. Das Urteil lautete auf 18 Monate Gefängnis, von denen Epstein lediglich 13 Monate verbüßte – und selbst während dieser Zeit profitierte er von einer extremen Sonderregelung: Er durfte an sechs Tagen pro Woche für jeweils zwölf Stunden das Gefängnis verlassen, um zu „arbeiten“. Zudem musste er sich als Sexualstraftäter registrieren lassen. Es gibt keine legal zugänglichen Fotos der minderjährigen Opfer, da diese aus Opferschutzgründen der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden. Eine Ausnahme könnte dieses Bild darstellen:
Virginia Roberts Giuffre hält ein Foto von sich als Teenager in der Hand. Es soll einer Zeit entstammen, von der sie sagt, sie sei unter anderem von Jeffrey Epstein missbraucht worden
Es gibt allerdings Fotos, die die amerikanische Regierung öffentlich gemacht hat und Epstein mit Mädchen oder Frauen zeigen, bei denen nicht klar ist, ob sie minder- oder volljährig sind.
Ein regierungsoffiziell herausgegebenes Foto, das Epstein und weibliche Begleitung zeigt.
Obwohl es in beiden Fällen im Kern um sexuellen Missbrauch minderjähriger Mädchen ging, unterscheidet sich der 2008er- und der 2019er-Komplex in Dimension und Schwere doch erheblich. 2008 wurde Epstein in Florida auf Staatsebene lediglich wegen Anstiftung zur Prostitution Minderjähriger verurteilt – im Rahmen besagten und stark kritisierten Plea Deals, der ihm eine milde Haftstrafe mit täglichem Freigang einbrachte und viele schwerwiegendere Vorwürfe unter den Tisch fallen ließ. Die Opfer wurden nicht einmal angehört.
Ganz anders 2019: Hier wurde Epstein von Bundesbehörden in New York wegen Sexhandels mit Minderjährigen und Verschwörung zur sexuellen Ausbeutung angeklagt – mit deutlich härterer juristischer Stoßrichtung, weitreichenderer Beweislage und dem Ziel, sein mutmaßliches Missbrauchsnetzwerk umfassend aufzurollen. Es war der erste ernsthafte Versuch, Epstein für das volle Ausmaß seiner Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Zu einer Verurteilung kam es jedoch nicht mehr: Epstein starb kurz nach seiner Festnahme in Untersuchungshaft – offiziell durch Suizid.
Epstein Island – den Gerüchten zufolge sollen hier auch Prominente mit illegalen Dingen in Berührung gekommen sein.
Doch Zweifel bleiben. Und mit seinem Tod verschwindet auch einer der wenigen Menschen, die womöglich hätten sagen können, was es mit der ominösen „Kundenliste“ auf sich hatte, die heute das Zentrum so vieler Spekulationen bildet. Man vermutet, dass Epstein, befehligt aus mächtigen Kreisen, umgebracht worden sein könnte, um ihn daran zu hindern, zu reden. Der frühe Tod ist erkenntnistheoretisch ein Problem – denn die ausbleibende Verurteilung verwässert die Faktengrundlage und nährt unausweichlich den Hang der Öffentlichkeit zu Spekulationen.
Mit der „Epstein-Liste“ werden Namen prominenter Mitwisser oder gar Mittäter assoziiert – darunter Politiker, Unternehmer, Royals, Schauspieler. Gemeint sind damit Kontaktlisten, Flugprotokolle, Tagebuchnotizen und interne Dokumente, die Epstein mit globalen Eliten in Verbindung bringen. Viele dieser Namen tauchten in Gerichtsunterlagen auf – wurden jedoch geschwärzt oder unter Verschluss gehalten. Als Donald Trump 2024 im Wahlkampf versprach, die Epstein-Akten freizugeben – „no problem“, sagte er –, wirkte das wie ein Tabubruch: eine Kampfansage an das Establishment, gegen das seine Bewegung seit Jahren antritt.
Seine Justizministerin Pam Bondi stellte sich hinter ihn und kündigte an, eine Veröffentlichung stehe unmittelbar bevor. Inzwischen sind ausgerechnet Trump und Medien wie CNN, die sich sonst unversöhnlich gegenüberstehen, in dieser Frage auf einer Linie: Es gebe keine belastbare Kundenliste.
Unter enttäuschten Trump-Anhängern kursieren daher nun neue Mutmaßungen. In einschlägigen Foren und konservativen Podcasts wird vermutet, Trump habe die Liste nicht veröffentlicht, weil er vom sogenannten „Deep State“ unter Druck gesetzt werde. Teils ist gar von konkreten Drohungen gegen ihn oder seine Familie die Rede – eine These, die in der MAGA-Bewegung zunehmend an Popularität gewinnt, obwohl sie bislang ohne belastbare Belege bleibt. Für viele ist das Schweigen zur Liste inzwischen ein Symbol für die Macht jenes Apparats, gegen den Trump einst angetreten war.
Die Frage aber bleibt – politisch wie journalistisch: Was lag auf dem Schreibtisch der Justizministerin? Ob diese Frage noch beantwortet wird, bleibt abzuwarten. Die amerikanische Öffentlichkeit dürfte sich mit den jetzigen Antworten nicht zufriedengeben.
Auch bei NIUS: 100 Tage Trump: Eine Bilanz über Zoll-Krieg, Massenabschiebungen, Kampf gegen Wokeness und Musks Kettensäge


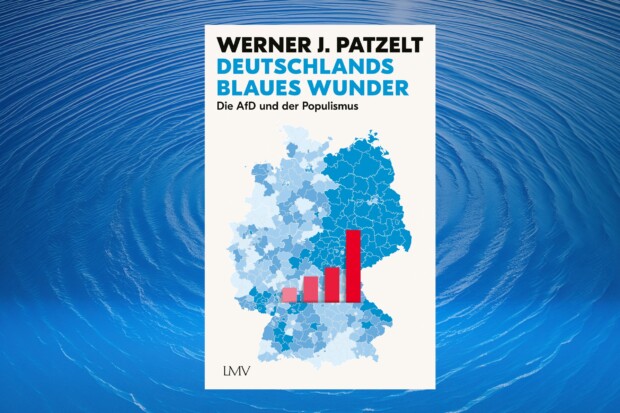





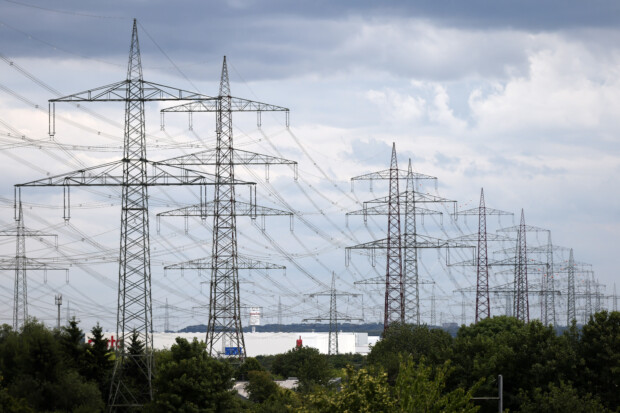

 UKRAINE-KRIEG: "Ausländische Soldaten wären legitimes Ziel!" Jetzt droht Putin Europa direkt! STREAM
UKRAINE-KRIEG: "Ausländische Soldaten wären legitimes Ziel!" Jetzt droht Putin Europa direkt! STREAM






























