
Dow möchte seine Produktionskapazitäten in Deutschland zurückfahren. Chemische Anlagen sollen teilweise geschlossen werden. Vor Einschnitten stehen u.a. das Werk in Böhlen südlich von Leipzig und der Standort in Schkopau.
Das Werk in Böhlen, das eine zentrale chemische Großanlage beherbergt, gilt als „Herz“ der Verbundproduktion von Dow in der Region. Chemiemanager fürchten, dass durch das Aus von Anlagen vor Ort weitere Firmen in der Lieferkette und damit unzählige Arbeitsplätze betroffen sein könnten. Auch das Werk in Schkopau ist von zentraler Wichtigkeit für das Unternehmen. Bislang erfolgte dort die Basischemie-Produktion von Chlor-Alkali und Vinyl.
Wie der Konzern am Montag mitteilte, sind an den beiden Standorten insgesamt 550 Arbeitsplätze betroffen. Dow unterhält nach eigenen Angaben deutschlandweit 13 Standorte mit rund 3.400 Mitarbeitern. Der US-Chemiegigant begründet die Einschnitte vor allem mit den strukturellen Herausforderungen des deutschen Standorts. Besonders belastend für das Unternehmen sind die hohen Energiekosten.
Deutschland zählt zu den Ländern mit den höchsten Energiepreisen weltweit. Der Industriestrompreis befindet sich seit Jahren im Aufwärtstrend. Laut BDEW lag der durchschnittliche Strompreis für Industriestrom 2024 bereits bei 16,99 ct/kWh (inkl. Stromsteuer, Abgaben und Umlagen, Stand: Dezember 2024). Zum Vergleich: Im Jahr 2000 lag dieser noch bei durchschnittlich 6,05 ct/kWh.
Besonders gravierend war die im Jahr 2011 – nach der Fukushima-Katastrophe – getroffene Entscheidung, der Kernkraft den Rücken zu kehren. Die CDU beschloss, den vollständigen Ausstieg aus der Kernenergie binnen einer Dekade umzusetzen.
Durch den Komplettausstieg wurde die Energiebranche in eine gefährliche Abhängigkeit von erneuerbaren Energien gestürzt, vor allem da die Kapazitäten von Kohle-, Gas- und Ölkraftwerken im Rahmen des Klimakurses ebenfalls zunehmend stillgelegt, bzw. zurückgefahren wurden.
Der Strommix in Deutschland beruht mittlerweile zu etwa 60 Prozent auf erneuerbaren Energien wie Solar- und Windkraft. Problematisch ist das, da bei ausbleibendem Sonnenschein oder Windflaute die Produktionskapazität dieser Energieträger nahe Null fällt. Dann entstehen Engpässe in der Stromversorgung. Da die Nachfrage, vor allem aus energieintensiven Industriebranchen wie etwa der Chemie- oder der Automobilindustrie, aber weiter hoch bleibt, entsteht ein Nachfrageüberhang. Simpel ausgedrückt bedeutet das, dass die Energiepreise stark ansteigen und folglich auch die Betriebskosten für Unternehmen wie Dow exorbitant ansteigen.
Kumuliert können Steuern und Abgaben bis zu 60 Prozent des Strompreises ausmachen. Eine Farce staatlicher Übergriffigkeit, wenn man betrachtet, dass es in vielen Ländern der Welt nicht einmal eine Stromsteuer gibt. Die Ungerechtigkeit, aber auch die Dummheit, mit der die politische Obrigkeit die eigene Wirtschaft abwürgt, ist bemerkenswert und lächerlich zugleich.
Neben den hohen Stromkosten kommen erschwerend die hohen Gaskosten hinzu. Besonders Chemiekonzerne wie Dow leiden darunter, da sie stark von dem Rohstoff abhängig sind. Gas ist für die Branche sowohl ein wichtiger Energieträger als auch ein Vorprodukt in vielen chemischen Produktionsprozessen.
Wie auch beim Strom setzt sich ein großer Anteil des Gaspreises aus Netzentgelten, Steuern und Abgaben zusammen.
Des Weiteren hatten beim Gas die handelspolitischen Entscheidungen der letzten Jahre einen gravierenden Effekt. Im Zuge der Eskalation des Ukraine-Konflikts hatte die Bundesregierung entschieden, russische Gaslieferungen einzustellen. Erdgas aus Russland hatte bis zu diesem Zeitpunkt rund 55 Prozent der deutschen Gasversorgung ausgemacht. Über Jahre hinweg lieferte Russland zuverlässig und kostengünstig. Diese Handelsbeziehung wurde schlagartig unterbrochen.
Um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, begann das Wirtschaftsministerium, damals noch unter Robert Habeck, die Gasversorgung auf sogenanntes Flüssigerdgas (LNG) umzupolen. Geliefert wird es vor allem aus den USA. Flüssigerdgas ist um einiges teurer als klassisches Erdgas. Denn LNG muss nicht nur gefördert, sondern auch verflüssigt, über weite Strecken mit Spezialschiffen transportiert und anschließend wieder regasifiziert werden, bevor es ins Netz eingespeist werden kann. Dieser aufwendige Prozess verursacht immense Zusatzkosten. Im ersten Quartal 2025 lag der durchschnittliche Preis für US-LNG bei etwa 1,08 Euro pro Kubikmeter, während russisches Pipelinegas nur rund 0,32 Euro pro Kubikmeter kostete. Durch die Umstellung auf LNG hat die Ampelregierung die Gaskosten für die deutsche Industrie demnach verdreifacht.
Hinzu kommt die EU-weite CO2-Steuer, die auf fossile Energien erhoben wird. Die Abgabe verteuert die Nutzung von Gas zusätzlich. Die deutsche Industrie unterliegt dem europäischen Emissionshandel (EU-ETS), der an sogenannte Emissionszertifikate geknüpft ist. Konkret legt das EU-ETS eine Obergrenze (Cap) für die gesamte Menge an CO2-Emissionen fest, die Unternehmen ausstoßen dürfen. Unternehmen brauchen für jede Tonne CO2 ein Zertifikat. Wenn sie weniger ausstoßen, können sie ihre überschüssigen Zertifikate verkaufen, wenn sie mehr ausstoßen, müssen sie welche dazukaufen. Dadurch entsteht ein Markt, auf dem sich durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage ein Preis bildet. Die Zertifikatspreise werden durch die EU zwar nicht festgelegt, dafür verknappt die Kommission jedoch die Menge an Emissionsrechten im Umlauf immer weiter.
Dow-Chef Jim Fitterling kommentierte die aktuelle Situation in einer Stellungnahme wie folgt: „Unsere Branche sieht sich in Europa nach wie vor mit schwierigen Marktdynamiken und einem anhaltend herausfordernden Kosten- und Nachfrageumfeld konfrontiert“. Die Schließung der deutschen Anlagen diene vor allem dazu, das Handelsrisiko zu verringern und zudem teure, energieintensive Anlagen aus dem Portfolio zu entfernen.
Von einem „Kampf“ kann jedoch kaum die Rede sein. Fakt ist nämlich, dass keine neue Energiepolitik kommt. Der Koalitionsvertrag sieht keine Bekenntnis zur Technologieoffenheit in der Energieerzeugung vor. Auch das Prinzip der übergriffigen CO2-Besteuerung wird rigoros weitergeführt. Zum aktuellen Zeitpunkt sieht alles danach aus, als würde der ideologisch motivierte Klimakurs, der von der Merkel-CDU und der Ampelkoalition gefahren wurde, unter Schwarz-Rot konsequent fortgesetzt.
Der Landrat des Saalekreises, Hartmut Handschak (parteilos), erwähnte im Gespräch mit dem MDR Sachsen-Anhalt, die Entscheidung Dows sei bedauerlich. Er verstehe aber, wenn ein Unternehmen aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so handele. Handschak äußerte zudem die Hoffnung, dass sich der Konzern auch weiter in Schkopau engagiert und ein wichtiger Teil des Chemiestandortes bleibt. Ändert sich nichts in Deutschland, wird sich der US-Chemieriese jedoch wohl bald schon komplett von Deutschland lösen. Produktions-Kürzungen an weiteren deutschen Standorten sind nur eine Frage der Zeit.

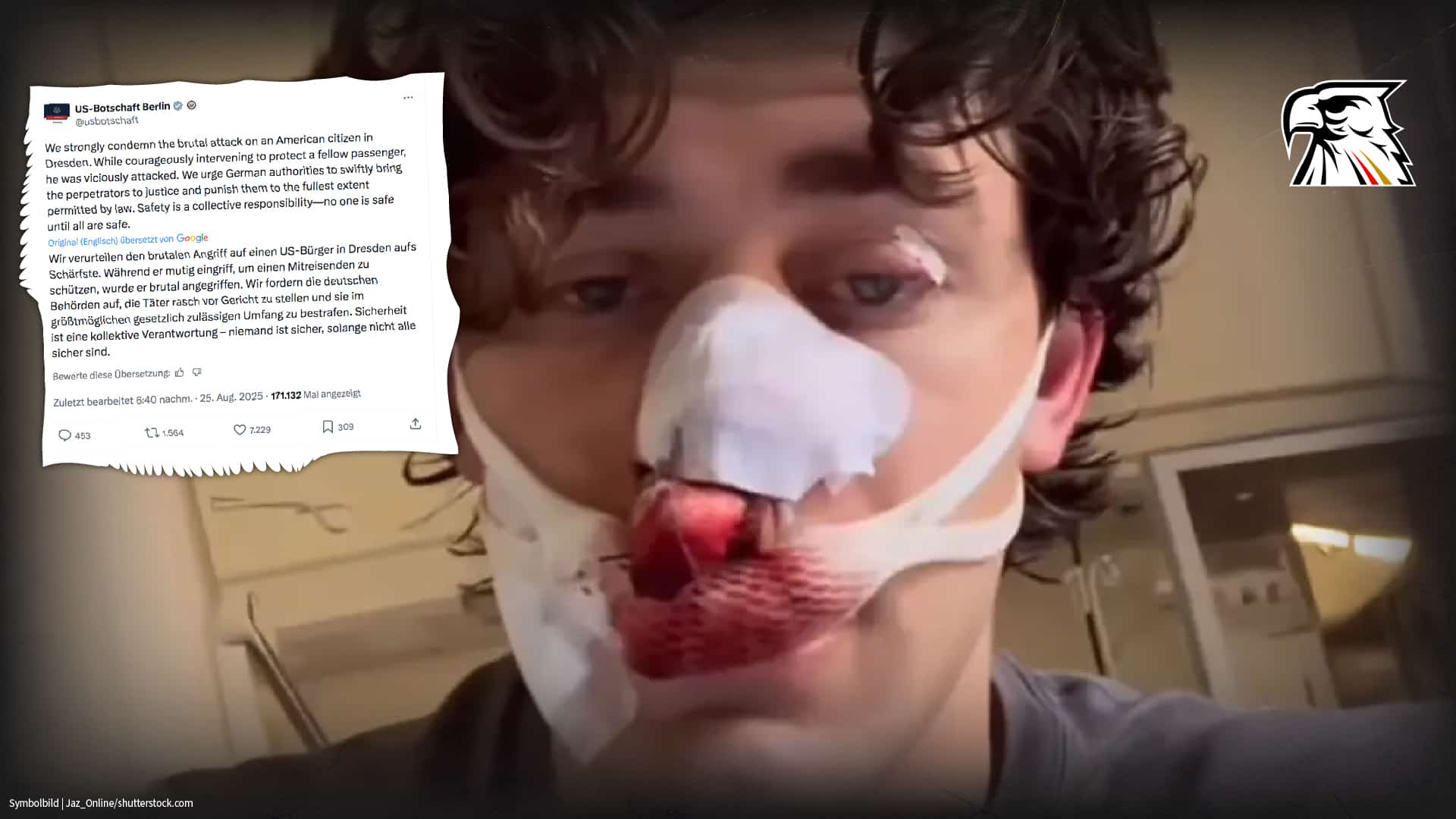

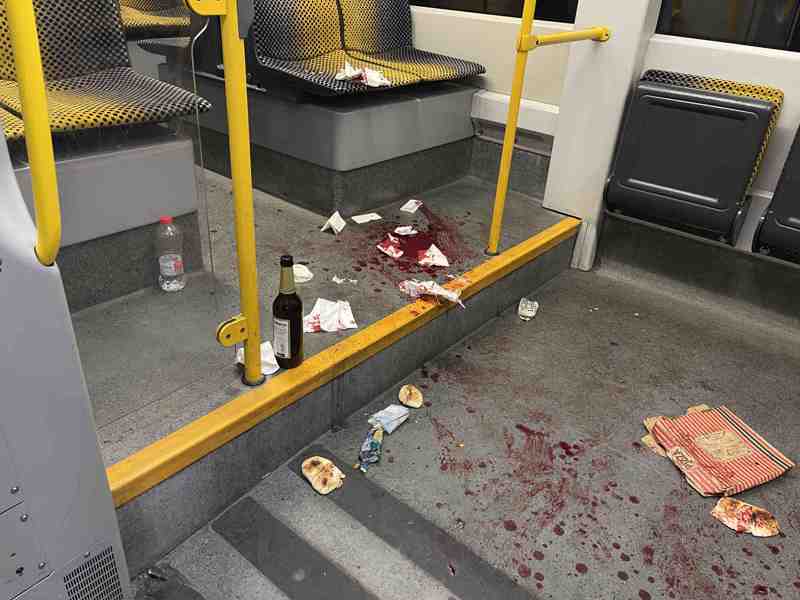



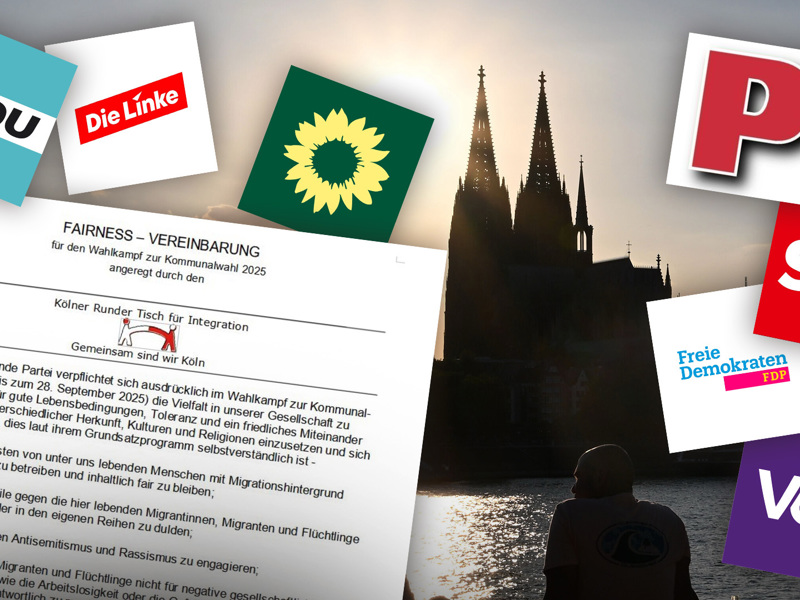

 DEUTSCHLAND: Habeck verlässt Bundestag! Knallharte Abrechnung mit Union in Abschiedsinterview | WELT
DEUTSCHLAND: Habeck verlässt Bundestag! Knallharte Abrechnung mit Union in Abschiedsinterview | WELT






























