
Mit Statistiken ist es stets heikel: Die Politik betreibt Cherry-Picking, wenn vermeintlich harte Fakten eigene Entscheidungen untermauern sollen. Besonders grotesk erscheint die statistische Streckgymnastik, wenn sich grüne Lieblingsprojekte wie die Elektrifizierung der Mobilität mit der Realität verkanten.
Die Politik verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Bis 2030 sollen 15 Millionen vollelektrische Pkw (BEV) über Deutschlands Straßen surren. Doch Autokäufer stellen sich quer: Derzeit sind lediglich 1,8 Millionen der 49,4 Millionen Pkw elektrisch unterwegs – das Ziel ist also schon jetzt unerreichbar. Die Automobilwoche rechnet in ihrem Basisszenario für das Segment mit etwa 6,1 Millionen BEV bis 2030, im pessimistischen Fall gar nur mit 4,7 Millionen.
Damit ist klar: Die politischen Zentralplaner scheitern erneut an der Wirklichkeit – trotz Fördermaßnahmen und steuerlicher Privilegien. Verschärft wird die Lage durch die strukturelle Krise der deutschen Autoindustrie, die hohen Energiepreise, ein Übermaß an Regulierung und den wachsenden Druck internationaler Wettbewerber wie BYD aus China oder Tesla aus den USA.
Dass auch dieser subventionierte Teilbereich der grünen Transformation zum Scheitern des Green Deal beiträgt, ist für jeden offensichtlich, der sich mit den aktuellen Zahlen der deutschen Automobilindustrie auseinandersetzt. Monat für Monat melden die deutschen Autobauer, unabhängig vom Absatzmarkt und Antriebssegment, Zahlen, die den dramatischen Rückgang der Branche dokumentieren. Seit dem besten Jahr 2018 ist die Produktion um bis zu 20 Prozent eingebrochen.
Dies hat direkte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: Allein in den zurückliegenden 12 Monaten gingen rund 51.500 Stellen verloren. Insgesamt wurden seit 2019 etwa 245.000 Arbeitsplätze in der Industrie gestrichen, wobei die Kfz-Branche den größten Blutzoll im Namen des grünen Wirtschaftswunders leisten musste.
Auch das E-Auto-Segment, das mit Sonderabschreibungen und diversen Unterstützungsleistungen zum Aufbau der Ladeinfrastruktur unterstützt wird, weist in dieselbe Richtung: gen Süden.
Mitte Juli 2025 vermeldete das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) euphorisch einen neuen Höchstwert bei den Elektroauto-Neuzulassungen: 248.726 Batterie-Pkw wurden im ersten Halbjahr zugelassen – mehr als im Vorjahr (184.125) und sogar höher als im bisher stärksten Jahr 2023 (220.244). Der Marktanteil bei Neuzulassungen stieg auf 17,7 Prozent (Diesel 15 Prozent), lag aber weiterhin hinter Benzinern (28,3 Prozent). Auf den ersten Blick scheint Deutschland einen E-Auto-Aufschwung zu erleben, eine Sonderkonjunktur mitten in der Rezession.
Doch der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) warnt: Die Realität im Handel, also dort, wo das Tagesgeschäft abgewickelt wird, stelle sich anders dar. Die Nachfrage privater Käufer sank im Vorjahresvergleich um neun Prozent auf 82.294 Fahrzeuge, während Eigenzulassungen von Herstellern und Händlern auf 65.401 stiegen und sich damit teilweise vervierfachten.
Die Autohäuser berichten von stagnierenden gewerblichen Zulassungen, angespannter Geschäftslage und wachsenden Vorbehalten gegenüber E-Fahrzeugen. Der vermeintliche Boom entpuppt sich als Illusion.
ZDK-Präsident Thomas Peckruhn warnte mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im E-Auto-Segment vor statistischen Scheinerfolgen. Die Geschäftssituation vieler Autohäuser und Kfz-Betriebe sei deutlich angespannter, als es die offizielle Zulassungsstatistik vermuten ließe. In der Realität handelte es sich bei den Verkaufszahlen im Elektrosegment häufig um das Ergebnis von Eigenzulassungen durch Hersteller und Händler, Flottengeschäften oder taktischen Maßnahmen – nicht aber um echte Kundennachfrage im Handel, so Peckruhn.
Damit benennt Peckruhn den Kern des Problems: Die vermeintlichen Erfolge bei den Elektro-Neuzulassungen sind in Wahrheit zu einem großen Teil statistische Konstrukte.
Unter einer Eigenzulassung versteht man die Praxis, dass Hersteller oder Händler Fahrzeuge selbst anmelden, um sie später als „junge Gebrauchte“ mit Preisnachlass absetzen zu können – in der Statistik wirkt diese Transaktion wie tatsächliche Nachfrage im Privatkundengeschäft.
Flottengeschäfte verzerren das Bild gleichermaßen: Große Bestellungen durch Konzerne oder staatliche Einrichtungen wecken den Eindruck von Marktdynamik, sind aber nicht selten politisch motiviert oder dienen steuerlich-bilanzieller Optimierung.
Peckruhn verweist zudem auf taktische Tricks der Hersteller: Massenzulassungen zum Quartals- oder Jahresende dienen oft der Erfüllung politischer CO₂-Vorgaben – Strafzahlungen lassen sich so elegant umgehen, während die Statistik einen Boom vorgaukelt.
Um dem lahmenden Segment Beine zu machen, greift der Staat tief in die Instrumentenkiste. Besonders lukrativ ist die steuerliche Regelung für Dienstwagen: Elektrofahrzeuge bis 100.000 Euro Listenpreis werden nur mit 0,25 Prozent des geldwerten Vorteils versteuert – ein klarer Vorteil vor allem für teurere Modelle.
Unternehmen, Selbstständige und Mittelständler profitieren zusätzlich von großzügigen Sonderabschreibungen, die es erlauben, bis zu 75 Prozent der Anschaffungskosten bereits im ersten Jahr steuerlich geltend zu machen.
Parallel dazu bleibt die Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos bis 2035 bestehen. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch Investitionszuschüsse für Ladeinfrastruktur im privaten wie im gewerblichen Bereich, ein bevorzugter Zugang zu Förderkrediten der KfW sowie staatliche Kaufprämien, die bis 2024 je nach Modell mehrere tausend Euro betrugen, dann jedoch aus fiskalischen Gründen gestrichen wurden.
Die Politik hat in Teilen einen ein Pseudo-Markt kreiert, der ohne staatliche Zuschüsse kaum bestehen könnte. Nach Jahren hoher Inflation sitzen viele Haushalte auf leeren Geldbeuteln – teure Anschaffungen wie Autos werden verschoben oder ganz gestrichen.
Die Kfz-Branche drängt in ihrer Not auf sinkende Strompreise, einen schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur und mehr Transparenz bei den Ladetarifen. Laut ZDK-Präsident ließe sich dies über die versprochene Senkung von Stromsteuer und Netzentgelten realisieren.
Für das zweite Halbjahr 2025 rechnet die Mehrheit der Autohäuser und Kfz-Betriebe mit einem weiteren Rückgang der Geschäftslage: Unter den Großbetrieben sind es 54 Prozent, im mittleren Segment 44 Prozent, die mit einem Umsatzrückgang rechnen.
Während bei den Neufahrzeugbestellungen im Bereich der Benzin- und Dieselmodelle nach jahrelangem Abschwung eine Bodenbildung möglich scheint, bleibt die Lage am E-Markt geprägt von politischer Unsicherheit und einer Zurückhaltung im Privatkundengeschäft. Ohne massive Subventionen bleibt der angebliche Boom eine Illusion. Ein Armutszeugnis für das ehemalige Autoland Deutschland.

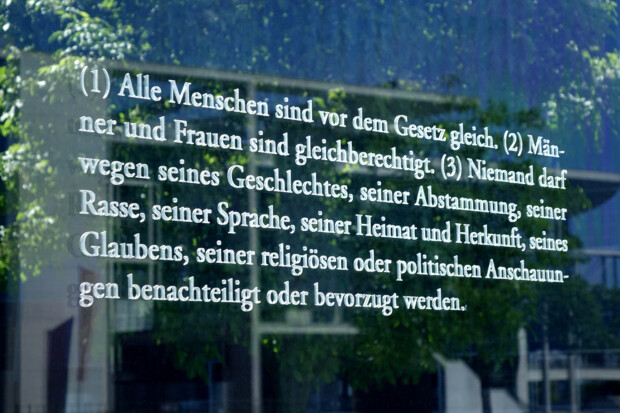




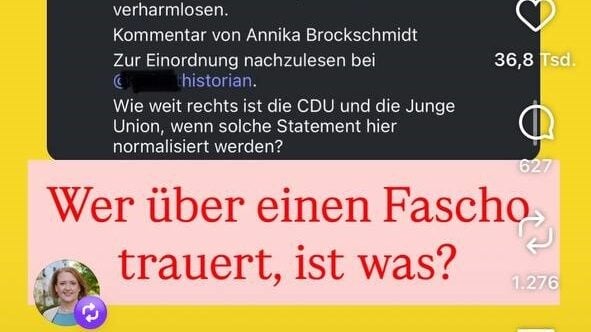

 DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE
DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE






























