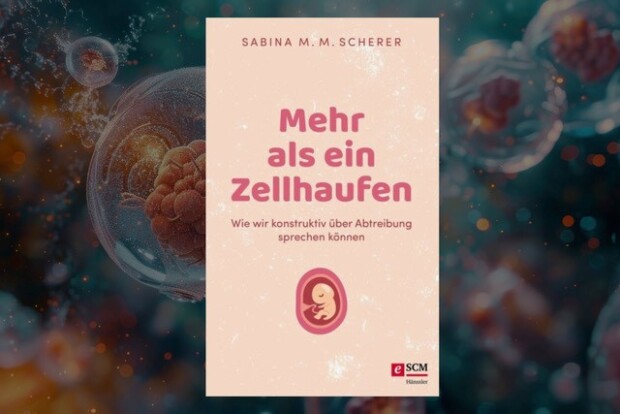
Eine häufig vorgebrachte Klage angesichts der gegenwärtigen Debattenkultur ist das Fehlen einer solchen: Die Bildung von Echokammern, die moralische Überhöhung der eigenen Position; Emotionalisierung des Diskurses und mangelnde Selbstreflexion: das sind nur einige der Phänomene, die Gespräche über kontroverse Themen erschweren. Eines der am schärfsten polarisierenden Themen ist sicher Abtreibung. Anders als bei vielen anderen Fragen, in denen sich Ideologien und ihre Vertreter zwar unversöhnlich gegenüberstehen, Individuen aber oftmals doch viele Gemeinsamkeiten finden, sobald nicht Statistik oder Stereotyp, sondern persönliche Begegnung die Diskussion prägt, bleibt es bei diesem Thema oft hitzig, auch dann, wenn man unter vier Augen miteinander spricht. Aggression, persönliche Verletzungen, intime Ängste – echter Austausch ist schwierig bei diesem nicht nur ideologisch aufgeladenen Thema.
Mitten in diese vertrackte Situation hinein wagt sich die Psychologin Sabina Scherer mit ihrem Buch „Mehr als ein Zellhaufen. Wie wir konstruktiv über Abtreibung sprechen können.“ Ein notwendiges, hilfreiches Buch, und eines, das vollumfänglich einlöst, was der Titel verspricht.
Bevor inhaltliche Einzelheiten erörtert werden sollen, sei der Hinweis erlaubt, dass dieses Buch nicht nur zum Thema Abtreibung wichtige Hilfestellungen bietet, sondern für jegliche Diskussion. An sich selbstverständliche, aber weithin vergessene Grundlagen des Dialogs werden hier vermittelt: Wie etwa jene, dem Gegenüber grundsätzlich mit Wohlwollen zu begegnen, den anderen ernst zu nehmen, und – ohne Naivität – im Zweifel nicht sinistre Motive zu unterstellen, sondern gute Intentionen. All das hebt sich bereits wohltuend ab von der oft von Überheblichkeit und Misstrauen gekennzeichneten Diskussionskultur unserer Tage.
Beides zieht sich konsequent durch Scherers Ausführungen: Der Leser bleibt nie im Dunkeln über ihre persönliche Haltung, die sie freimütig bekennt. Zugleich wird er niemals manipuliert: Scherer baut keine künstliche Dialektik auf, um neutral zu erscheinen, wo sie es nicht ist, stellt aber Gegenargumente differenziert dar.
Inhaltlich beschreibt Scherer die gängigsten Streitpunkte und die jeweiligen Positionen die diesbezüglich eingenommen werden. Sie liefert im Zuge dessen umfangreiches Faktenwissen in leicht verständlicher, aber präziser Sprache. Obwohl der Anmerkungsapparat am Ende des Buches auf das Notwendigste reduziert ist, wird deutlich, dass es auf gründlicher Recherche beruht – ein wichtiger Faktor in einem Bereich, in dem gefühlte Wahrheiten so oft dominieren.
So ist es sicher für viele, gleich ob sie für oder gegen Abtreibung eintreten, durchaus überraschend, dass sich laut Scherer „50% bis 85% der Frauen, [die aufgrund einer Vergewaltigung schwanger werden, Anm.], dafür entscheiden, das Kind auszutragen.“ Scherer zieht hier zwei Studien heran, um empirischen Kontext für ein hochemotionales Thema zu schaffen: Denn die Frauen, die ihr Kind trotz des ihnen zugefügten Verbrechens behalten wollen, tauchen in der Diskussion nicht auf, obwohl sie nicht nur individuell, sondern, wie hier ersichtlich, auch statistisch beanspruchen können, gehört zu werden. Man geht entweder stillschweigend davon aus, dass kaum eine Frau eine solche Entscheidung treffen würde, oder wagt es aus Pietät gegenüber Vergewaltigungsopfern nicht, diese Option in den Raum zu stellen.
Allerdings handelt es sich bei diesem Buch nicht um eine wissenschaftliche Abhandlung, sondern um eine praxisnahe Aufbereitung auch anhand von Empirie und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Autorin wirft nicht mit Zahlen um sich. Sie setzt sie eher exemplarisch ein. Scherer belegt zudem durch kritische Distanz zu Studien, dass sie keine Ideologin im Gewand der Wissenschaftlichkeit ist. Sie weiß mit Daten tatsächlich umzugehen, beleuchtet Einschränkungen der Aussagekraft von Daten und nimmt die Grenzen der Erfassbarkeit menschlicher Erfahrung ernst. Dies gilt nicht nur für Studien, die ihrer Haltung widersprechen, sondern auch für jene, die ihre Meinung tendenziell unterstreichen: Glaubwürdigkeit und Integrität, die sich so selbstverständlich und transparent durch das Buch ziehen, dass sie kaum auffallen.
Allerdings wird der Leser nicht gleich eingangs mit den emotionalsten Themenbereichen konfrontiert. Am Beginn steht – nach lesenswerten Vorworten – die biologische und naturwissenschaftliche Dimension. Ebenfalls zu Beginn werden Scheinwidersprüche sichtbar gemacht, z.B. in Bezug auf das Verhältnis zwischen subjektiver Empfindung und objektiver Einordnung oder auch zwischen persönlicher Entscheidung und moralischer Bewertung.
Philosophische Fragestellungen werden vor allem im Hinblick darauf angerissen, dass weltanschauliche Prämissen die eigene Haltung beeinflussen. An sich eine Binsenweisheit – und doch ist es überraschend, wie häufig auf beiden Seiten weltanschauliche Voraussetzungen unbewusst bleiben, so dass die Schaffung einer gemeinsamen Diskussionsgrundlage unterbleibt.
Sodann werden gesellschaftliche und soziale Argumente für Abtreibung versammelt und analysiert, Gegenargumente werden formuliert. Erst im zwölften Kapitel geht es um „Härtefälle, kriminologische und medizinische Indikation“. Hier räumt Scherer mit verbreiteten Missverständnissen auf – etwa mit der fälschlichen Annahme, jede medizinische Maßnahme, die den Tod des Ungeborenen zur Folge habe, sei eine Abtreibung. Nicht nur an dieser Stelle kritisiert sie die Instrumentalisierung von tragischen, oft vermeidbaren Einzelfällen, die etwa aus juristischer Fehleinschätzung oder Überforderung resultieren.
Einen breiten Raum nimmt sodann die Auseinandersetzung mit dem Feminismus ein. Scherer beansprucht diesen Ausdruck für sich, ebenso wie den Begriff „Selbstbestimmung“. Knapp legt sie den Unterschied zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung dar, erklärt, allerdings geradezu zurückhaltend sachlich, wie Feminismus sich selbst verrät, wenn er letzteres zum Ziel erhebt und somit zwangsläufig den Mann zur Norm erklärt. Durch die angestrebte Angleichung der Frau an den Mann hilft er so, das Frausein mit all seinen natürlichen Gegebenheiten und Prozessen zum Mangel zu erklären. Eine Perspektive, die unter „konservativen“ Lebensrechtlern wie unter linken Feministinnen wenig präsent ist, und eine wichtige Hilfestellung, um zu vermitteln, dass Lebensrechtler „feministisch“ sind, in dem Sinne, dass sie Interessen und Rechte von Frauen vertreten, und der Objektivierung der Frau entgegentreten.
Scherer bleibt durchweg sachlich und unterlässt jegliche Polemik. Klare Ansagen fehlen dennoch nicht. Erfrischend ehrlich wirkt sie, wenn sie eingesteht, dass ihr diese oder jene Denkbewegung so gar nicht einleuchten will – etwa, als sie zugibt, nicht ergründet zu haben, wie jemand allen Ernstes keinen Unterschied zwischen natürlichem Tod – bei einer Fehlgeburt – und gezielter Tötung zu erkennen vermeine. Auch an solchen Stellen bleibt sie im Ton freundlich und zugewandt.
Scherer, die sich selbst als Aktivistin bezeichnet, belegt, dass Aktivismus nicht Verbissenheit bedeutet. Die sucht man in „Mehr als ein Zellhaufen“ vergeblich. Im Gegenteil. Vor allem der erste Teil des Buches, der das eigentliche Argumentarium bildet, kann auch Abtreibungsbefürwortern wichtige Impulse bieten. Nicht nur durch Faktenwissen, sondern auch durch die am Kapitelende eingestreuten Fragen, die eigentlich an Pro-Lifer gerichtet sind, und diese dazu anregen, die eigene Position genau zu hinterfragen.
Dem dienen auch die beiden weiteren, deutlich kürzeren Abschnitte des Buches. Im zweiten Teil erwarten den Leser „weniger hilfreiche Argumente“: Unangemessene und übergriffige Argumentationsmuster werden nachvollziehbar dargestellt. Insbesondere sei hier herausgegriffen, dass die Autorin auf die Problematik religiös gefärbter Argumentation eingeht. Wer Lebensschutz zur Glaubensfrage macht, suggeriert, dass dies eine exklusiv religiöse, vorrangig christliche Angelegenheit sei. Dem widerspricht nicht nur die Existenz dezidiert säkularer Lebensrechtsgruppierungen, sondern auch die Fülle an unabhängig von Religion nachvollziehbaren Argumenten.
Scherers Einwände zeigen einerseits, dass „Lebensrechtler“ durchaus keine homogene Gruppe bilden. Andererseits beweist sie wiederum ihre Ausgewogenheit, indem sie das, was ihr an den „eigenen Leuten“ kritikwürdig erscheint, ohne Scheu anspricht. Sie warnt vor Selbststereotypisierung, beschreibt fairerweise aber auch, wie sehr sich die Lebensrechtsbewegung durch Reflexion und Selbstkritik bereits weiterentwickelt hat.
Im letzten Teil schließlich richtet sich Scherer nochmals explizit an die Lebensrechtsbewegung, und stellt schlaglichtartig dar, welche Ziele die Bewegung verfolgt bzw. verfolgen sollte, und nicht zuletzt, was der Einzelne beitragen kann. Den Abschluss bietet ein Kommunikationsleitfaden, der dazu ermutigt, in den Austausch zu gehen, auf den die Lektüre des Buches vorbereitet haben sollte. Darin werden Grundregeln an die Hand gegeben, wie etwa „sei mutig“ aber auch „kommuniziere gewaltfrei“: Sie ergänzen die kurzen „Praxiseinheiten“, die das Buch durchziehen, und führen von der Durchdringung des Themas zur Anwendung.
Wer nicht nur Scherers Fakten verinnerlicht, sondern auch ihre reflektierte, unaufgeregte, liebevolle Herangehensweise und ihren ehrlichen Wunsch nach Dialog, der kann nach der Lektüre von „Mehr als ein Zellhaufen“ tatsächlich sachgemäß und „konstruktiv über Abtreibung sprechen“ – und insgesamt zu einem zugleich sachlichen und menschlichen Diskussionsklima beitragen.
Sabina M. M. Scherer, Mehr als ein Zellhaufen. Wie wir konstruktiv über Abtreibung sprechen können. Verlag SCM Hänssler, Hardcover, 224 Seiten, 20,00 €.


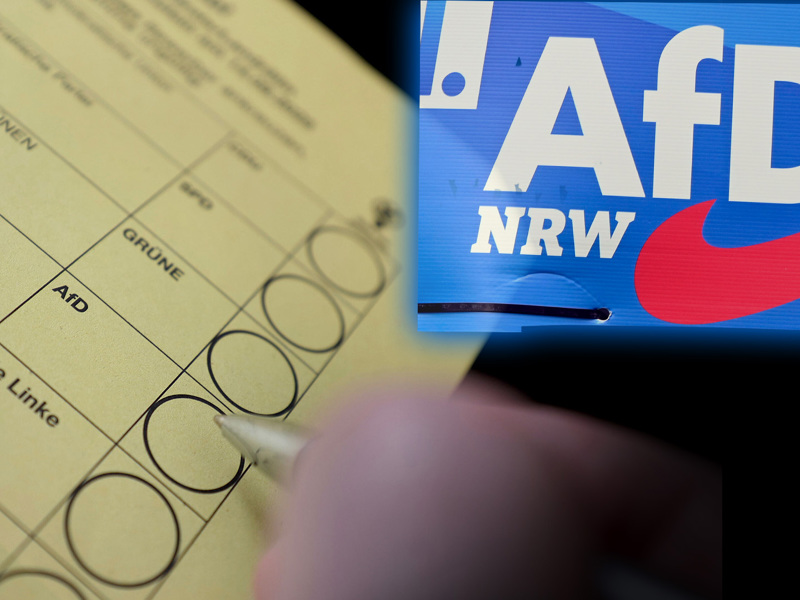


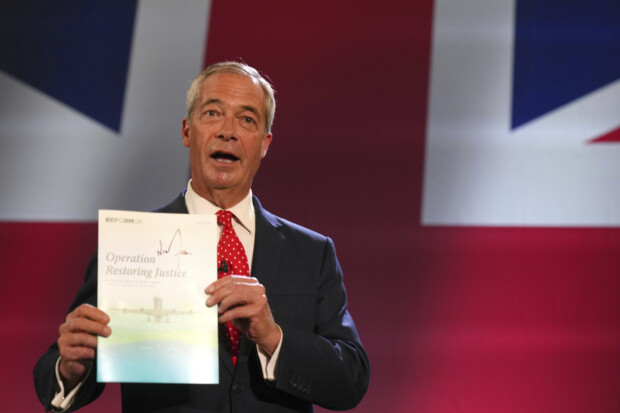



 PUTINS KRIEG: Russland will Angriffe auf Ukraine verstärken! Selenskyj will Sanktionen | WELT STREAM
PUTINS KRIEG: Russland will Angriffe auf Ukraine verstärken! Selenskyj will Sanktionen | WELT STREAM






























