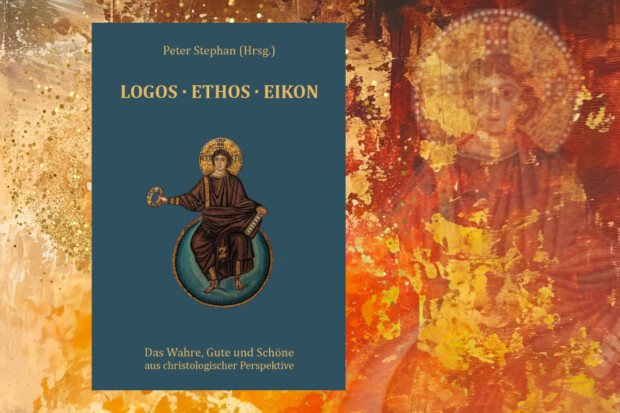
Das Christentum übernahm diese Trias, weil es sie in Christus, dem Mensch gewordenen Gott, auf vollkommene Weise verkörpert sah. Doch schon Platon hatte das Wahre, Gute und Schöne im Rahmen seiner Ideenlehre als eine metaphysische Größe begriffen: Bereits vor ihrer Inkarnation erblickt die menschliche Seele das Wahre, das Gute und das Schöne in seiner reinsten Form. Sie trägt diese Erkenntnis fortan in sich und ist erfüllt von dem Verlangen, sich dem ursprünglichen Idealzustand anzunähern. Platon nannte dies den Eros. Dieser Eros war für die Griechen die Grundlage für ein wahrhaftiges Menschsein. Das Christentum sublimierte den Eros zum Amor intellectus Dei, zur geistigen Gottesliebe, in der die menschlicher Existenz ihre Vollendung findet.
Diese metaphysischen Bezüge werden heute, im Zeitalter des Nihilismus, Materialismus und Relativismus infrage gestellt. Nirgends wird die Preisgabe der Metaphysik deutlicher als in der Theologie. Entgegen ihrem eigentlichen Auftrag sucht die „Lehre von Gott“ nicht mehr das göttliche Mysterium zu ergründen, sondern suggeriert dem Menschen, er könnten sich selbst erlösen, indem er sich auf „Augenhöhe“ mit Gott begibt. Das Göttliche wird in die Trivialität des Alltäglichen herabgezogen.
Innerhalb dieser innerweltlichen Sichtweise vollzieht sich die Fortentwicklung des Menschen nicht mehr in der Vertikalen, das heißt in der Erhebung der Seele und der Herzen zum Göttlichen, sondern in der Horizontalen, also im Rahmen eines rein technischen und sozialen Fortschritts. Mit dieser neuen Anthropozentrik geht zwangsläufig die Entwertung des Wahren, Guten und Schönen einher, wenngleich auf unterschiedliche Weise.
Das Gute wird durch die Abkoppelung von der Metaphysik vordergründig relativiert und subjektiviert. Gerade dies erleichtert es aber Ideologien und totalitären Systemen, Moral und Ethik durch die Hintertür wieder zu verabsolutieren – in ihrem Sinne.
Einer ähnlichen Instrumentalisierung ist die Kategorie des Wahren ausgesetzt. Wer den Anspruch erhebt, überzeitliche Wahrheiten zu verkünden, gilt als autoritär – es sei denn, er bedient die Glaubenssätze der herrschenden Eliten: die Klimareligion, das Corona-Dogma, die Flüchtlings-Doktrin oder den Kreuzzug gegen “rechts“.
Auch die Wissenschaft strebt nicht mehr nach Wahrheit und Erkenntnis, sondern dient sich zur Sicherung von Drittmitteln der Politik an, die ihr Inhalte und Resultate vorgibt. „Diktatur des Relativismus“ nannte Joseph Ratzinger diesen Zustand.
Nicht weniger betroffen vom Verlust der Metaphysik ist die Schönheit. Was Philosophen, Theologen und Künstler einst für wahr und gut hielten, wollten sie auch durch Schönheit zur Anschauung bringen. Und ganz gleich, wie ihr ästhetisches Empfinden im Einzelnen ausfiel – niemand konnte sich vorstellen, Schönheit könne für etwas Unwahres oder Schlechtes stehen.
Vor allem in den „schönen Künsten“ blieb die Vorstellung lebendig, dass wahrhaftige Schönheit transzendent sei und den Zugang zum Göttlichen, ganz gleich, wie man es definierte, eröffne. In der griechischen Mythologie trug der geflügelte Pegasus – er krönt den Giebel der Frankfurter Oper – die Dichter in die Höhen des Olymp. In der christlichen Theologie eröffnete die via pulchritudinis, der „Weg der Schönheit“, den geistigen Aufstieg zu Gott.
Ohne die Sehnsucht nach einer die Materie übersteigenden Schönheit hätte es die scheinbar schwerelos schwebende Himmelskuppel der Hagia Sophia ebenso wenig gegeben wie die den Himmel aufreißenden Deckenfresken der oberbayrischen Wieskirche. Ohne das Verlangen, die Welt durch einen höheren Schönheits- und Wahrheitsbegriff zu sublimieren, hätte Raffael niemals seine Madonnen malen und Bach niemals seine Oratorien komponieren können. Selbst herausragende Werke der Profankunst, etwa die Skulpturen des Polyklet, die Villen Palladios oder die Gedichte Goethes, sind ohne einen höheren Schönheits- und Wahrheitsbegriff undenkbar.
Das Bedürfnis nach Schönheit war so umfassend, dass es bis in die Alltagswelt hineinreichte – in die Mode, in das Handwerk, in die Wohnkultur. Natürlich besaß Schönheit innerhalb dieser Alltagswelt nicht mehr dieselbe Erhabenheit und spirituelle Tiefe. Aber sie zeugte doch von dem Bemühen der Menschen, auch dem täglichen Leben Würde und höheren Sinn zu geben.
Wird Schönheit vom göttlichen Wahrheitsbegriff losgelöst, ist sie allen möglichen Missdeutungen ausgesetzt. Dann kann sie willkürlich als Blendwerk und unnützer Zierrat abgetan und unter den Generalverdacht unlauterer Oberflächlichkeit gestellt werden. Im Umkehrschluss gilt dann das Unschöne, das angeblich nichts kaschiert und nichts bemäntelt, als ehrlich. Und das Hässliche, das Brüche und Verwerfungen aufzeigt, wird als authentisch gefeiert. Die Folge sind „künstlerische“ Produktionen, die provozieren und beleidigen, aber nicht erbauen, geschweige denn erheben.
Welcher Architekt, Maler, Bildhauer, Dichter oder Musiker vermag unter solchen Bedingungen noch wahrhaft Schönes zu schaffen? Der Mensch, der nach Schönheit strebt, muss sich mit Surrogaten zufriedengeben. Bestenfalls wird Anmut durch Gefälligkeit, Hoheit durch Vornehmheit, Pracht durch Prunk ersetzt. In der Regel aber hat man sich mit Angeboten der Popkultur oder des modischen Designs zufriedenzugeben. Im schlimmsten Fall droht der Kitsch. Der ominöse Röhrende Hirsch ist ebenso das Resultat einer verdrängten Metaphysik wie die Hypermoral eines Klimaklebers oder die Propaganda eines politischen Sektierers.
Paradoxerweise weckt dieser Niedergang jedoch keine neue Suche nach authentischer Schönheit. Im Gegenteil gibt er den Leugnern des Schönen zusätzlichen Auftrieb, sehen sie sich doch in ihrer Feindseligkeit gegenüber der Ästhetik – oder dem Ästhetisieren, wie sie es nennen – bestätigt.
Aus christlicher Perspektive kann die Überwindung der Krise nur durch eine Rückbesinnung auf Christus selbst gelingen. Aus diesem Grund hat der Verfasser dieses Artikels eine Debatte angestoßen, die in einem 2024 im Augsburger Dominus-Verlag erschienen Buch einen ersten Niederschlag gefunden hat. Der Titel „Logos · Ethos · Eikon. Das Wahre, Gute und Schöne aus christlicher Perspektive“ assoziiert die drei christologischen Grundeigenschaften mit der platonischen Wertetrias: Der Logos (= das göttliche Wort bzw. die göttliche Vernunft) steht für die Wahrheit, die sich in Christus offenbart, das Ethos (= das von sittlichen Werten bestimmte Bewusstsein) für den von Christus gewiesenen Weg zum Guten und das Eikon (= Bild) für das Schöne, das in Christus bildliche Gestalt angenommen hat.
In der gotischen Kathedrale beispielsweise sind die in riesige Glasflächen aufgelösten Wände Ausfluss einer neuplatonischen Lichtmetaphysik, während die einzigartige konstruktive Logik unter dem Einfluss der aristotelischen Theologie zur Manifestation des göttlichen Vernunftprinzips wurde. Die Baumeister, der diese Architektur entwarfen, erhoben den Anspruch, das Werk des göttlichen Weltenbaumeisters abzubilden: des deus artifex, in dem die antike Philosophie den Demiurgen der Welt vermutete und der im Christentum zum Schöpfer eines heilsgeschichtlich geordneten Kosmos avancierte.
Mit diesem Gottesbild gingen die Erbauer der Kathedralen weiter als ihre antiken Vorgänger, die in den wohlproportionierten Säulenreihen des Parthenon oder im halbrunden Kuppelgewölbe des Pantheon zwar gleichfalls die Schönheit und Harmonie des Kosmos wiedergaben – aber noch ohne den Glauben an einen Schöpfergott, der seine Schöpfung zur Vollendung führt, indem er als Person in sie hineintritt – und folglich auch ohne eine die Materie übersteigende Transzendenz und Transparenz.
Ein anderes Beispiel ist von tagespolitischer Aktualität. Am 2. Februar 2015 ermordeten Anhänger des Terrornetzwerks Islamischer Staat 21 junge ägyptische Männer am libyschen Strand von Sirte. In einer höchst effektvoll konzipierten und gefilmten Inszenierung wurden die Opfer in orangefarbenen Guantanamo-Overalls wie in einer Prozession vorgeführt und mussten sich niederknien. Während die Kamera direkt auf ihre Gesichter hielt, sprachen die hinter ihnen stehenden Schergen das Urteil. Anschließend warfen die Mörder ihre Opfer zu Boden, drückten die Finger in ihre Augen und schnitten ihnen von der Kehle her die Köpfe ab. Ihr Blut sollte ins Meer fließen als Kampfansage gegen den „ungläubigen“ Westen.
Die jungen Christen hätten durch Konversion ihr Leben retten können, blieben aber standhaft. Ihre Bereitschaft zum Martyrium mag säkularen Europäern als Torheit erscheinen. In Wahrheit ist sie jedoch einer religiösen Prägung entwachsen, die das gesamte Alltagsleben der Kopten durchdringt und in der Selbsthingabe an Christus die Vollendung des irdischen Daseins erkennt. Daher stand den Verurteilten auch keinerlei Angst ins Gesicht geschrieben. Mit einer fast unerklärlichen Unerschütterlichkeit und Gelassenheit sprachen sie ihr letztes Gebet.
Dieser Bekennermut, der sich diametral vom wohlfeilen Gratismut staatlich finanzierter Gutmenschen unterscheidet, gibt den seit 1400 Jahren vom Islam bedrängten und immer wieder blutig verfolgten Kopten die Kraft, ihre Identität und Kultur zu wahren. Die Furchtlosigkeit vor dem Tod wird zum Überlebenselixier. Was von den Terroristen als Einschüchterung gedacht war, hat seinen Schrecken verloren. In einer metaphysischen Umkehrung der Werte wird die Schwäche zur Stärke, die Niederlage zum Triumph. Oder wie es der Apostel Paulus ausgedrückt hat: „Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?“ (vgl. 1. Korintherbrief 15,55).
Als Fallbeispiele zeigen die gotische Kathedrale und die 21 Martyrer, welche Denk- und Handlungsräume sich eröffnen, wenn der Mensch seine relativistischen und materialistischen Limitationen überwindet. Besonders wichtig wird diese Überwindung in einer Zeit, in der Gewissheiten und Sicherheiten immer brüchiger werden und das Gefühl von Ohnmacht und Niedergang überhandnimmt. In der Neuausrichtung auf das Wahre, Gute und Schöne als transzendente Kategorien liegt eine große Chance für die Revitalisierung einer müde und ängstlich gewordenen Gesellschaft, weit über den Diskursraum der christlichen Theologie hinaus.
Peter Stephan (Hg.): Logos · Ethos · Eikon. Das Wahre, Gute und Schöne aus christologischer Perspektive. Dominus-Verlag, 384 Seiten, 53 Abbildungen in Farbe. Gebunden. Fadenheftung, Kaptalband, zwei Lesebändchen. 29,85 €.

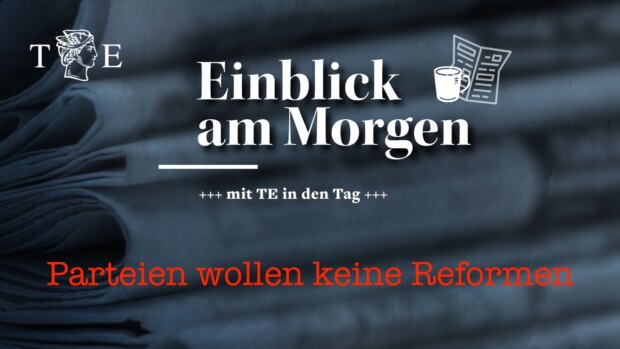






 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























