
Die heutigen Teenager sind ein Haufen Tugendbolde. Im Vergleich zu früheren Generationen rauchen sie seltener, trinken weniger Alkohol und haben seltener Sex. Ihr einziges Laster scheint es zu sein, dass sie Zeit in den sozialen Medien verbringen. Forschern zufolge loggen sich heute fast alle Teenager täglich ein, wobei viele von ihrer fast ununterbrochenen Nutzung von Apps wie TikTok oder Snapchat berichten.
Doch nicht mehr lange, zumindest wenn es nach dem Willen der EU geht. Mehrere Länder drängen jetzt auf EU-weite Beschränkungen für die Nutzung sozialer Medien durch Kinder. Vergessen Sie also Mama und Papa. Bald könnte es Ursula von der Leyen sein, die „nein“ zu Instagram sagt.
Die Panik in Bezug auf Kinder und soziale Medien will einfach nicht abklingen. Die Nutzung sozialer Medien gilt als „süchtig machend“ und wird mit einer Zunahme psychischer Probleme in Verbindung gebracht, insbesondere mit Angstzuständen, Depressionen und geringem Selbstwertgefühl. Die Nutzung hat eine ganz neue Form des Missbrauchs hervorgebracht: Cybermobbing. Es heißt, es führe zu schlechterem Schlaf, schwächeren schulischen Leistungen und geringerer „Lebenszufriedenheit“. Man bringt die sozialen Medien mit einer erhöhten Rate von Selbstverletzungen bei Mädchen und „extremer Frauenfeindlichkeit“ bei Jungen in Verbindung. Jede neue Behauptung veranlasst Schulen, Technologieunternehmen, nationale Regierungen – und jetzt auch die EU – dazu, strengere Beschränkungen und Altersgrenzen für den Zugang zu sozialen Medien einzuführen.
Australien führt noch in diesem Jahr ein landesweites Verbot für Kinder ein, sich bei sozialen Medien anzumelden. Frankreich hat schon 2023 Maßnahmen verabschiedet, um Kindern unter 15 Jahren ab 2023 den Zugang zu sozialen Medien zu sperren. Der französische Präsident Emmanuel Macron prägte den Begriff der „digitalen Volljährigkeit“ zur Bezeichnung des Alters, ab dem Kinder rechtlich als reif genug für den uneingeschränkten Zugang zu sozialen Medien gelten. „Wir müssen die Kontrolle über das Leben unserer Kinder und Jugendlichen in Europa zurückgewinnen und die digitale Volljährigkeit ab dem von 15 Jahren, nicht früher, durchsetzen“, erklärte er 2024. Länder wie Spanien, Dänemark und Frankreich wollen diese Vorstellung einer „digitalen Volljährigkeit“ nun auf EU-Ebene verankern.
Aber „digitale Volljährigkeit“ ist eine unsinnige Vorstellung. Zunächst einmal schlägt niemand ernsthaft vor, dass Kinder komplett offline bleiben sollen. Seit Jahrzehnten wird uns erzählt, dass digitale Technologie das Einzige sei, was Kinder in der Schule wirklich beherrschen müssen. Teenager wurden bis gerade eben noch routinemäßig als „digital natives“ gefeiert. Ob es uns nun gefällt oder nicht, ein Großteil des Lebens findet heute online statt, und so wie Kinder in der Vergangenheit gelernt haben, Straßen zu überqueren und Briefe zu schreiben, müssen die Kinder von heute wissen, wie man das Internet nutzt.
Als Argument für das „digitale Erwachsensein“ führen manche ernsthaft an, dass die sozialen Medien sogar süchtiger machen als Zigaretten oder Alkohol. Doch der Vergleich greift zu kurz. Im Gegensatz zum Rauchen, das nachweislich Gesundheitsrisiken birgt, deren Abwägung wir Erwachsenen zutrauen, sind die „Risiken“ der Nutzung sozialer Medien weit weniger eindeutig. Wir können zwar Korrelationen zwischen der online verbrachten Zeit und dem Ausmaß an Ängsten feststellen, aber ob das eine tatsächlich das andere verursacht, ist fraglich. Schlechter Schlaf und geringere Lebenszufriedenheit sind möglicherweise nicht auf die übermäßige Nutzung sozialer Medien zurückzuführen, sondern auf das, was Jugendliche nicht tun, während sie vor dem Bildschirm sitzen, z. B. ihr Zimmer verlassen und sich mit Freunden treffen.
Obwohl sie vorgeben, auf der Seite der Eltern zu stehen, untergraben der französische Präsident Emmanuel Macron und seine EU- Pendants mit ihren Vorschlägen unweigerlich die Autorität der Erwachsenen. In der Vergangenheit haben Aktivisten, internationale NGOs und supranationale Organe wie die EU eifrig für sogenannte Kinderrechte geworben. Diese Rechte sind in der Regel Etikettenschwindel – wie etwa das „Recht“ auf umfassende Sexualerziehung. Tatsächlich nehmen sie den Eltern das Recht, ihre Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Werten zu erziehen. Verbote von sozialen Medien funktionieren auf die gleiche Weise. Zu Hause sollten die Eltern und in der Schule die Lehrer den Kindern sagen, dass sie ihr Handy weglegen sollen. Überträgt man diese Verantwortung an Minister und die EU-Kommission übertragen, wird die Autorität von Eltern und Lehrern in Frage gestellt. Das schwächt die Vorstellung des Erwachsenseins an sich.
Die Verantwortung für Kinder zu übernehmen, kann für Eltern und andere Erwachsene durchaus bedeuten, die Zeit, die diese online verbringen, zu begrenzen und sie zu ermutigen, die Welt jenseits des Bildschirms zu erleben. Aber wir müssen misstrauisch sein gegenüber Ministern, die Teenager von den sozialen Medien fernhalten wollen.
Zunächst einmal fällt es schwer, dieses jüngste potenzielle Vorhaben nicht im Kontext einer weitreichenderen Panik vor sogenannter Falsch- und Desinformation zu betrachten. Aus Angst davor, dass sich die Bürger vom Mainstream-Journalismus abwenden und in den sozialen Medien frei debattieren, sind die Regierungen der Mitgliedstaaten und die EU bestrebt, eine größere Kontrolle darüber auszuüben, was uns allen online begegnet. Da sie nicht in der Lage sind, soziale Medien vollständig zu überwachen und zu kontrollieren, sehen sie in Beschränkungen für Teenager einen guten Ansatzpunkt. Nicht zuletzt, weil offenbar auch Teenager von populistischen Parteien online „verführt“ werden.
Die Panik um Teenager und soziale Medien ist zu einem Vorwand geworden, um zu kontrollieren, was Kinder online lesen können und was nicht. Seien Sie nicht überrascht, wenn sich die Obrigkeit als nächstes die Erwachsenen vorknöpft. Ihre Autorität ist längst untergraben.
Dieser Beitrag ist zuerst beim britischen Magazin spiked erschienen. Mehr von Joanna Williams lesen sie in den Büchern „Die sortierte Gesellschaft: Zur Kritik der Identitätspolitik“ und „Schwarzes Leben, Weiße Privilegien: Zur Kritik an Black Lives Matter“. Joanna Williams ist Kolumnistin beim britischen Magazin spiked, Autor von How Woke Won und Gastwissenschaftlerin des MCC Budapest.






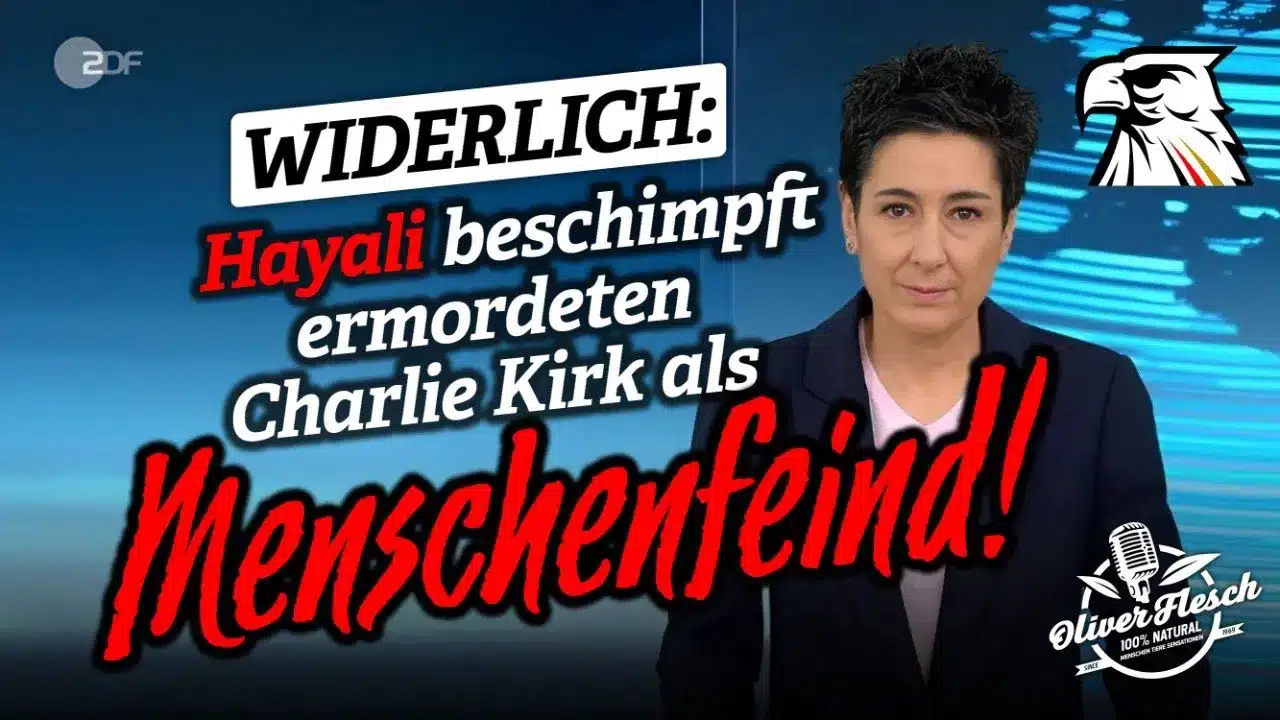


 🚨Kirk-Attentat! So wird Gewalt gegen Konservative vertuscht | NIUS Live am 12. September 2025
🚨Kirk-Attentat! So wird Gewalt gegen Konservative vertuscht | NIUS Live am 12. September 2025






























