
Die Grünen behaupten, Kernkraftwerke seien anfällig für Hitze – und damit keine Zukunftstechnologie. NIUS hat bei Energieexperte Dr. Björn Peters nachgefragt. Ein Gespräch über die Wetteranfälligkeit der Erneuerbaren, die erstaunliche Stabilität der Kernenergie – und die Trugschlüsse der Klimapolitik.
NIUS: Beginnen wir mit einer aktuellen Äußerung der Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann. Sie behauptete, Kernkraft sei keine Zukunftstechnologie mehr, weil einige Reaktoren bei Hitze heruntergefahren werden müssten – insbesondere in Frankreich und der Schweiz. Wie ist das einzuordnen?
Dr. Björn Peters: Das ist ein klassischer Fall von selektiver Wahrnehmung. Mir fällt dazu immer das biblische Bild vom Splitter im Auge des anderen und dem Balken im eigenen ein. Denn wenn eine Energieform ein massives Wetterproblem hat, dann sind es die sogenannten „Erneuerbaren“. Die Kernkraft hat – im langjährigen Durchschnitt – ein Problem von etwa 0,3 Prozent Leistungsverlust durch Hitzeschutzmaßnahmen. Und das auch nur in Frankreich. In Deutschland ist das praktisch vernachlässigbar.
Dagegen haben Windkraftanlagen ein Wetterproblem von etwa 75 bis 80 Prozent – die meiste Zeit steht der Wind nicht im nötigen Bereich. Und Photovoltaik funktioniert nur rund 900 Stunden im Jahr wirklich produktiv – bei insgesamt 9000 Jahresstunden. Diese Diskrepanz blendet Frau Haßelmann völlig aus.
Darüber hinaus: Dass Kernkraftwerke ihre Leistung drosseln, um Umweltbelastungen zu vermeiden, zeigt, dass sie sich wirklich um die Umwelt bemüht. Den Windbaronen ist hingegen gleichgültig, wenn sich da mal ein Seeadler oder Mäusebussard verfängt. Den fressen dann schnell die Füchse – und dann ist der weg.
NIUS: Wäre es auch möglich, die Kühlung von Kernkraftwerken unabhängig vom Flusswasser zu organisieren?
Peters: Ja, natürlich. Es gibt dafür mehrere Lösungen. In Deutschland hatten wir etwa im Kernkraftwerk Neckarwestheim einen sogenannten Trockenkühlturm. Der kondensiert den Wasserdampf, ohne ihn direkt zu verdampfen, und kommt so mit deutlich weniger Wasser aus. Gerade an kleineren Flüssen wie dem Neckar war das ein sinnvoller Weg.
Ein gutes Beispiel sind auch die Reaktoren in Bugey in Frankreich. Zwei von ihnen nutzen Kühltürme – die laufen durch. Die anderen zwei kühlen direkt aus der Rhône und müssen bei Hitze gelegentlich gedrosselt werden. Aber „gedrosselt“ heißt eben nicht: abgeschaltet. Im Gegensatz dazu bricht die Solar- oder Windstromproduktion bei bestimmten Wetterlagen völlig zusammen.
Kernkraftwerk Bugey in Saint Vulbas, Frankreich, am Sonntag, den 22. Juni 2025. Frankreich erwog hier jüngst Reduzierungen der Stromproduktion.
NIUS: Die Grünen warnen nun: Durch den Klimawandel wird es häufiger heiß – also nehme auch das Hitzeproblem der Kernkraft zu. Ist da etwas dran?
Peters: Im Prinzip ja – aber das Ausmaß bleibt gering. Selbst wenn sich die Zahl dieser Hitzetage verdoppeln würde, reden wir vielleicht von 0,6 Prozent Ausfall im Jahr. Das ist technisch problemlos beherrschbar – etwa durch bessere Kühlsysteme oder Standorte mit Meerwasserzugang.
Und vergessen wir nicht: Auch Wind- und Solarenergie haben massive Klimaempfindlichkeiten. Photovoltaik verliert bei hohen Temperaturen deutlich an Wirkungsgrad. Und bei der Windkraft kommt ein Phänomen dazu, das viele nicht auf dem Schirm haben: das sogenannte „Global Stilling“.
NIUS: Was bedeutet das?
Peters: Früher ging man davon aus, dass sich durch den Klimawandel die Temperaturgegensätze zwischen Äquator und Polregionen abschwächen – weil die Arktis sich schneller erwärmt. Das führt dazu, dass die mittlere Windgeschwindigkeit abnimmt. Und das beobachten wir tatsächlich. Die Windenergie leidet bereits heute darunter – und das dürfte sich noch verstärken.
Ich habe vor etwa zehn Jahren versucht, dafür eine neue Disziplin zu aufzugleisen: die „Statistische Energiemeteorologie“. Ziel war, systematisch zu untersuchen, wie sich ein Stromsystem mit hohem Anteil wetterabhängiger Energie unter Bedingungen des Klimawandels verhält. Leider ist das völlig gescheitert – es gab schlicht kein Interesse, auch keine Fördergelder. Diese Fragen werden politisch einfach ignoriert.
NIUS: Und die Kernkraft? Sie funktioniert doch auch in heißen Ländern – Saudi-Arabien etwa will sie massiv ausbauen. Auch Südafrika nutzt Kernkraft.
Peters: Absolut. In warmen Ländern baut man Kraftwerke besser ans Meer. Auch in Deutschland haben wir mit Brokdorf ein solches Beispiel. Das Meer ist als Wärmesenke sehr gut geeignet, weil sich die Wärme dort viel besser verteilt als in Flüssen. Die ökologischen Auswirkungen sind entsprechend geringer – auch das wird oft verschwiegen.
Das Kernkraftwerk Brokdorf liegt in Schleswig-Holstein an der Unterelbe, ca. 60 km entfernt davon, wo die Elbe in die Nordsee mündet.
NIUS: Was sagt diese ganze Argumentation über das Denken der Grünen aus?
Peters: Es zeigt, wie ideologisch diese Partei mit Wissenschaft umgeht. Es ist ein Kult, der bestimmte Narrative pflegt – und alles andere ausblendet. Man kann das nicht ernst nehmen. Die Grünen greifen sich das erste Argument, das ihnen nützt, und benutzen es gegen die Kernkraft – unabhängig von Fakten. Das ist durchsichtig und inhaltlich schwach.
NIUS: Kommen wir zur Klimawissenschaft. Wie bewerten Sie die Berichte des Weltklimarats (IPCC)? Gibt es für Sie eine „Basiswahrheit“ – also die Aussage, dass es wärmer wird – oder ist das ganze Konzept problematisch?
Peters: Natürlich ändert sich das Klima – das ist der Normalfall der Erdgeschichte. Aber wie und warum es sich ändert, ist schwer zu sagen. Die Datenlage ist dünn. Per Definition beschreibt „Klima“ das gemittelte Wetter über 30 Jahre an einem Ort. Der Begriff „globales Klima“ ist da schon eine sehr künstliche Abstraktion – eher ein rechnerisches Konstrukt. Man könnte auch sagen: die Durchschnittstemperatur aus Eiswasser und heißer Suppe.
Wir betreiben in der Klimaforschung häufig keine falsifizierbare Wissenschaft im Sinne Karl Poppers. Viele Aussagen lassen sich nicht überprüfen – oder beruhen allein auf Modellen. Modelle sind nützlich, aber sie können zentrale Dinge gar nicht abbilden, etwa die Wolkenbildung. Und die ist entscheidend.
NIUS: Warum?
Peters: Weil Wolken die mit Abstand wichtigsten kurzfristigen Temperaturregler auf der Erdoberfläche sind.
Aus Satellitendaten wissen wir, dass die globale Wolkenbedeckung in den letzten 40 bis 50 Jahren zurückgegangen ist. Das erklärt einen Großteil der Erwärmung besser als alles andere. Man kann etwa 80 Prozent der gemessenen Temperaturschwankungen mit der Wolkenbedeckung korrelieren.
Und das ist keine bloße Korrelation – der kausale Mechanismus ist klar: Weniger Wolken heißt weniger Reflexion, also mehr Sonnenstrahlung auf den Boden. Dass die Klimamodelle diesen Effekt nicht sauber simulieren können, führt die Klimawissenschaften in eine tiefe Krise.
NIUS: Gibt es innerhalb der Klimaforschung Stimmen, die das ähnlich sehen?
Peters: Ja, etwa Jochem Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg – einer der renommiertesten Institute überhaupt. Er sagt offen: Wir stoßen bei den Modellen an harte Grenzen. Da wird nicht wie beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) Politik gemacht, sondern echte Physik betrieben.
Jochem Marotzke (in der Mitte), Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie, hier auf einer Fachtagung für Extremwetter.
NIUS: Kommen wir zum Treibhauseffekt. Ist der real – und wenn ja, wie stark wirkt er?
Peters: Der Treibhauseffekt ist real, aber er funktioniert nicht linear. Die Wirkung von CO₂ ist bei niedrigen Konzentrationen am stärksten. Wenn sich die CO₂-Konzentration verdoppelt, heißt das nicht automatisch, dass sich die Temperatur ebenfalls entsprechend erhöht. Die CO2-Bänder sättigen sich irgendwann – dann nimmt der Effekt ab.
Die Vorstellung, dass jedes weitere CO₂-Molekül gleich stark wirkt wie das vorherige, ist physikalisch nicht haltbar. Die Modelle tun aber genau das – sie unterstellen eine lineare Beziehung. Das ist wissenschaftlich nicht überzeugend.
NIUS: Abschließend noch einmal zur Kernkraft: Wie gut ist sie aus Ihrer Sicht geeignet – auch unter Bedingungen des Klimawandels?
Peters: Sie ist geradezu prädestiniert. Man kann Kernkraftwerke sogar in der Wüste betreiben, ganz ohne Wasser – mit Luftkühlung. Der Wirkungsgrad ist dann etwas niedriger, aber die Stromproduktion ist dennoch stabil. Es gibt kaum eine Technologie, die so gut mit heißen Klimata zurechtkommt.
NIUS: Herzlichen Dank für das Gespräch.
Lesen Sie auch: Die Rückkehr des germanischen Donnergotts im Gewand des Klimawahns


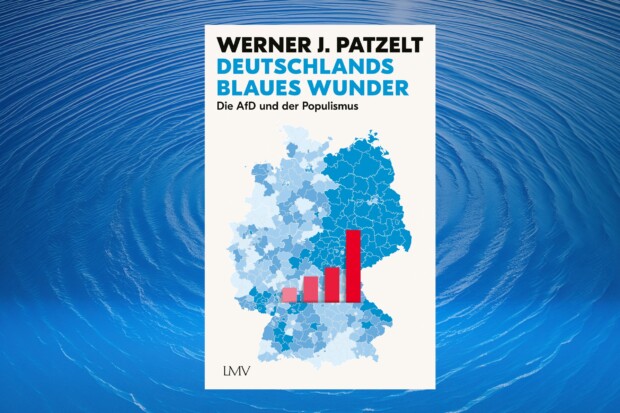





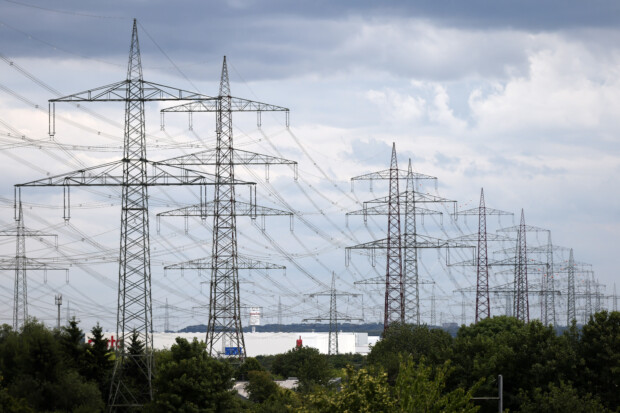

 UKRAINE-KRIEG: "Ausländische Soldaten wären legitimes Ziel!" Jetzt droht Putin Europa direkt! STREAM
UKRAINE-KRIEG: "Ausländische Soldaten wären legitimes Ziel!" Jetzt droht Putin Europa direkt! STREAM






























