
„Ein starkes Europa in einer sich verändernden Welt“, das hat die dänische Regierung über ihre halbjährige Ratspräsidentschaft geschrieben, die gerade beginnt. Aber zunächst einmal muss sich offenbar Europa verändern. Das gilt zumindest für die EU, aber auch für die Länder, die im Europarat vereinigt sind, dem etwa auch Großbritannien weiterhin angehört. Diese Staatengruppe gab es schon vor der heutigen EU und sie bildete ursprünglich den politischen Arm der Europäischen Wirtschaftsunion. Lang ist es her. Die Europarats-Staaten haben sich aber zudem eine gemeinsame Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) sowie einen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg gegeben – beide von zweifelhaftem Nutzen, wo es um den sinnvollen Umgang mit Asylbewerbern und illegaler Migration geht.
Was aus Kopenhagen zu dem Thema kommt, ist ziemlich klar und deutlich. Zu Beginn der dänischen Ratspräsidentschaft sprach sich Europaministerin Marie Bjerre für „ein sichereres, stabileres und robusteres Europa“ aus. Das sei aber „nicht der Fall, wenn wir die Ströme nach Europa nicht kontrollieren“. Bei ihrem Besuch in Berlin hatte auch die Regierungschefin Mette Frederiksen dazu aufgerufen, „den Zustrom nach Europa zu verringern und diejenigen, die kein Recht haben, in unseren Ländern zu bleiben, wirksam zurückzuschicken“. Das scheint vor allem um Abschiebungen zu gehen, könnte aber genauso auf Zurückweisungen angewandt werden. Kanzler Merz fand das anscheinend gut. Könnte der dänische Ansatz einer radikalen Senkung der illegalen Migration auf nahe Null zum echten Vorbild für den Rest des Kontinents werden?
Frederiksen will an genau diesen EU-Komplex ran. Das hat sie schon im Mai deutlich gemacht, als sie gemeinsam mit Giorgia Meloni und sieben weiteren EU-Regierungen (meist aus Osteuropa) einen offenen Brief an die Kommission schrieb, in dem die Regierungschefs vor allem forderten, die Rechtsprechung des Straßburger Gerichtshofs müsse zurechtgestutzt werden. Die dortigen Richter, die paritätisch aus allen Mitgliedsländern besetzt werden, darunter auch Exoten wie Aserbaidschan, hätten nämlich „den Geltungsbereich der Übereinkunft zu weit ausgedehnt im Vergleich zu ihren ursprünglichen Absichten und damit das Gleichgewicht zwischen den zu schützenden Interessen verschoben“.
Dazu aber müssen die Dänen (und mit ihnen die übrigen EU-Regierungen) vielleicht sogar an den Text der Menschenrechtskonvention gehen. Denn es könnte sein, dass schon deren Regelungen aus einer milden, paneuropäischen Zeit etwas zu weit gegangen sind und die heutigen Europäer übermäßig bei ihren „politischen Entscheidungen“ knebeln. Im Grunde war diese Europäische Menschenrechtskonvention – das sagt schon ihr Name – für den europäischen Rahmen geschrieben, ein Europa, das zwischen Sozialismus und freier Marktwirtschaft aufgeteilt war, in dem aber weiter europäische Rechtsgrundsätze gelten sollten und politische Flüchtlinge nicht abgewiesen werden sollten. Es war eine europäische Welt, die man sich so zurechtzimmerte, ohne Folter, ohne „erniedrigende Strafe oder Behandlung“, die – man wusste es auch damals schon – außerhalb des Kontinents häufig nicht existierte. Man dachte damals nicht daran, deshalb zwei Drittel der Menschheit bei sich aufzunehmen. Das war nicht der Plan. Und dahin scheinen die Damen Meloni und Frederiksen zurück zu wollen, und das wäre nur vernünftig.
Wie sie es anstellen wollen, ist noch nicht ganz klar. Vielleicht reicht es ja aus, den Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg ein wenig zurückzupfeifen, aber auch dazu braucht es Beschlüsse von den EU-27, die etwas wert sind. Etwa zu den sicheren Drittstaaten. So sorgte es in Griechenland für leichtes Kopfschütteln, als die EU in einer jüngeren Entscheidung zwar eine Liste von sieben sicheren Herkunftsländern veröffentlichte, darin aber die Türkei nicht vorkam, dafür aber der Kosovo und Bangladesch.
Die griechische Regierung hatte die Türkei im Sommer 2021 als sicheren Drittstaat eingeordnet, was in Teilen der EU auf Kritik stieß. 15 „NGOs“ schrieben einen Brief an die EU-Asylagentur (EUAA). Grüne EU-Abgeordnete forderten die Aussetzung der Einordnung, da die Türkei ihrerseits die Anwendung der gemeinsamen Erklärung und die Rücknahme von illegalen Migranten aus der EU (Griechenland) ausgesetzt hatte. Ylva Johansson nahm eine Zwischenposition ein und schrieb als Antwort, dass Athen selbst entscheiden könne, ob es die eigene Einschätzung hier aufweichen will oder nicht. Athen wollte natürlich nicht.
Aber der Straßburger Gerichtshof scheint in diesen Fragen keineswegs nachgeben zu wollen. Im April erließ er eine einstweilige Anordnung gegen Polen und hielt das Land so davon ab, zwei Frauen aus dem Kongo und Somalia nach Weißrussland zurückzuschieben. So wollte das Gericht Polen trotz der „hybriden“ Bedrohung und trotz des eigens errichteten Grenzzauns dazu zwingen, Asylbewerber aus Belarus aufzunehmen. Polen widersetzte sich in diesem Fall.
Ähnlich erging es im Januar der griechischen Regierung: Laut Entscheidung des Straßburger Gerichtshofes musste das Land eine Frau mit 20.000 Euro entschädigen, die es zu Unrecht in die Türkei zurückgeschoben habe. Es handelte sich offenbar um eine überzeugte Anhängerin des religiösen Parteiführers Fethullah Gülen, die bei ihrer Rückkehr in die Türkei festgenommen wurde, wie der Guardian schreibt. Die Gegner einer konsequenten Grenzpolitik jubilierten: Mit der EGMR-Entscheidung steht die gesamte Praxis der regelmäßigen Zurückschiebungen an der Evros-Grenze und andernorts unter Beschuss.
Für Meloni waren die Vorwürfe schlicht „schändlich“. Die italienischen Ordnungskräfte zeigen nach ihr „Mut, Hingabe und Achtung vor dem Gesetz“, während sie sich häufig „von illegalen Einwanderern angegriffen“ sähen. Auch erinnerte Meloni daran, dass Italien einst zu den Gründungsstaaten des Europarats gehörte, der angetreten sei, um „die Demokratie, die Menschenrechte und den Rechtsstaat zu schützen“. Heute scheine dieser Geist verloren gegangen zu sein, an seine Stelle träten „zunehmend parteiische Erklärungen, die weit von der Realität entfernt sind“. Im Hintergrund stehe ein „ideologischer Ansatz“ beim Europarat und „offensichtliche Vorurteile“. Der Koalitionspartner Lega tweetete, der Europarat sei „ein nutzloses Gebilde, das aufgelöst werden soll“. Außenminister Tajani fand die Anschuldigungen „abstrus“.
Aber es sind auch Urteile und „Einwürfe“ von supranationalen Gemeinschaftsinstitutionen wie diesen, die immer mehr Einzelstaaten dazu bewegen, eigene Wege zu gehen. Fast ist sogar die Bundesregierung mit von dieser Partie, seit sie intensivierte Grenzkontrollen „in enger Absprache“ mit den Nachbarn eingeführt hat und eine gewisse Zahl an illegal einreisenden Migranten zurückweist. Die Süd- und anderen Erstankunftsländer weigern sich ohnehin zunehmend, Migranten laut Dublin-Verordnung zurückzunehmen.
Es ist vor diesem vielstimmigen Hintergrund, dass Dänemark zusammen mit mindestens acht Verbündeten, darunter die Regierungen Belgiens und Österreichs, versucht, die EU-Asylpolitik nachhaltig zu verändern – weil man in Kopenhagen verstanden hat, dass die Mitgliedsländer inzwischen sämtlich überlastet und regelrecht gezeichnet sind von der jahrelangen Massenzuwanderung. Außerdem hat die dänische Regierung auch lange den unmoralischen Charakter der illegalen Migration betont, die für viele tausend Todesfälle in Meeren und auf dem Land verantwortlich ist. . Die Dänen gehen das Thema auf ihre Art an: sachte und sachlich. So könnte man die Eigenart der Regierung von Mette Frederiksen umschreiben. Sie vermeidet unbillige Dramatisierungen, bleibt aber in der Sache fest und bestimmt. Man wird sehen, was dabei herauskommt. Gegenwind ist zu erwarten, wenn auch noch nicht sicher ist, wer außer dem sozialistisch regierten Spanien die Stimme in dieser Richtung erheben könnte. Wird Macron unauffällig mitziehen, um einen politischen Stich gegen das Rassemblement zu machen? Aus Deutschland könnten die Sozialdemokraten – und indirekt die Grünen – Merz und Dobrindt an die Kandarre nehmen und eine deutsche Zustimmung zu Entscheidungen verhindern. Daneben gibt es noch eine denkbare Opposition – das ist die Gemeinde der „Europarechtler“ samt „NGO“-Anhang, die das Treiben der Regierenden aus dem Off kontrollieren. Demokratisch wäre das freilich nicht, das ist Frederiksens und Melonis bestes Argument.





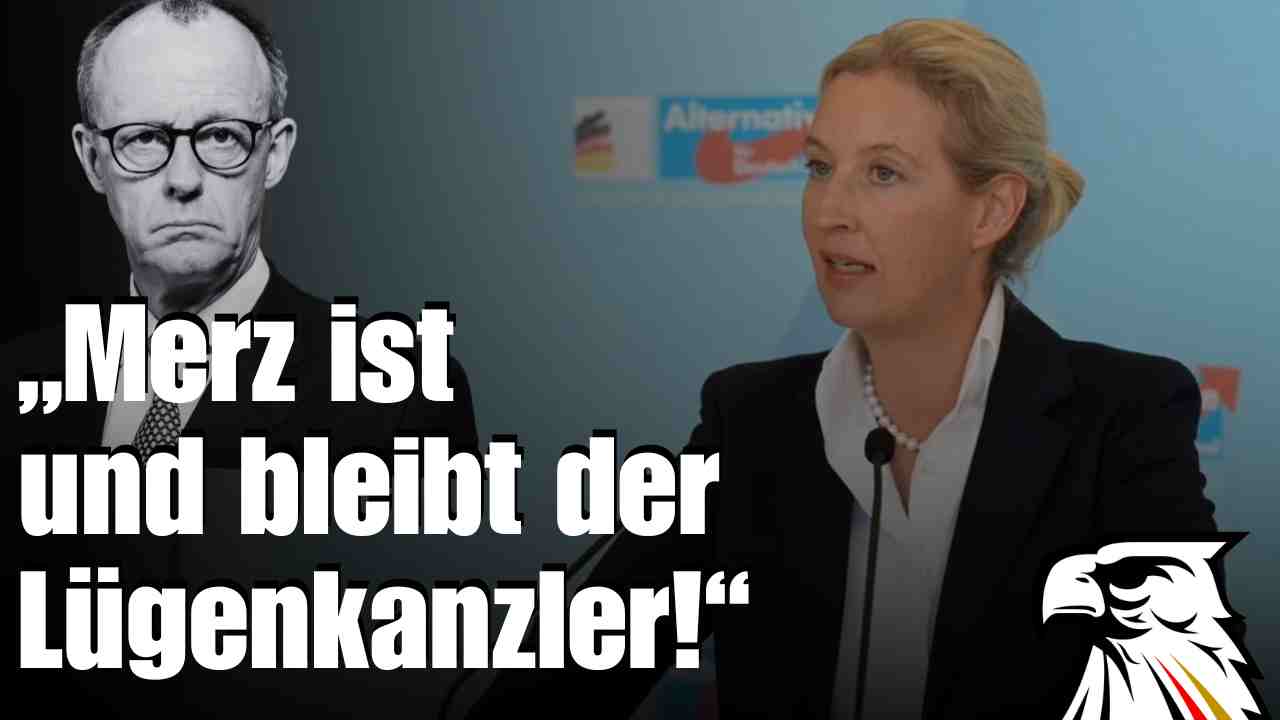



 FRANKREICH: Premierminister Bayrou verliert Vertrauensfrage! Droht Macron nun der Rücktritt? | LIVE
FRANKREICH: Premierminister Bayrou verliert Vertrauensfrage! Droht Macron nun der Rücktritt? | LIVE






























