
Das Lieferkettengesetz zielt darauf ab, Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße in ihren globalen Lieferketten zur Verantwortung zu ziehen. Es entwickelte sich zu einem bürokratischen Monster, das alles bisher da gewesene in den Schatten hätte stellen können. So sollten Firmen verpflichtet werden, auf die Einhaltung bestimmter Umweltstandards zu achten – inklusive CO2-Emissionen, Entwaldung oder dem Einsatz giftiger Chemikalien. Ein Automobilhersteller müsste bei seinen Lieferanten die komplette Lieferkette einer Batterie durchgehen und beispielsweise sicherstellen, dass bei der Gewinnung von Lithium für Batterien keine giftigen Abwässer in Flüsse gelangen.
Große Unternehmen sollen verpflichtet werden, einen Plan zu erstellen, wie sie mit ihrem Geschäftsmodell das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einhalten wollen. So müsste ein Ölkonzern offenlegen, wie er seine Emissionen so senken will, dass sie mit den EU-Klimazielen vereinbar sind, also, wie er im Prinzip sein Geschäft langsam beenden will.
Unternehmen sollten künftig sicherstellen, dass entlang ihrer gesamten Lieferkette keine Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder Diskriminierung stattfindet. Ein europäischer Modekonzern müsste danach prüfen, ob in Nähereien in Bangladesch Arbeitsrechte verletzt werden – nicht nur beim direkten Lieferanten, sondern auch bei sämtlichen Subunternehmen.
Betroffene von Menschenrechtsverletzungen wie etwa Arbeiter in Übersee sollten europäische Unternehmen vor EU-Gerichten verklagen können, wenn diese ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen. Eine Kakaobäuerin aus Ghana könnte ein Schokoladenunternehmen in Europa verklagen, wenn das Unternehmen durch unterlassene Kontrollen Zwangsarbeit billigend in Kauf genommen hat.
Das würden die natürlich nicht von sich aus tun, sondern mit kräftiger Unterstützung vieler NGOs, für die sich ein weiteres breites Feld auftut. Der Millionenkonzern Greenpeace, dem nun auch Gelder entgehen dürften, kritisierte jetzt, der „desaströse“ Kommissionsvorschlag höhle Menschenrechts- und Umweltschutzstandards aus. Unter dem Dach von Greenpeace haben 360 Nichtregierungsorganisationen und Verbände gegen den Vorschlag protestiert.
Deutsche Unternehmen müssen sich bereits mit einer Vorform des EU-Lieferkettengesetzes herumplagen. Das deutsche Lieferkettengesetz, seit Januar 2023 in Kraft, sieht eine Pflicht zur Risikoanalyse vor. Unternehmen müssen regelmäßig Risiken von Menschenrechtsverletzungen in ihrer Lieferkette identifizieren. Sie können sich allerdings auf direkte Zulieferer beschränken. Nur wenn es konkrete Hinweise gibt, muss auch bei indirekten Zulieferern geprüft werden.
Es gibt keine zivilrechtliche Haftung. Betroffene können Unternehmen nicht direkt verklagen – nur das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) kann Bußgelder verhängen.
Das Direktoriumsmitglied in der Europäischen Zentralbank, Frank Elderson, sagte, nur mit einer gründlichen sogenannten Nachhaltigkeitsberichterstattung könne die EZB erkennen, ob die Unternehmen ausreichend in die grüne Transformation investierten.
Die Verschiebung soll Unternehmen mehr Zeit geben, sich auf die neuen Anforderungen vorzubereiten. Zudem plant die EU-Kommission, das Gesetz inhaltlich zu überarbeiten und zu vereinfachen, um den bürokratischen Aufwand für Unternehmen zu reduzieren. Wirtschaftsverbände erklärten schon seit langem, dass die Regelungen die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Unternehmen beeinträchtigen. Die Vorschriften seien exzessiv und brächten erhebliche bürokratische Belastungen mit sich.
Saad Sherida al-Kaabi, der Energieminister Katars, hatte den Ideologen in Brüssel bereits Ende des vergangenen Jahres die ökonomische Realität brutal und deutlich ins Gedächtnis gerufen: Sollten Katar Strafen drohen, weil sein Flüssigerdgas nicht den neuen Regelungen zur Nachhaltigkeitsprüfung entspricht, wird man es eben nicht mehr in die EU liefern. Verstöße können nämlich mit Geldstrafen von bis zu fünf Prozent des weltweiten Umsatzes geahndet werden. Das sei gleichbedeutend mit fünf Prozent der Staatseinnahmen Katars, was für das Land nicht tragbar wäre.
„Wenn ich fünf Prozent meines Umsatzes verliere, weil ich Europa beliefere, werde ich Europa nicht beliefern“, so al-Kaabi kühl. Katar ist einer der wichtigsten Lieferanten von Flüssigerdgas (LNG) für Europa. QatarEnergy, der staatliche Energieriese, hat langfristige LNG-Lieferverträge mit Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden abgeschlossen. Al-Kaabi: „Fünf Prozent der Einnahmen von QatarEnergy bedeuten fünf Prozent der Einnahmen des Staates Katar. Das ist das Geld des Volkes – und niemand würde es akzeptieren, so viel Geld zu verlieren.“ Weiter meint er, die EU solle das Gesetz zur Sorgfaltspflicht gründlich überprüfen.
Katar hätte keine Probleme, sein LNG loszuwerden. Das musste auch Bundeswirtschaftsminister Habeck erfahren, als er nach dem Lieferstopp für Gas aus Russland nach Katar flog und dort um zusätzliche LNG-Lieferungen bettelte. „Aber nur für ein paar Jahre“, fügte er hinzu – dies ausgerechnet gegenüber den Herrschern am Golf, die mit gigantischen Investitionen in ihre LNG-Produktionsanlagen die Kapazitäten verdoppeln und nur über langfristige Lieferverträge zu reden gewohnt sind. Da nützte auch sein tiefer Bückling nichts mehr.
Katar müsste einen Lieferausfall nach Europa nicht fürchten; asiatische Länder mit ihrem zunehmenden Energiehunger wären gute Abnehmer. Und ob die USA sich bei ihren LNG-Lieferungen nach Europa auf solche abseitigen, extrem teuren Bürokratenspielchen einlassen würden, ist mehr als fraglich.
Nach denen dürfte übrigens keine einzige Batterie für E-Autos nach Europa eingeführt werden. Zu verschlungen sind die Wege, auf denen die gigantischen Rohstoffmengen für die Batterieherstellung aus aller Welt kommen. Dass deren Nachhaltigkeit irgendwie dokumentiert würde, können nur Hardcore-Grüne in Brüssel glauben.




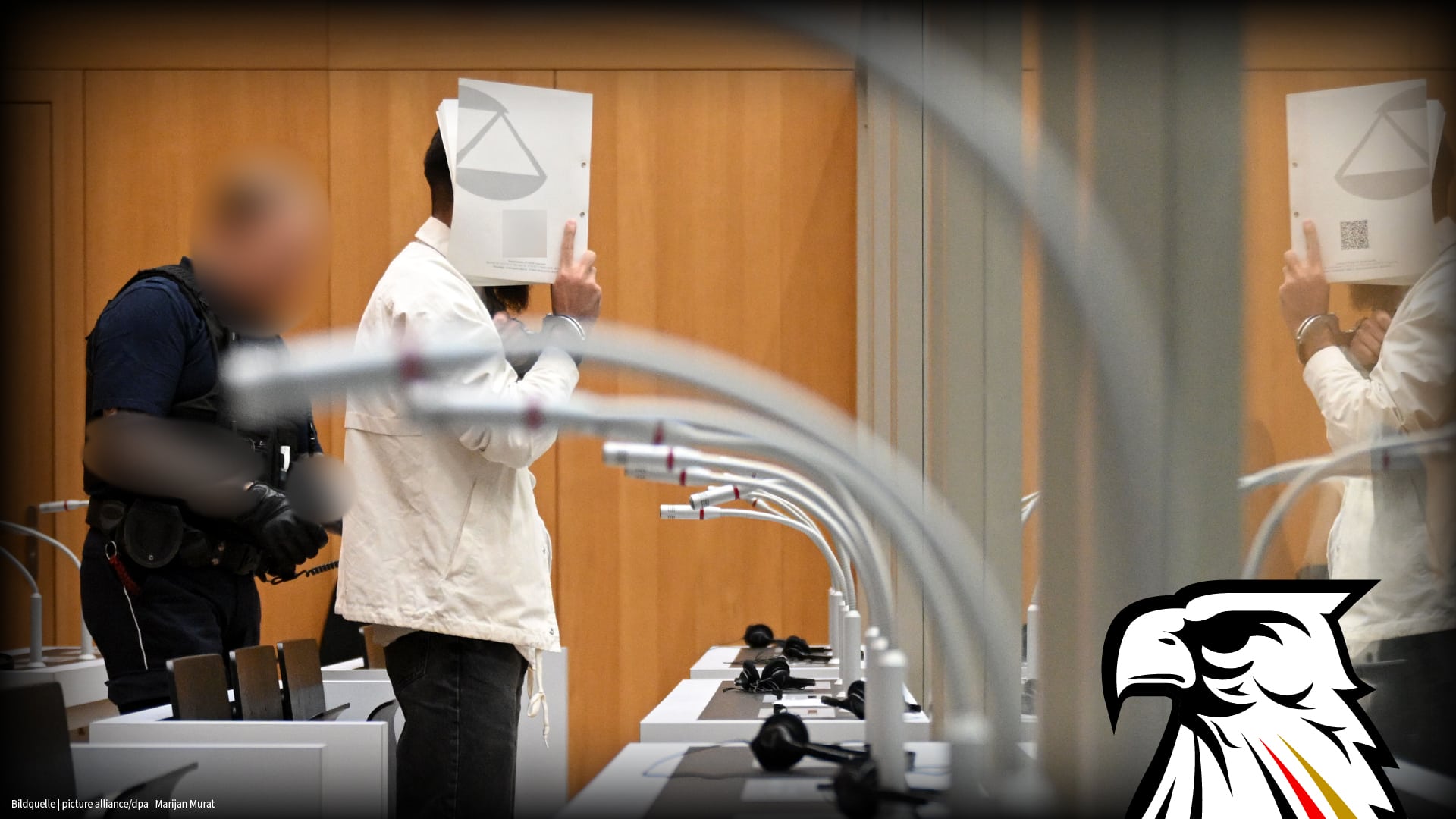




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























