
Deutsche Truppen in die Ukraine – zur Friedenssicherung nach Ende des Krieges? Lars Klingbeil wollte es im ZDF-Sommerinterview am Sonntag nicht ausschließen, schwurbelte sich um eine klare Antwort herum. Das erledigte dann Außenminister Johann Wadephul für ihn. Gegenüber table.media sagte der CDU-Politiker, man habe verabredet, dass sich die Bundeswehr auf das NATO-Territorium konzentrieren solle. Deutschland habe bereits eine Brigade in Litauen stationiert. Zusätzlich noch deutsche Soldaten in der Ukraine zu stationieren, „würde uns voraussichtlich überfordern“, so Wadephul. Stunden nach Veröffentlichung des Interviews ruderte Wadephul dann zurück und erklärte, das habe er so nie gesagt – die Presse habe ihn bloß falsch interpretiert.
Was auch immer Wadephul sagt oder meint, Fakt bleibt: Donald Trump erwartet, dass es europäische Truppen sind, die einen Frieden in der Ukraine absichern sollen. Das ist Ergebnis seines diplomatischen Marathons rund um den Ukraine-Krieg. Die Bereitschaft dafür gibt es hier seit langem: Schon im März veranstaltete Frankreichs Präsident Macron zusammen mit dem britischen Premier Keir Starmer einen Gipfel in Paris, bei dem sich eine „Koalition der Willigen“ formierte – willig, einen Waffenstillstand zwischen Moskau und Kiew mit eigenen Soldaten abzusichern. Auch die Niederlande und Schweden hatten sich offen gezeigt.
Damals wurde allerdings unter anderen Vorzeichen, vor allem unter vielen Fragezeichen, diskutiert. Damals hieß es von Experten, eine europäische Mission zur Absicherung einer möglichen Waffenstillstandslinie zwischen Russland und der Ukraine wäre personell kaum machbar: Denn dafür wären nach der Meinung von militärischen Kennern mindestens 100.000 Soldaten unmittelbar an der Front nötig. Truppen, die EU-Europa auch mit britischer Hilfe nicht aufbringen könnte.
Der Trump-Putin-Plan mit einem tatsächlichen Frieden statt eines Waffenstillstandes hingegen sähe das wohl nicht vor. Stattdessen ginge es um ein bekanntes NATO-Prinzip: den Stolperdraht. Diese Idee stand bereits hinter der Präsenz von wenigen Bündnistruppen im Baltikum, bis der russische Vollangriff auf die Ukraine die Prioritäten verschob.
Der Gedanke: Eine kleine Anzahl von westlichen Soldaten ist nicht genug, um einen Einmarsch aufzuhalten – sie fungiert aber als „Stolperdraht“, weil Kampfhandlungen gegen westliche Truppen den Kriegseintritt der betroffenen Staaten zur Folge hätte. Schießen Russen auf NATO-Truppen, wird die NATO zurückschießen. So war acht Jahre lang die Strategie im Baltikum: Deutschland führte eine multinationale „Battlegroup“ in Litauen, die Kanadier eine in Lettland und die Briten eine in Estland. Sie sollten Russland klarmachen, dass ein Angriff auf die kleinen Balten auch ein Angriff auf die NATO insgesamt wäre – nicht theoretisch-politisch, sondern tatsächlich und direkt.
Orientiert man sich am baltischen Stolperdraht-Konzept, würde dies eine vierstellige Anzahl an Truppen bedeuten. Allerdings deutlich mehr als damals im Baltikum, allein, um der Größe der Ukraine Rechnung zu tragen – aber sicher keine 100.000, wie noch im März diskutiert. Wo diese stationiert werden würden, kann nur spekuliert werden: etwa bei Kiew oder am Fluss Dnjepr, bei der wichtigen Hafenstadt Odessa oder bei Charkiw im Nordosten des Landes. Diese würden einen russischen Einmarsch natürlich nicht aufhalten, ihn mit den Ukrainern zusammen aber verzögern können. Doch um die tatsächliche militärische Bedeutung geht es beim Konzept Stolperdraht wie gesagt nicht – die stärkste Waffe dieser Truppen wäre, sich beschießen zu lassen und so Europa und die NATO als Kriegspartei zu aktivieren.
Womit sich dort direkt die nächste Frage stellt: Wie belastbar wäre das US- und NATO-Commitment zum Schutz einer solchen Truppe? Donald Trump soll laut Berichten klargemacht haben, dass er keine US-Soldaten in die Ukraine schicken und die europäische Präsenz allenfalls im Hintergrund, mit Logistik und anderweitig, unterstützen würde. Würde es zum Worst Case kommen und Schüsse fallen: Wäre dann die NATO inklusive Amerika im Krieg mit Russland?
Das bleibt offen. Der berühmte Artikel Fünf der NATO-Charta, die Beistandsklausel, hält fest, „dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird“. Die Vertragsparteien würden „die Maßnahmen, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt“ treffen, „die sie für erforderlich erachten, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten.“
Das lässt allerdings Interpretationsspielraum offen: Was eine US-Administration im Fall der Fälle für „erforderlich“ in diesem Sinne erachten würde, ist unter Trump nicht mehr sicher. Schon in der Vergangenheit sägte der US-Präsident an Artikel Fünf, und auch, wenn er die Säge inzwischen weggelegt hat: Die Amerikaner, insbesondere die Republikaner und das MAGA-Lager, haben nach einem Jahrzehnt der Interventionen in aller Welt immer weniger Lust darauf, Weltpolizei zu spielen. Die alten, isolationistischen Tendenzen könnten in so einer Situation voll aufdrehen: Russland hat ja Amerika nicht angegriffen, warum sollte Amerika dann Russland angreifen?
Solche Tendenzen sind allerdings keineswegs auf die eine Seite des Atlantiks beschränkt. Der Gedanke, Bundeswehrsoldaten im Zweifel aus rein strategischen Gründen in ein sicher verlorenes Gefecht zu schicken und hunderte Männer und Frauen dort für effektiv nichts zu opfern, wird auch in der deutschen Bevölkerung sicher nicht gut ankommen – zumal, wenn es nicht um einen NATO-Partner geht, dem wir vertraglich und gegenseitig verpflichtet sind, sondern um die Ukraine. Und auch ohne ein solches Worst-Case-Szenario zu bedenken, ist die Idee hochumstritten: Im Februar erhob das Umfrage-Institut Forsa im Auftrag des Magazins Stern Zahlen zur Frage von Bundeswehr-Friedenstruppen in der Ukraine. Sie zeigen eine deutliche Spaltung: 49 Prozent sprachen sich damals für einen solchen Einsatz aus, 44 Prozent waren dagegen. Eine knappe Mehrheit der Westdeutschen unterstützte die Idee, während im Osten 60 Prozent dagegen waren.
Das bedeutet vor allem: Ein solcher Schritt könnte heftige, innenpolitische Verwerfungen provozieren und insbesondere die Union mit Blick auf eine wahrscheinlich profitierende AfD unter Druck setzen. Und ob die SPD so eine Maßnahme mittragen würde, darf ob des Stegner-Mützenich-Blocks und ähnlicher Strömungen in der Partei auch bezweifelt werden. Es hatte schon einen Grund, dass Parteichef Klingbeil eine klare Antwort auf die Frage nach deutschen Truppen so merklich umschiffte.
Trumps fixe Idee umzusetzen, wird also schwierig werden – maßgeblich auch wegen innenpolitischer Hindernisse. Wenn Deutschland aber nicht mitgeht, werden sich viele andere europäische Nationen einen schlanken Fuß machen – warum sollten Spanier, Tschechen oder Polen in der Ukraine Friedenssicherung betreiben, wenn das wirtschaftlich stärkste und politisch mächtigste Land der EU nicht mitmacht?




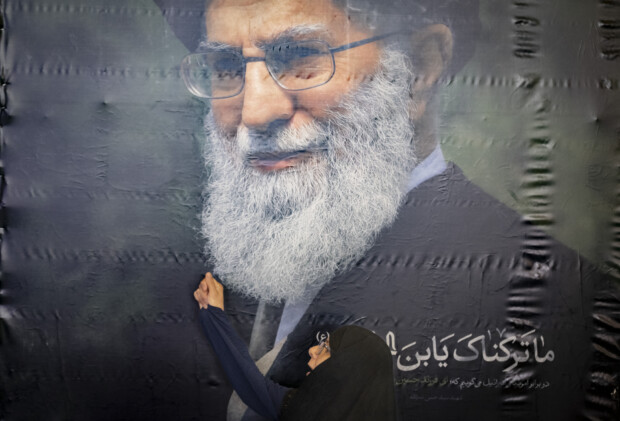




 Washingtons Megagipfel: Selenskyj mit Rückenwind aus Europa! – Entscheidende Woche für die Ukraine?
Washingtons Megagipfel: Selenskyj mit Rückenwind aus Europa! – Entscheidende Woche für die Ukraine?






























